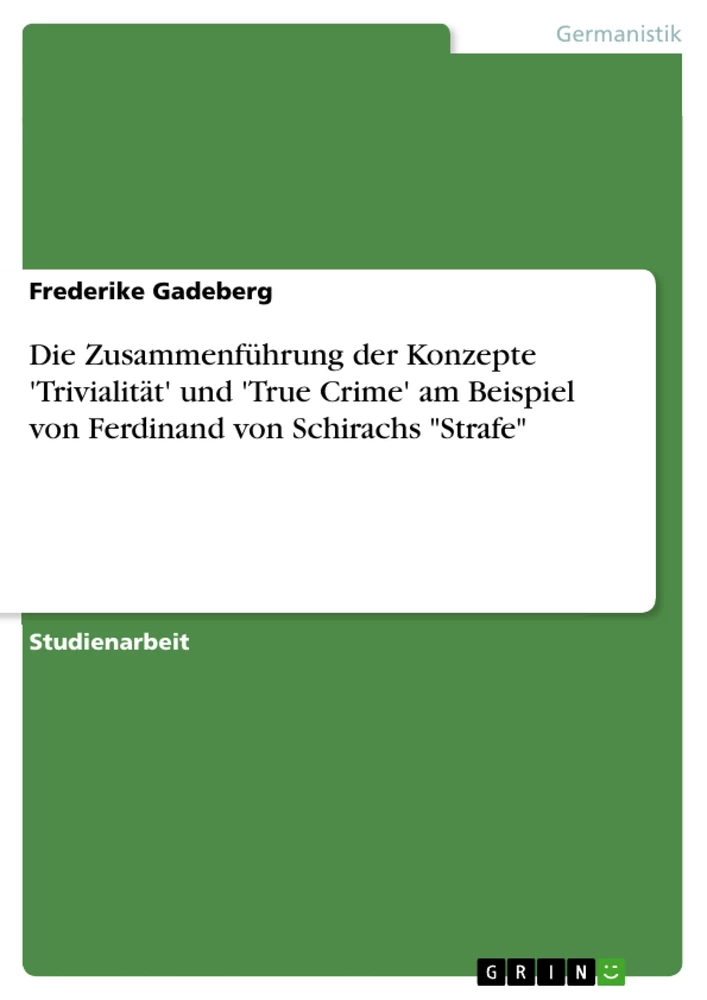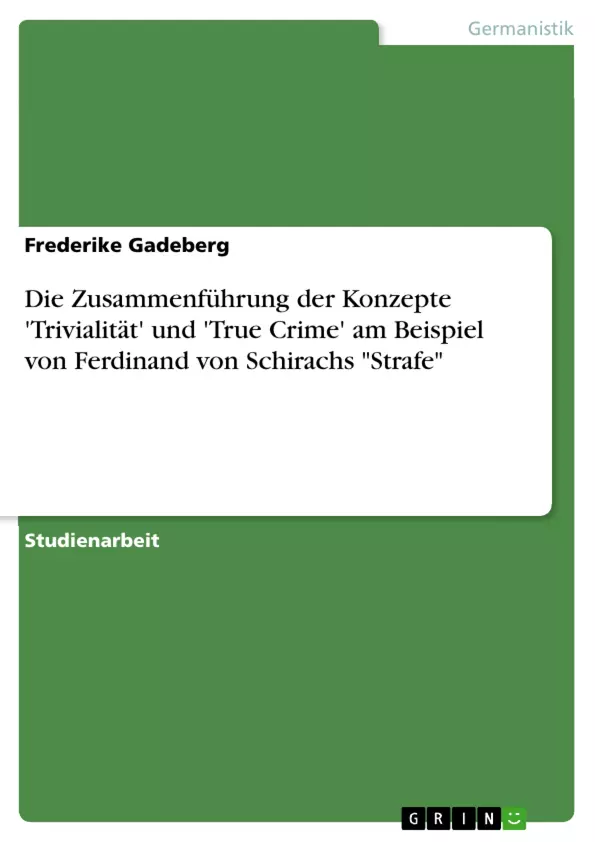Die vorliegende Arbeit stellt sich die Frage, inwieweit True-Crime-Formate, also die Auseinandersetzung mit wahren Verbrechen, als trivialliterarische Texte gelesen werden können. In dieser Arbeit soll am Beispiel von "Strafe" untersucht werden, inwiefern sich die beiden übergeordneten Diskurse gegenseitig ausschließen.
Für die Untersuchung werden zunächst das Konzept von Trivialliteratur und das Format True-Crime theoretisch dargelegt. Mithilfe der Merkmale trivialliterarischer Texte und grundlegender Aspekte von True-Crime-Formaten lassen sich bereits variierende Arbeitshypothesen formulieren. Die Hypothesen berühren die Bereiche von Kriminalliteratur und Hybridität und damit einhergehend das Verhältnis von Autorschaft und Erzählinstanz. Darüber hinaus geht es um die ethische Betrachtung True-Crimes und um Faktizität und Authentizität als Stilmittel. Zuletzt wird die Hypothese entfaltet, dass sich "Strafe" als trivialliterarischer Text lesen lässt. Somit lassen sich die übergeordnete Fragestellung und die Arbeitshypothesen bei der Analyse von "Strafe" als Erzähltext implizit berücksichtigen. Die Ergebnisse der Analyse werden daraufhin gezielt vor dem Hintergrund eben genannter vorheriger Überlegungen diskutieren und abgehandelt.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Theorie und Arbeitshypothesen
- Das Konzept von Trivialität und seine Merkmale
- True-Crime als Subkategorie von Kriminalliteratur
- Arbeitshypothesen
- Ferdinand von Schirach: Strafe
- Inhaltliche Hinführung
- Analyse von Strafe als Erzähltext
- Diskussion vor dem Hintergrund der Arbeitshypothesen
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die vermeintliche Trivialität von Ferdinand von Schirachs „Strafe“ im Kontext des True-Crime-Genres. Die Zielsetzung besteht darin, die beiden Diskurse – Trivialliteratur und True Crime – gegeneinander abzuwägen und zu analysieren, inwieweit sie sich im Werk widersprechen oder ergänzen. Die Analyse fokussiert auf die spezifischen Merkmale von Trivialliteratur und True-Crime-Formaten und deren Anwendung in Schirachs Werk.
- Definition und Merkmale von Trivialliteratur
- Charakteristika des True-Crime-Genres
- Analyse von "Strafe" als Erzähltext
- Das Verhältnis von Faktualität und Fiktion in True-Crime-Literatur
- Die ethische Dimension von True-Crime-Darstellungen
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik ein und stellt die Forschungsfrage nach der Vereinbarkeit von Trivialität und True Crime am Beispiel von Ferdinand von Schirachs „Strafe“. Sie beschreibt die kontroverse Rezeption von Schirachs Werken und die allgemeine Problematik der Einordnung von Kriminalliteratur als triviale Literatur. Die Einleitung skizziert den Aufbau der Arbeit und die zu verfolgenden methodischen Ansätze.
Theorie und Arbeitshypothesen: Dieses Kapitel beleuchtet das Konzept der Trivialliteratur und seine Merkmale. Es werden verschiedene Definitionen und Ansätze aus der Literaturwissenschaft diskutiert, um ein für die Arbeit relevantes Verständnis von Trivialliteratur zu entwickeln. Der True-Crime-Diskurs wird als Subgenre der Kriminalliteratur eingeführt. Abschließend werden Arbeitshypothesen formuliert, welche die Analyse von "Strafe" leiten.
Ferdinand von Schirach: Strafe: Dieses Kapitel beinhaltet eine detaillierte Analyse von Schirachs "Strafe". Es werden sowohl inhaltliche Aspekte des Buches als auch seine erzählerischen Strategien untersucht. Der Fokus liegt darauf, die Anwendung von Merkmalen der Trivialliteratur und des True-Crime-Genres zu identifizieren und zu bewerten. Die Ergebnisse der Analyse werden im Hinblick auf die formulierten Arbeitshypothesen diskutiert. Die Kapitel untersuchen, wie Schirach die realen Kriminalfälle darstellt und welche narrative Techniken er einsetzt, um die Spannung und den Unterhaltungswert zu erhöhen. Die Diskussion bezieht die vorangegangenen theoretischen Ausführungen mit ein.
Schlüsselwörter
Trivialliteratur, True Crime, Ferdinand von Schirach, Strafe, Kriminalliteratur, Faktualität, Fiktion, Erzähltextanalyse, Rezeption, Hybridität, Authentizität, Ethische Dimension.
Häufig gestellte Fragen zu "Strafe" von Ferdinand von Schirach
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese akademische Arbeit untersucht die vermeintliche Trivialität von Ferdinand von Schirachs "Strafe" im Kontext des True-Crime-Genres. Sie analysiert, inwieweit sich die Diskurse von Trivialliteratur und True Crime im Werk widersprechen oder ergänzen.
Welche Aspekte werden in der Analyse betrachtet?
Die Analyse fokussiert auf die spezifischen Merkmale von Trivialliteratur und True-Crime-Formaten und deren Anwendung in Schirachs "Strafe". Dies beinhaltet die Definition und Merkmale von Trivialliteratur, die Charakteristika des True-Crime-Genres, die Analyse von "Strafe" als Erzähltext, das Verhältnis von Faktualität und Fiktion, sowie die ethische Dimension von True-Crime-Darstellungen.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in eine Einleitung, ein Kapitel zu Theorie und Arbeitshypothesen, ein Kapitel zur detaillierten Analyse von "Strafe" und ein Fazit. Die Einleitung führt in die Thematik ein und stellt die Forschungsfrage. Das zweite Kapitel beleuchtet das Konzept der Trivialliteratur und des True-Crime-Genres. Das dritte Kapitel analysiert "Strafe" hinsichtlich inhaltlicher Aspekte und erzählerischer Strategien.
Wie wird "Strafe" analysiert?
Die Analyse von "Strafe" untersucht sowohl inhaltliche Aspekte des Buches als auch seine erzählerischen Strategien. Der Fokus liegt auf der Identifizierung und Bewertung der Anwendung von Merkmalen der Trivialliteratur und des True-Crime-Genres. Die Ergebnisse werden im Hinblick auf die formulierten Arbeitshypothesen diskutiert.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Trivialliteratur, True Crime, Ferdinand von Schirach, Strafe, Kriminalliteratur, Faktualität, Fiktion, Erzähltextanalyse, Rezeption, Hybridität, Authentizität, Ethische Dimension.
Welche Zielsetzung verfolgt die Arbeit?
Die Zielsetzung besteht darin, die beiden Diskurse – Trivialliteratur und True Crime – gegeneinander abzuwägen und zu analysieren, inwieweit sie sich im Werk widersprechen oder ergänzen. Die Arbeit untersucht die Vereinbarkeit von Trivialität und True Crime am Beispiel von "Strafe".
Welche methodischen Ansätze werden verwendet?
Die Einleitung skizziert die methodischen Ansätze, die für die Analyse von "Strafe" verwendet werden. Die Arbeit diskutiert verschiedene Definitionen und Ansätze aus der Literaturwissenschaft, um ein für die Arbeit relevantes Verständnis von Trivialliteratur zu entwickeln.
- Arbeit zitieren
- Frederike Gadeberg (Autor:in), 2020, Die Zusammenführung der Konzepte 'Trivialität' und 'True Crime' am Beispiel von Ferdinand von Schirachs "Strafe", München, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/1290544