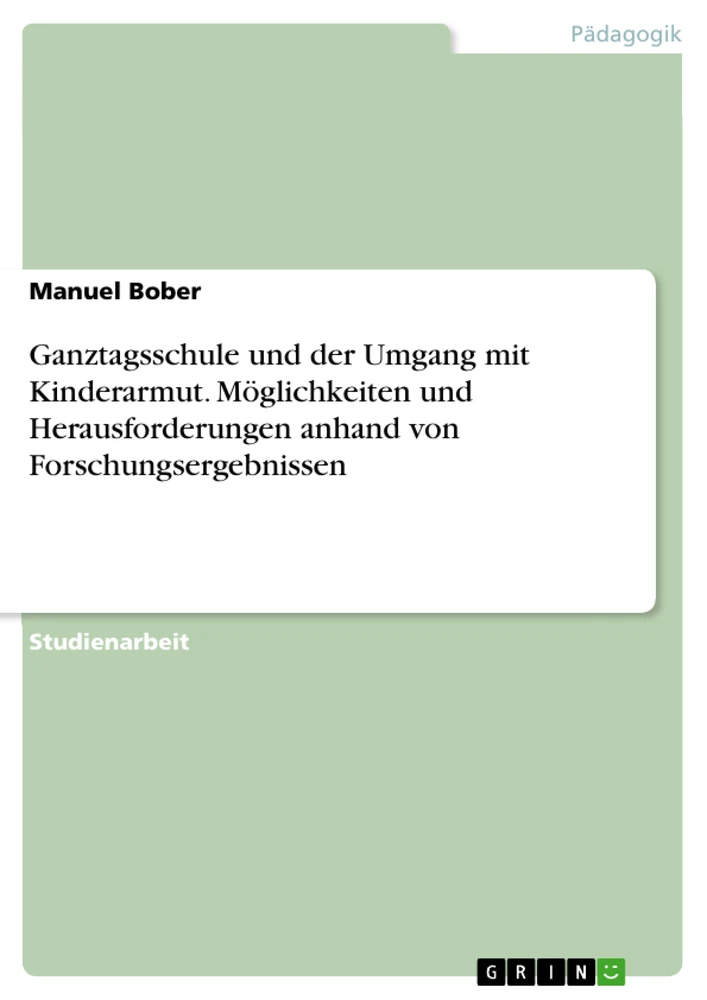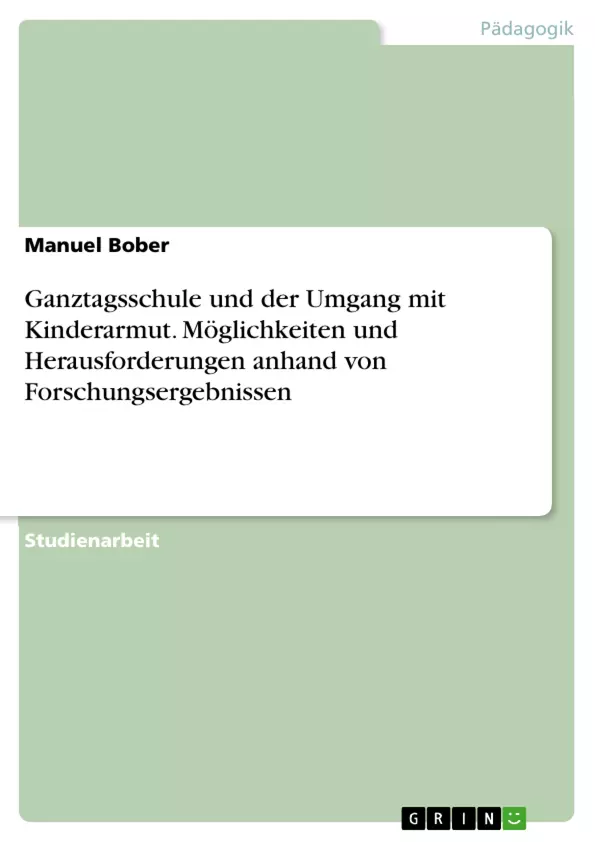Die Arbeit ist an eine Hypothese der Autorin Schlicht (2011) angelehnt: „je größer das Angebot an frühkindlicher Bildung in einem Bundesland ist, desto geringer ist das Ausmaß sozialer Bildungsungleichheit“. Sie beschäftigt sich mit der folgenden Fragestellung: Welche Möglichkeiten und Herausforderung bieten sich der Institution Schule unter der Berücksichtigung ganztagsschulbezogener Forschungsergebnisse im Kontext von herrschender Kinderarmut in Deutschland, um eine mögliche Benachteiligung von betroffenen Kindern und Jugendlichen auszugleichen?
Kinderarmut und dessen Präsenz und Auswirkung dienen in der vorliegenden Arbeit als Ausgangslage und benötigen hierfür eine Erläuterung und statistische Veranschaulichung, damit weitere Schritte im Verständnis verfolgt werden können. Hierzu werden in Kapitel 1 die wichtigsten Lebenslagendimensionen im Kontext von Kinderarmut anhand von Butterwegge (2017) erläutert und in den jeweiligen Unterkapitel spezifiziert. Abgeschlossen wird Kapitel 1 mit einem statistischen Aufzeigen von aktuellen Zahlen durch Lietzmann und Wenzig (2020). In Kapitel 2 wird die Institution Schule in Form des Ganztagsmodells und der Umgang mit sozialer Bildungsungleichheit betrachtet. Ausgangslage hierfür sind die durchgeführten Studien von PISA und den sich daraus ergebenen Bildungsreformen im Bereich des Ausbaus und der Weiterentwicklung von Ganztagsschulen zur Minimierung von Chancenungleichheiten.
Die Bearbeitung der Möglichkeiten und Herausforderungen für Ganztagsschulen in Kapitel 3 erfolgt hauptsächlich unter den Ergebnissen der StEG-Studie, welche von 2005 bis 2009 stattgefunden hat. Die Studie zur Entwicklung von Ganztagsschulen startete mit dem Ziel, den Ausbau von Ganztagsschulen in der deutschen Bildungslandschaft empirisch zu begleiten. Das Resümee soll die vorliegende Arbeit im Ganzen zusammenfassen und einen Ausblick über die möglicherweise notwendigen Veränderungen in der Entwicklung von Ganztagsschulen und/oder Gesellschaftspolitik geben.
Inhaltsverzeichnis
- Abkürzungsverzeichnis
- Verzeichnis der Übersichten
- Einleitung
- Kinderarmut in Deutschland
- Das Erleben von Armut aus dem Blickwinkel betroffener Kinder
- Wohnen und Wohnumfeld
- Freizeitaktivitäten
- Bildung in Armutslagen
- Kinderarmut im Spiegel der Statistik
- Institution Schule – Ergebnisse der ganztagschulbezogenen Forschung
- Theoretische Bezüge im Kontext von Schule und Bildungsungleichheit
- Auswirkungen auf Lern- und Erfahrungsmöglichkeiten von betroffenen Kindern
- Möglichkeiten und Herausforderungen für Chancen- und Bildungsgleichheit
- Ergebnisse der StEG-Studie
- Förderung und soziale Integration im Rahmen der Ganztagsschule
- Ausweitung der pädagogischen Praxis und der Organisationsprozesse
- Betreuung und erzieherische Versorgung
- Fazit
- Literaturverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit analysiert die Auswirkungen von Kinderarmut auf die Bildungschancen von Kindern und Jugendlichen in Deutschland und untersucht, welche Möglichkeiten und Herausforderungen sich für die Institution Schule im Kontext der Ganztagsschule bieten, um eine mögliche Benachteiligung von betroffenen Kindern und Jugendlichen auszugleichen.
- Die Relevanz und Auswirkungen von Kinderarmut in Deutschland
- Der Einfluss von Kinderarmut auf Bildungschancen und Lernerfahrungen
- Die Rolle der Ganztagsschule im Kampf gegen Bildungsungleichheit
- Möglichkeiten und Herausforderungen für die Institution Schule im Umgang mit Kinderarmut
- Forschungsergebnisse und empirische Studien zu Ganztagsschulen und Kinderarmut
Zusammenfassung der Kapitel
Kapitel 1 beleuchtet die Lebenslagendimensionen im Kontext von Kinderarmut in Deutschland und schildert das Erleben von Armut aus der Perspektive betroffener Kinder. Es werden unter anderem Themen wie Wohnen und Wohnumfeld, Freizeitaktivitäten sowie die Herausforderungen im Bereich der Bildung behandelt. Des Weiteren werden statistische Daten zur Kinderarmut in Deutschland präsentiert.
Kapitel 2 befasst sich mit der Institution Schule und den Ergebnissen der ganztagschulbezogenen Forschung. Die Arbeit untersucht den Zusammenhang zwischen Schule und Bildungsungleichheit und analysiert die Auswirkungen von Kinderarmut auf Lern- und Erfahrungsmöglichkeiten von betroffenen Kindern. Es werden theoretische Bezüge und wichtige Forschungsergebnisse in diesem Kontext beleuchtet.
Kapitel 3 widmet sich den Möglichkeiten und Herausforderungen für Chancen- und Bildungsgleichheit im Rahmen der Ganztagsschule. Es werden die Ergebnisse der StEG-Studie vorgestellt, die sich mit der Entwicklung von Ganztagsschulen in Deutschland auseinandersetzt. Die Arbeit analysiert die Rolle der Ganztagsschule bei der Förderung und sozialen Integration von Kindern aus armutsgefährdeten Familien und untersucht die Ausweitung der pädagogischen Praxis sowie die Organisationsprozesse.
Schlüsselwörter
Kinderarmut, Bildungsungleichheit, Ganztagsschule, Chancen- und Bildungsgleichheit, empirische Forschung, StEG-Studie, soziale Integration, pädagogische Praxis, Organisationsprozesse, Lebenslagendimensionen, Bildungsaspirationen, Bildungsbeteiligungen, Bildungsabschlüsse, Lebenspläne, Lebenschancen.
- Arbeit zitieren
- Manuel Bober (Autor:in), 2020, Ganztagsschule und der Umgang mit Kinderarmut. Möglichkeiten und Herausforderungen anhand von Forschungsergebnissen, München, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/1290349