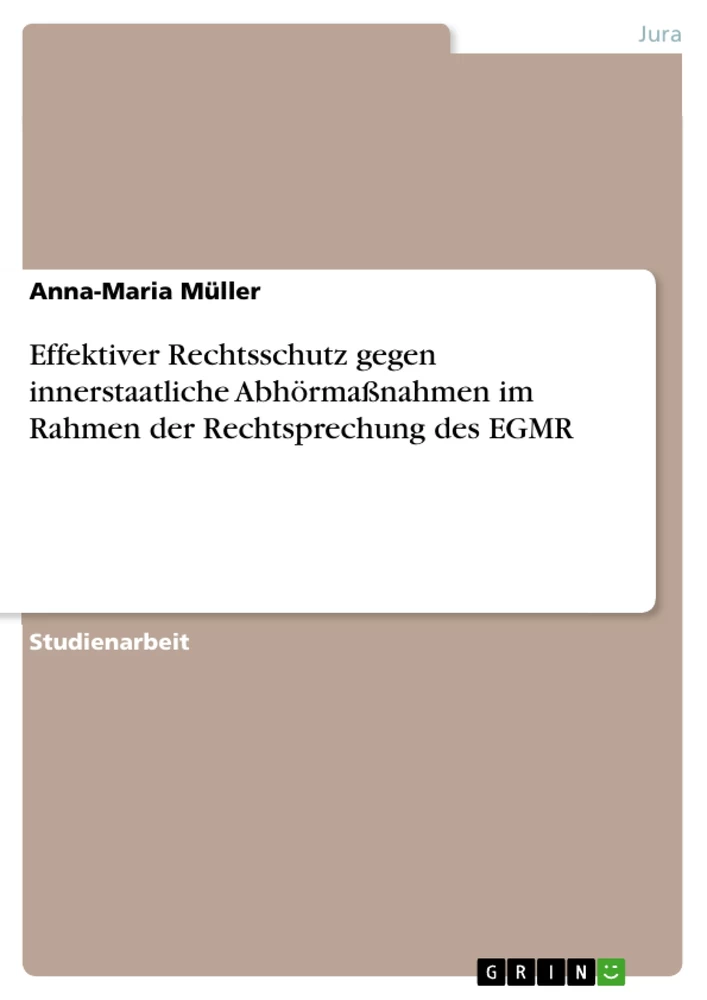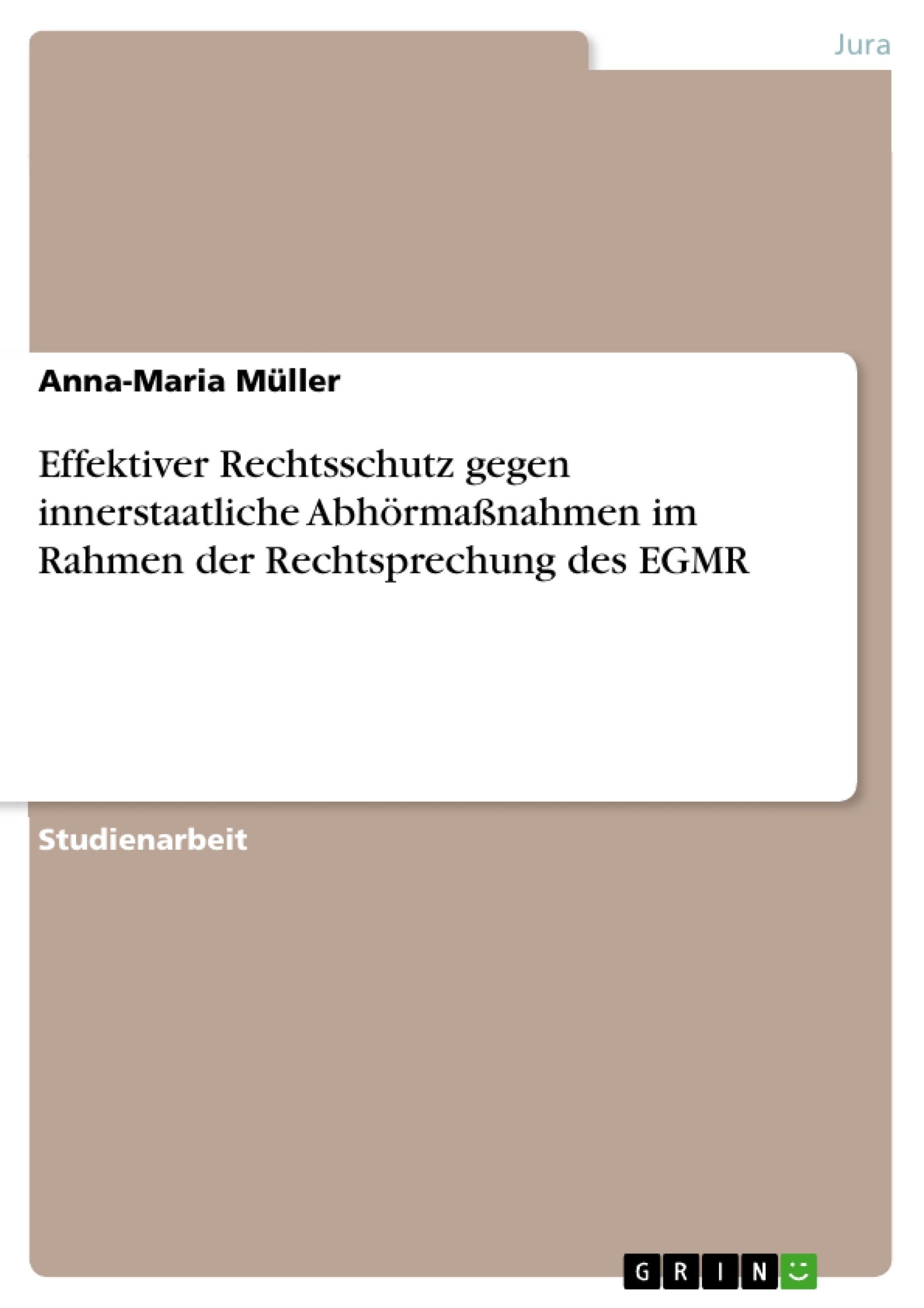In der vorliegenden Arbeit soll die Effektivität des Rechtsschutzes gegen innerstaatliche Abhörmaßnahmen im Rahmen der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte (EGMR) analysiert und exemplarisch an den bundesrepublikanischen Regelungen evaluiert werden.
Einführend werden rechtliche und operative Grundlagen zu innerstaatlichen Abhörmaßnahmen und dem Rechtsschutz dagegen dargestellt. Anschließend werden die auf der Konvention zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten (EMRK) beruhenden vom EGMR aufgestellten Anforderungen an Eingriffsgrundlagen und Rechtsschutz zusammenfasst. An diesen sollen beispielhaft die bundesrepublikanischen Regelungen und Praxen gemessen werden. Abschließend wird der Rechtsschutz auf unionsrechtlicher Ebene betrachtet und im Angesicht von Tendenzen der Privatisierung, Europäisierung und Internationalisierung die Frage gestellt werden, ob die menschenrechtlichen Standards gefährdet sind, unterlaufen zu werden. Konzentriert werden soll sich auf Strafverfahren, wobei Sonderstatusverhältnisse nicht thematisiert werden. Aufgrund der grammatikalischen Beschränkung auf Abhörmaßnahmen kann weder auf die Auslesung von Chats noch die Analyse und Auswertung offener Informationen wie auf Social-Media-Plattformen eingegangen werden.
Inhalt
LITERATURVERZEICHNIS
A. EINLEITUNG
B. OPERATIVE UND RECHTLICHE GRUNDLAGEN
I. Akteurünnen
1. Polizeien
2. Inlandsnachlichtendienste
3. Institutionen der Europäischen Union
II. Techniken
1. Telekommunikationsüberwachung
2. Akustische Überwachung
3. Abhören durch V-Personen und Verdeckte Ermittlerinnen
III. Der EGMR UND DIE EMRK
1. Die EMRK als völkerrechtlicher Vertrag und seine Wirkung
2. Das Verhältnis von EMRK und Grundrechtecharta
C. DIE MENSCHENRECHTLICHEN ANFORDERUNGEN AN DEN
RECHTSSCHUTZ BEI GEHEIMEN ABHÖRMASSNAHMEN NACH DEM EGMR
I. Zulässigkeit
II. Persönliche Berechtigung
III. Artikel 8EMRK
1. Sachlicher Gewährleistungsbereich
2. Eingriff
3. Rechtfertigung
a. Beschränkungsziel und Notwendigkeit
b. Gesetzliche Grundlage
IV. Artikel 6IEMRK
1. Allgemeines
2. Spezielle Rechtsprechung zu geheimen Abhörmaßnahmen
V. Artikel 13EMRK
D. RECHTSSCHUTZ IN DER BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND
I. Materieller Rechtsschutz: Rechtsgrundlagen für Abhörmassnahmen
1. Telekommunikationsüberwachung
a. Präventive TKÜ: § 66 SächsPVDG und § 3 G10
b. Repressive TKÜ: § 100 a StPO
2. Akustische Überwachung
a. Präventive akustische Überwachung: §§ 63 I Nr. 2, 65 SächsPVDG
b. Repressive akustische Überwachung: §§ 100 c, 100 f StPO
3. Abhören durch V-Personen und Verdeckte Ermittlerinnen
a. Präventiver Einsatz von VE und VP: § 64 SächsPVDG
b. Repressiver Einsatz von VE: § 110 a StPO
II. Formeller Rechtsschutz
1. Voraussetzung für formellen Rechtsschutz: Benachrichtigung
2. Vorbeugender Rechtsschutz durch den Richtervorbehalt
3. Gerichtlicher nachträglicher Rechtsschutz
a. Rechtsmittel bei präventiven und repressiven Maßnahmen
b. Außerordentlicher Rechtsbehelf: Verfassungsbeschwerde
4. Parlamentarischer nachträglicher Rechtsschutz
III. Zwischenfazit
E. RECHTSSCHUTZ AUF UNIONSRECHTLICHER EBENE
I. Europäische Architektur der Inneren Sicherheit
II. Anwendbarkeit des Unionsrechts bei Ermittlungsmassnahmen
III. Rechtsschutz
IV. Europol als europäischer Nachrichtendienst
F. UNTERLAUFEN DES RECHTSSCHUTZES DURCH (INFORMELLE)EUROPÄISIERUNG UND TRANSNATIONALISIERUNG
G. FAZIT
Literaturverzeichnis
Albrecht, Jan Philipp/Janson, Nils, Die Kontrolle des Europäischen Polizeiamtes durch das Europäische Parlament nach dem Vertrag von Lissabon und dem EuropolBeschluss, in: EuR 2012, 230;
Berner, Georg/Köhler, Gerd Michael, Handkommentar PAG, 19. Aufl., Heidelberg, München, Landsberg, Berlin 2008 (zitiert: Berner, Georg/Köhler, Gerd Michael, HK PAG, Heidelberg, München, Landsberg, Berlin 2008);
Berthélémy, Chloé/Lund, Jesper, Die neue Europol-Reform, in: CILIP 128, Berlin 2022, S. 24;
Bieker, Felix, Geheimdienste vor Gericht, in: Die Friedens-Warte Vol. 90 1/2, Berlin 2015, S. 33;
Böse, Martin, Die Europäische Staatsanwaltschaft „als“ nationale Strafverfolgungsbehörde, JZ 02/2017, S. 82;
Bruns, Michael, Karlsruher StPO-Kommentar, 8. Aufl., München 2019;
Chavez, Nicole, Arkansas judge drops murder charge in Amazon Echo case, 2017, abrufbar unter https://edition.cnn.com/2017/ll/30/us/amazon-echo-arkansas-murder- case-dismissed/index.html zuletzt aufgerufen am 20.4.2022;
Davoli, Alessandro, Europäisches Parlament: Polizeiliche Zusammenarbeit, 2021, abrufbar unter https://www.europarl.europa.eu/factsheets/de/sheet/156/polizeiliche-zu- sammenarbeit zuletzt aufgerufen am 19.4.2022;
Dörr, OUver/Grote, Rainer/Marauhn, Thilo u.a. (Hrsg.), Konkordanzkommentar zum europäischen und deutschen Grundrechtsschutz, 2. Aufl., Tübingen 2013 (zitiert: EMRK/GG/Bearbeiter:in);
Fanta, Alexander, EU-Polizeibehörde lässt offen, ob sie illegale Datensammlung löscht; abrufbar unter https://netzpolitik.org/2022/europol-eu-polizeibehoerde-laesst- offen-ob-sie-illegale-datensammlung-loescht zuletzt aufgerufen am 6.4.2022;
Frohwein, Jochen/Peukert, Wolfgang, EMRK-Kommentar, 3. Aufl., Kehl am Rhein 2009;
Fuchs, Christian/ Goetz, John/Obermaier, Frederik, Verfassungsschutz beliefert NSA, 2013, abrufbar unter https://www.sueddeutsche.de/politik/spionage-in-deutschland- verfassungsschutz-beliefert-nsa-1.1770672 zuletzt aufgerufen am 20.4.2022;
Gaede, Karsten, Münchner Kommentar zur StPO Band 3/2, 1. Aufl., München 2018 (zitiert: MüKoStPO/Bearbeiter.ün EMRK);
Grabenwarter, Christoph/Pabel, Katharina, Europäische Menschenrechtskonvention, 7. Aufl., München, Basel, Wien 2021 (zitiert: Grabenwarter/Pabel, EMRK);
Große Strafrechtskommission des Deutschen Richterbundes, Gutachten zum Thema: Das Verhältnis von Gericht, Staatsanwaltschaft und Polizei im Ermittlungsverfahren, strafprozessuale Regeln und faktische (Fehl-?)Entwicklungen, Im Auftrag des Bundesministeriums der Justiz, Berlin 2008, abrufbar unter https://krimpub.krimz.de/ frontdoor/deliver/index/docId/189/file/Gutachten_der_Gro%C3%9Fen_Strafrechts- kommission.pdf zuletzt aufgerufen am 28.4.2022;
Guder, Martin André, Die repressive Hörfalle im Lichte der EMRK, Diss., Berlin 2007;
Jones, Chris, Europäische Sicherheitsforschung, in: CILIP 115, Berlin 2018, S. 59;
Karpenstein, Ulrich/Mayer, Franz C. (Hrsg.), EMRK, Konvention zum Schutz der Menschenrechte und Grundfreiheiten; Kommentar, 3. Aufl., München 2022 (zitiert: Karpenstein/Mayer/Bearbeiter.ün, EMRK);
Klaushofer, Reinhard, Strukturmerkmale des Art. 13 EMRK, NLMR, Salzburg 2014;
König, Marco, Trennung und Zusammenarbeit von Polizei und Nachrichtendiensten, Diss., Berlin 2005;
Kral, Sebastian, Die polizeilichen Vorfeldbefugnisse als Herausforderung der Dogmatik und Gesetzgebung des Polizeirechts, Diss., Berlin 2012;
Krempl, Stefan, Chatkontrolle: Informatiker und IT-Verbände gegen EU-weite Massenüberwachung, abrufbar unter https://www.heise.de/news/Chatkontrolle-Informati- ker-und-IT-Verbaende-gegen-EU-weite-Massenueberwachung-6656545.html zuletzt aufgerufen am 30.03.2022;
Krüpe-Gescher, Christiane, Die Überwachung der Telekommunikation nach §§ 100a, 100b StPO in der Rechtspraxis, Diss., Freiburg i. Br. 2004 (zitiert: Krüpe-Gescher, Christiane, TKÜ n.§§ 100a, 100b StPO in der Rechtspraxis 2004);
Lisken, Hans/Denniger, Erhard, Handbuch des Polizeirechts, 7. Aufl., München 2021; Löffelmann, Markus, Rechtsfragen »legendierter Kontrollen« zum BGH Urteil v. 26.
4. 2017, Juristische Rundschau, 11/2017, S. 588;
Löwe, Ewald/Rosenberg, Werner/Huuck, StPO Kommentar, Berlin 2019;
Meyer-Ladewig, Jens/Nettesheim, Martin/von Raumer, Stefan, Handkommentar EMRK, 4. Aufl., Baden-Baden 2017 (zitert: Meyer-Ladewig/Nettesheim/von Raumer, HK EMRK, Baden-Baden 2017);
Meyer-Mews, Hans, Telekommunikationsüberwachung im Strafverfahren, Bremen 2019 (zitiert: Meyer-Mews, Hans, TKÜ im Strafverfahren, Bremen 2019);
Monroy, Matthias, Die Vergeheimdienstlichung der EU, in: CILIP 128, Berlin 2022;
Monroy, Matthias, Mehr parlamentarische Kontrolle für Europol: Geht das überhaupt?, 2016, abrufbar unter https://netzpolitik.org/2016/mehr-parlamentarische-kon- trolle-fuer-europol-geht-das-ueberhaupt/ zuletzt aufgerufen am 19.4.2022;
Möstle, Markus, Grundfragen Europäischer Polizeilicher Kooperation, in: Kugelmann, Dieter (Hrsg.), Migration, Datenübermittlung und Cybersicherheit, 1. Aufl., Baden-Baden 2016;
Neuling, Marleen, Klage gegen den Verfassungsschutz, in: CILIP 123, Berlin 2020, S. 88;
Paefgen, Franziska, Der von Art. 8 EMRK gewährleistete Schutz vor staatlichen Eingriffen in die Persönlichkeitsrechte im Internet, Diss., Berlin, Heidelberg 2017;
Peters, Almut, Die Europäische Staatsanwaltschaft - Eine Gefahr für den fair trialGrundsatz?, 2014, abrufbar unter https://verfassungsblog.de/europaeische-staatsan- waltschaft-gefahr-fuer-fair-trial-grundsatz/, zuletzt aufgerufen am 19.4.2022;
Pewestorf, Adrian/Söllner, Sebastian/Tölle, Oliver, Polizei-und Ordnungsrecht Kommentar, 2. Aufl., Köln 2017;
Poscher, Ralf/Kappler, Katrin, Staatstrojaner für Nachrichtendienste, 2021, abrufbar unter https://verfassungsblog.de/staatstrojaner-nachrichtendienste/, zuletzt aufgerufen am 05.04.2022;
Rat der EU, PM vom 06.06.2019, Rat beauftragt Kommission mit der Aushandlung internationaler Übereinkünfte über elektronische Beweismittel in Strafsachen, abrufbar unter: https://www.consilium.europa.eu/de/press/press-releases/2019/06/06/cou- nil-gives-mandate-to-commission-to-negotiate-international-agreements-on-e-evid- ence-in-criminal-matters/ zuletzt aufgerufen am 01.04.2022;
Roggan, Fredrik/Kutscha, Martin/Gercke, Handbuch zum Recht der inneren Sicherheit, 2. Aufl., Berlin 2006;
Ruschemeier, Hannah, Eingriffsintensivierung durch Technik, 2020, abrufbar unter https://verfassungsblog.de/eingriffsintensivierung-durch-technik/ zuletzt aufgerufen am 20.4.2022;
Schäfer, Heike, Präventive Telekommunikationsüberwachung, Diss., Freiburg i. Br. 2008 (zitiert: Schäfer, Heike, Präventive TKÜ, Freiburg i. Br. 2008);
Schmahl, Stefanie, Effektiver Rechtsschutz gegen Überwachungsmaßnahmen ausländischer Geheimdienste?, JZ 05/2014, S. 220;
Schoppa, Katrin, Europol im Verbund der Europäischen Sicherheitsagenturen, Diss., Berlin 2013, S. 220;
Tremmer, Moritz,"Das führt nur zu unnötigen Nachfragen", 2022, abrufbar unter htt- ps://www.golem.de/news/bka-das-fuehrt-nur-zu-unnoetigen-nachfragen-2201- 162285.html, zuletzt aufgerufen am 19.4.2022;
Unger, Christian, Überwachung von Alexa, Siri oder Google Home - Behörden fordern Befugnisse, 2019, abrufbar unter https://www.morgenpost.de/politik/artic- le226146985/Ueberwachung-von-Alexa-und-Co-Kommt-der-Lauschangriff-4-0.html zuletzt aufgerufen am 20.4.2022.
A. Einleitung
Das Gefühl einer ständig wachsenden Bedrohung durch Terrorismus und die sogenannte Organisierte Kriminalität ist allgegenwärtig. Dies führt auch auf europäischer Ebene immer wieder zu Forderungen nach neuen Technologien, Ressourcen und Befugnissen für die Sicherheitsbehörden, um an Informationen zur Gefahrenabwehr und Strafverfolgung zu gelangen. Die Möglichkeit sensible Daten zu erheben ist aufgrund technischer Fortschritte enorm gewachsen. Gerade das Abhören von Gesprächen kann viele für die Ermittlungen relevante Informationen liefern. Die Maßnahmen haben allerdings eine große Streubreite, was eine demokratische und unabhängige Kontrolle umso wichtiger macht. In der vorliegenden Arbeit soll die Effektivität des Rechtsschutzes gegen innerstaatliche Abhörmaßnahmen im Rahmen der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte (EGMR) analysiert und exemplarisch an den bundesrepublikanischen Regelungen evaluiert werden.
Einführend werden rechtliche und operative Grundlagen zu innerstaatlichen Abhörmaßnahmen und dem Rechtsschutz dagegen dargestellt (B.). Anschließend werden die auf der Konvention zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten (EMRK) beruhenden vom EGMR aufgestellten Anforderungen an Eingriffsgrundlagen und Rechtsschutz zusammenfasst (C.). An diesen sollen beispielhaft die bundesrepublikanischen Regelungen und Praxen gemessen werden (D.). Abschließend wird der Rechtsschutz auf unionsrechtlicher Ebene betrachtet (E.) und im Angesicht von Tendenzen der Privatisierung, Europäisierung und Internationalisierung die Frage gestellt werden, ob die menschenrechtlichen Standards gefährdet sind, unterlaufen zu werden (F.). Konzentriert werden soll sich auf Strafverfahren, wobei Sonderstatusverhältnisse nicht thematisiert werden. Aufgrund der grammatikalischen Beschränkung auf Abhörmaßnahmen kann weder auf die Auslesung von Chats1 noch die Analyse und Auswertung offener Informationen wie auf social-media-Plattformen eingegangen werden.
B. Operative und rechtliche Grundlagen
I. Akteur:innen
Zur Abschichtung der komplexen Materie, sollen zunächst die für die vorliegende Arbeit relevanten Akteurünnen vorgestellt werden. Dabei wird sich zunächst auf „primäre“ Akteurünnen, also staatliche Institutionen, bezogen. „Sekundäre“ Akteurünnen, also Private, derer sich Polizeien oder Nachrichtendienste bedienen, werden bei den Techniken betrachtet.
1. Polizeien
Die Organisation der Polizeien ist in den Mitgliedsstaaten des Europarats sehr unterschiedlich ausgeprägt. Diese können, wie in Deutschland, föderal strukturiert sein oder zentralisiert wie in Frankreich. Gemeinsam ist ihnen jedoch die doppelte Aufgabenzuweisung der Gefahrenabwehr und Strafverfolgung. Die Ausdifferenziertheit und Komplexität der Polizeiorganisationen erfordern eine Simplifizierung: wenn folgend von Polizei gesprochen wird, sind damit diejenigen Einheiten gemeint, die in einem entsprechenden Phänomenbereich agierend die technischen, personellen und finanziellen Ressourcen haben und damit für die zu untersuchenden Abhörmaßnahmen relevant sind.
2. Inlandsnachrichtendienste
Ähnliches lässt sich auch über die Inlandsnachrichtendienste der Konventionsstaaten feststellen. Auch hier ist eine Verallgemeinerung der verschiedenen Inlandsnachrichtendienste mit unterschiedlichen Aufgabenbereichen teilweise auch in einem Land, unerlässlich, um eine sinnvolle Darstellung vornehmen zu können. Die in Rede stehenden Organisationen vereint die Zielrichtung, die Innere Sicherheit durch Informationsbeschaffung mit nachrichtendienstlichen Mitteln zu gewährleisten und dabei keine unmittelbaren Zwangsbefugnisse anzuwenden. Letzteres unterscheidet sie von der Polizei.2 Der Unterschied zu Auslandsnachrichtendiensten besteht darin, dass diese die äußere Sicherheit, wie z.B. die Bewahrung der territorialen Integrität des Staates schützen.3
3. Institutionen der Europäischen Union
Nicht zu vernachlässigen sind außerdem die Europäischen Institutionen, wobei sich hier auf die für die vorliegende Materie relevante Europäische Staatsanwaltschaft (EuStA) und Europol beschränkt werden soll. Die EuStA soll grenzübergreifende Großkriminalität zulasten des EU-Haushalts basierend auf Art. 86 AEUV und VO (EU) 2017/1939 bekämpfen, wobei das nationale Recht die zulässigen Ermittlungsmaßnahmen festlegt.4 Europol, das Europäische Polizeiamt, hat weder Zwangsbefugnisse noch eigene Ermittlungskapazitäten, doch ist es, auch aufgrund der geplanten Reform,5 die ihr quasi-operative Befugnisse verleihen soll, wichtige Akteurin, wenn es um die Verarbeitung personenbezogener Daten geht. Die Aufgabe von Europol ist die Gewährleistung des Informationsaustausches zwischen den nationalen Polizeibehörden im Wesentlichen im Bereich der grenzüberschreitenden sog. Organisierten Kriminalität und Terrorismus, sowie die Koordinierung von betreffenden Ermittlungen gern. Art. 88 I AEUV und 18 ff. VO (EU) 2016/794 (Europol-VO).
II. Techniken
Abhörmaßnahmen können mit unterschiedlichen Mitteln vorgenommen werden. Folgend sollen drei am häufigsten genutzte Techniken vorgestellt werden, zu denen der EGMR bereits geurteilt hat.
1. Telekommunikationsüberwachung
Telekommunikationsüberwachung (TKÜ) umfasst Verkehrsdaten, Verbindungsdaten und Inhaltsdaten, wobei Letztere unabhängig von ihrer Form erfasst sind, also Videos, Bilder, Mails, Chats und Telefonate darunter verstanden werden.6 In der vorliegenden Arbeit wird der Begriff des Abhörens streng grammatikalisch nur auf das Mithören und Auswerten des gesprochenen Wortes, in der Regel auch nur in Echtzeit, verstanden. Daher wird nicht auf die sog. erweiterte Quellen-TKÜ7 eingegangen, bei der Nachrichtendienste (anders als bei der konventionellen Quellen-TKÜ) nicht nur auf laufende Kommunikation, sondern auch auf ruhende Kommunikation, wie gespeicherte Chats und Textnachrichten zugreifen dürfen. Diese entspricht daher eher einer Online-Durchsuchung als der klassischen TKÜ.8 TKÜ kann durch die staatlichen Akteurün- nen selbst, oder durch Zugriff auf Gespeichertes bei Privaten, denen diese Daten freiwillig, beispielsweise durch die Nutzung einer Kommunikationsapp von den Nutzerünnen überlassen wurden, vorgenommen werden.9
2. Akustische Überwachung
Bei der konventionellen akustischen Überwachung werden Mikrophone und Aufnahmegeräte, sog. Wanzen, in Räumen angebracht. Unterschieden werden muss aufgrund der unterschiedlichen in Betracht kommenden Menschenrechte zwischen Überwachung außerhalb und innerhalb von Wohnraum. Internetbasierte akustische Überwachung wird vor allem aufgrund der zunehmenden Nutzung des Internet of Things immer interessanter, sofern die smarten Gegenstände eingebaute Mikrofone haben, wie das bei zahlreichen Multimediageräten wie Smartphones, Tablets, Spielzeugen und Alltagsgegenständen der Fall ist. Folgende Möglichkeiten kommen in Betracht: die Verpflichtung der Herstellerinnen, dauerhaft Gespräche aufzuzeichnen oder eine integrierte Backdoor zur Aktivierung des Mikrofons einzurichten, der elektronische oder physische Zugriff auf das Netzwerk durch das Einschleusen einer Überwachungssoftware zur Aktivierung des Mikrofons, sowie den Zugriff auf Gespeichertes bei den Unternehmen.10 Diese sind bisher in den Konventionsstaaten des Europarats, soweit überblickbar und öffentlich bekannt, nicht eingeführt worden und werden deswegen nicht vertieft. Notwendig ist die Vergegenwärtigung jedoch, da Aufnahmen von diesen bereits in Strafprozessen in den USA eingeführt wurden11 und der Rat der EU die Kommission mit der Aushandlung einer Übereinkunft über elektronische Beweismittel mit den USA beauftragt hat, was ermöglichen würde private Diensteanbieterünnen zur Herausgabe von in beispielsweise Clouds gespeicherten Inhalten, auch Sprachaufzeichnungen der Smart Things, zu verpflichten. Auch der Europarat ermächtigte die Kommission zur Verhandlung des Zweiten Zusatzprotokolls zum Budapester Übereinkommen über Computerkriminalität mit den gleichen Möglichkeiten.12
3. Abhören durch V-Personen und Verdeckte Ermittler:innen
Ein Abhören durch V-Personen (VP) ist das staatlich beauftragte Ausforschen durch persönlich Bekannte oder Private mit Zugang zu einem bestimmten Milieu, die unbekannterweise längerfristig mit Behörden kooperieren. Verdeckte Ermittlerünnen (VE) sind Polizistünnen oder Beamtinnen der Geheimdienste, die unter Tarnidentität gezielt mit den Auszuforschenden zur Informationsgewinnung interagieren.13 Manchmal wird auch eine Hörfalle gestellt, was das heimliche Mithören von (Telefon)gesprächen mit Privaten bezeichnet, welche zur Aufklärung von (geplanten) Straftaten von Behörden initiiertet wurden.14
III. Der EGMR und die EMRK
1. Die EMRK als völkerrechtlicher Vertrag und seine Wirkung
Der Europarat wurde im Jahr 1949 als Antwort auf die systematischen Menschenrechtsverletzungen des Nationalsozialismus begründet.15 Von ihm wurde die EMRK, welche am 3.9.1953 in Kraft trat, als regionales Menschenrechtsinstitut in Form eines multilateralen völkerrechtlichen Vertrages, der Individualrechtspositionen begründet, verabschiedet.16 Nach Art. 46 EMRK17 sind die Vertragsstaaten verpflichtet, das endgültige Urteil des Gerichtshofs zu befolgen. Der Staat ist bei einer Verurteilung verpflichtet, die Konventionsverletzung abzustellen und Ersatz für die Folgen zu leisten. Die Urteile des EGMR haben im Wesentlichen Feststellungscharakter, doch gibt es eine Anordnungskompetenz für Entschädigungen gern. Art. 41. Grundsätzlich wirken die Urteile völkerrechtsverpflichtend nur inter partes mit formeller und materieller Rechtskraft gern. Art. 42 und 44, was aber mittlerweile durch die Etablierung von Pilotverfahren gelockert wurde.18 Hier benennt der EGMR anhand eines Musterfalles strukturelle Probleme im Mitgliedsstaat zur Unterstützung bei der Erfüllung der Pflichten aus der EMRK und ordnet gern. Art. 61 III EGMRVerfO konkrete Abhilfemaßnahmen an.19 Doch auch unabhängig davon haben die Urteile eine faktische Präzedenzwirkung, da der EGMR gern. Art. 32 I die EMRK verbindlich auslegt und konkretisiert.20 Dabei nimmt er grundsätzlich nur eine Willkürkontrolle vor, außer es handelt sich um sensibelste Bereiche der Menschenrechte oder offensichtliche Fehler bei den nationalen Gerichten.21 Werden die Urteile nicht umgesetzt, gibt es gern. Art. 46 IV, V mit einer entsprechenden Feststellung die Möglichkeit durch politischen Druck dazu anzuhalten.22
2. Das Verhältnis von EMRK und Grundrechtecharta
Inhaltlich sind die Grundrechtecharta (GrCh) der Europäischen Union (EU) und die EMRK durch den Art. 52 III GrCh verschränkt, der die Mindestschutzgarantie und Günstigkeitsklausel festschreibt, sowie den Art. 6 III EUV, der die EMRK als allgemeine Rechtsgrundsätze zu den Rechts(erkenntnis)quellen des Unionsrecht zählt.23 Daraus folgt, dass auch die unionsrechtlichen Regelungen und die Praxen der EU an den vom EGMR aufgestellten Grundsätzen zu messen sind.24 Der EGMR nimmt seine Kontrolle gegenüber dem EuGH weitestgehend zurück, da er den Grundsatz der Vermutung des gleichwertigen Grundrechtsschutzes zugrunde legt.25
C. Die menschenrechtlichen Anforderungen an den Rechtsschutz bei geheimen Abhörmaßnahmen nach dem EGMR
Nach einer kurzen Darstellung der Zulässigkeit von Individualbeschwerden werden die Anforderungen an Rechtsschutz und die Konventionsgemäßheit von geheimen Überwachungsmaßnahmen besprochen, wobei insbesondere die vornehmlich geprüften Art. 6, 8 und 13 in den Blick genommen werden.
I. Zulässigkeit
Gern. Art. 34 kann der Gerichtshof angerufen werden, wenn behauptet wird, durch staatliche Gewalt eines Konventionsstaates in einem Konventionsrecht verletzt zu sein. Die Beschwerde darf nicht anonym bleiben, nicht nur unerheblich benachteiligend oder missbräuchlich sein, sowie nicht schon einmal dem EGMR oder einer anderen internationalen Untersuchungs- oder Vergleichsinstanz unterbreitet worden sein, Art. 35 II, III. Gern. Art. 35 I muss der innerstaatliche Rechtsweg erschöpft und die Fristvon sechs Monaten gewahrt sein.
Ohne eine konkrete eigene Betroffenheit durch Abhörmaßnahmen nachweisen zu müssen, ist eine Gesetzeskontrolle ausnahmsweise möglich. Zur Vermeidung praktischer Unanfechtbarkeit durch fehlende Benachrichtigung bzw. Zugang zu Dokumenten, wurden vom EGMR Voraussetzungen26 für das Vorliegen der Opfereigenschaft entwickelt, um den spezifischen Rechtsschutzbedürfnissen bei geheimen Überwachungsmaßnahmen gerecht zu werden. Besteht kein vergleichbarer abstrakter Rechtsschutz auf nationaler Ebene, der vom EGMR grundsätzlich nicht zur Wahrung des Art. 13 gefordert wird,27 intensiviert der EGMR seine Kontrolle.28 Dies hat auch zur Folge, dass die Beschwerde nicht wegen fehlender Erschöpfung des innerstaatlichen Instanzenzugs gern. Art. 35 IV zurückgewiesen werden kann.29 Somit muss nur die Möglichkeit der Zugehörigkeit zu einer potentiell betroffenen Personengruppe, die einer „emstzunehmende[n] Gefahr einer geheimen Überwachung unterworfen zu werden“30 ausgesetzt ist, geltend gemacht werden. So wurde beispielsweise eine potentielle Betroffenheit wegen des Engagements gegen Justizirrtümer als ausreichend plausibel dargelegt angesehen.31 Mit der Entbehrlichkeit des Nachweises eines konkreten Betroffenheit hat der EGMR eine Art Normenkontrolle für geheime Überwachungsmaßnahmen etabliert.32
II. Persönliche Berechtigung
Durch die individualschützende EMRK sind alle Menschen berechtigt. Neben der vordergründigen Geltung für natürliche Personen wird jedenfalls für Art. 8, mit Ausnahme des Familienschutzes und Recht auf Eheschließung, auch eine Berechtigung fürjuristische Personen angenommen.33
III. Artikel 8 EMRK
1. Sachlicher Gewährleistungsbereich
Der Art. 8 schützt die freie Entwicklung der Persönlichkeit und die äußere Beziehung zu anderen Menschen, sofern dabei eine gewisse Nähe zur Verwirklichung der Persönlichkeit besteht.34 Folgend werden Eingriffe in die Gewährleistungsbereiche Privatsphäre, Wohnung und Korrespondenz bei geheimen Abhörmaßnahmen untersucht und gefragt, welche Garantien erfüllt sein müssen, um diese zu rechtfertigen.
Der Schutz des Privatlebens beinhaltet den Schutz vor staatlicher Beobachtung, Überwachung und Ausforschung, insbesondere bezüglich der individuellen Kommunikation, auch in der Wohnung und dem geschäftlichen Umfeld.35 Der EGMR entwickelte zur Abgrenzung den „reasonable expectation of priva- cy“-Test,36 der den Schutzbereich dort als eröffnet ansieht, wo eine Person davon ausgehen darf, nicht überwacht zu werden.37 Tonbandaufnahmen, die den Inhalt von Gesprächen, sowie den Klang der Stimme wiedergeben können, greifen immer in die Privatsphäre ein. Allerdings wird dies auf permanente und systematische Aufzeichnungen von Informationen begrenzt.38 Der Einsatz von VE und VP wird nicht als Eingriff in die Privatsphäre gewertet, wenn die geführten Gespräche sich nur um (vermeintliche) Straftaten drehen, deren gezielte Aufklärung bezweckt wird.39 Dies tangiert vordergründig die öffentliche Sphäre und Privatsphäre derer, die durch die (vermeintlichen) Straftaten geschädigt wurden, für deren Schutz eine positive Verpflichtung besteht. Auch ein Datenschutzrecht wird aus Art. 8 abgeleitet, welches den Schutz vor Datenerhebung, -Speicherung und -Verwertung beinhaltet.40 Gewährleistet ist auch der Schutz vor Datenmissbrauch in Anlehnung an Art. 7 Datenschutzkonvention des Europarats,41 welcher Sicherungsmaßnahmen gegen die zufällige oder unbefugte Zerstörung, gegen zufälligen Verlust sowie unbefugten Zugang, unbefugte Veränderung oder unbefugtes Bekanntgeben verlangt.42 Der Schutz der Wohnung soll der räumlich-gegenständlichen Privatsphäre dienen.43 Davon werden die Geschehnisse erfasst, die aufgrund der räumlichen Abgrenzung der natürlichen Wahrnehmung anderer entzogen sind.44 Eingriffe in den Wohnungsschutz sollen nur solche sein, die sich unmittelbar auf deren Nutzung auswirken.45 Bei Abhörmaßnahmen in Wohnungen ist das jedenfalls beim Eindringen ohne Erlaubnis der Berechtigten zur Installation von Abhörtechnik gegeben.46 Das Abhören von Gesprächen in einer Wohnung stellt als nicht-körperliche Nutzungsbeeinträchtigung einen Eingriff dar.47 Als Korrespondenz werden nicht-öffentli- ehe und damit vertrauliche Mitteilungen an andere verstanden.48 Erfasst sind ebenfalls Gespräche, die nach Abschluss der Kommunikation gespeichert sind,49 sowie die Verbindungsdaten (metering').50
2. Eingriff
Bereits das Risiko des Abhörens stellt eine Einschränkung der Kommunikationsfreiheit dar,51 sodass ein Eingriff schon durch die gesetzliche Möglichkeit oder eine entsprechende Praxis geheimer Abhörmaßnahmen, sowie eine gewisse Wahrscheinlichkeit davon betroffen zu sein, vorliegt.52 Damit soll vermieden werden, dass wegen Unfeststellbarkeit der tatsächlichen Überwachung die geheimen Maßnahmen unanfechtbar bleiben.53 Die Eingriffsintensität wird durch eine Qualifikation von Daten als sensible Daten i.S.d. Art. 6 der Datenschutzkonvention gesteigert.54 Auch die Verwendung der Telekommunikationsdaten durch andere Behörden, die Vernichtung der Daten und eine unterlassene Mitteilung trotz Benachrichtigungspflicht sind Eingriffe in Art. 8.55 Auch eine freiwillige Weitergabe von Verbindungsdaten (a minori ad maius auch Inhalt der Nachricht56 ) durch den Telekommunikationsanbieter auf Nachfrage der Behörden ist als Eingriff zu werten.57 Damit sich der Staat seiner menschenrechtlichen Verpflichtung nicht entziehen kann, muss bei der Hörfalle das Handeln der Privaten den Behörden zugerechnet werden. Dies ist der Fall, wenn die Beamt:in in Erfüllung der Dienstpflicht am Vorhaben entscheidend beteiligt war, z.B. wegen der Bereitstellung von Technik58 oder Beratung.59
Aus dem Datenschutzrecht ergibt sich ein Recht auf Einsicht in die erhobenen personenbezogenen Daten, jedoch ist eine Weigerung der Herausgabe nicht immer zwingend ein Eingriff in Art. 8, da dieses nicht uneingeschränkt gilt.60
3. Rechtfertigung
Ein Eingriff kann gern. Art. 8 II gerechtfertigt werden, wenn die Maßnahme für das Erreichen eines der aufgezählten Beschränkungsziele notwendig ist und auf einer gesetzlichen Grundlage beruht.
a. Beschränkungsziel und Notwendigkeit
Die Aufzählung der Beschränkungsziele in Art. 8 II (nationale oder öffentliche Sicherheit, für das wirtschaftliche Wohl des Landes, zur Aufrechterhaltung der Ordnung, zur Verhütung von Straftaten, zum Schutz der Gesundheit oder der Moral oder zum Schutz der Rechte und Freiheiten anderer) ist abschließend, die Ziele werden jedoch weit ausgelegt.61 Der EGMR betont, dass auch bei einer gegenwärtigen Bedrohungslage im Namen des Kampfes gegen Spionage und Terrorismus nicht jedes Mittel recht sei,62 gibt den Vertragsstaaten aber trotzdem einen großen Ermessensspielraum, um Massenabhörregelungen einzuführen.63 Vage formulierte Überwachungsmaßnahmen zur Bekämpfung von Terrorismus, die oft genug auch zur politischen Verfolgung missbraucht werden, verletzen Art. 8.64 Strafverfolgung ist keine Verhütung von Straftaten i.S.d. Art. 8 II, kann aber unter die Aufrechterhaltung öffentlicher Ordnung subsumiert werden.65 Darüber hinaus muss die Notwendigkeit für den Eingriff in einer demokratischen Gesellschaft bestehen, womit ein dringendes soziales Bedürfnis gemeint ist.66 Der EGMR prüft das Beschränkungsziel und die Notwendigkeit meist innerhalb der Qualität der gesetzlichen Grundlage.
b. Gesetzliche Grundlag
Die Maßnahme muss eine Grundlage im nationalen Recht haben, die bestimmte inhaltliche Anforderungen erfüllt, insbesondere muss sie mit den Grundsätzen der Rechtsstaatlichkeit übereinstimmen.67 Bei geheimen Überwachungsmaßnahmen müssen neben diesen allgemeinen auch besondere Mindestgarantien gewährleistet sein, um einen Eingriff in Art. 8 rechtfertigen zu können.
aa. allgemeine Anforderungen an Gesetze i.S.d. Art. 8 II
Das Gesetz i.S.d. Art. 8 II muss ein materielles Gesetz sein. Damit sind auch Weisungen und andere administrative Übungen, Richterrecht und internationales Recht, sofern im betroffenen Mitgliedstaat unmittelbar anwendbar, erfasst.68 Es muss hinreichend klar, bestimmt, zugänglich und mit Ermessensbegrenzung durch klare Festlegung der Ausübungsmodalitäten und Reichweite der Ermächtigung versehen sein.69 Der EGMR gewährt den Konventionsstaaten eine margin ofappredation bei der Abwägung der oftmals bemühten nationalen Sicherheit und dem Privatsphäreschutz, solange wirksame Garantien gegen Missbrauch bestehen.70 An der Bestimmtheit mangelt es, wenn die Regelung wenig durchschaubar und Gegenstand divergierender Auslegung ist.71
bb. Mindestgarantien für geheime Überwachungsmaßnahmen
Es kann ein Rechtsprechungswandel gesehen werden, indem der EGMR zunehmend spezifische Anforderungen an das nationale Recht formuliert und sich nicht mehr auf eine ex-post-Kontrolle der nationalen Abwägungsentscheidung beschränkt.72 Der EGMR hat „folgende Mindestgarantien entwickelt, die zur Vermeidung von Machtmissbrauch in den gesetzlichen Regelungen enthalten sein sollten: Die Art der Straftaten, die eine Überwachungsanordnung rechtfertigen können; eine Beschreibung der Personengruppen, bei denen Telefongespräche abgehört werden können; die Begrenzung der Dauer der Abhörmaßnahme; das Verfahren für die Auswertung, Verwendung und Speicherung der erlangten Daten; die bei der Übermittlung der Daten an andere Parteien zu beachtenden Vorsichtsmaßnahmen und die Umstände, unter denen die Aufzeichnungen gelöscht und die Bänder vernichtet werden müssen oder dürfen.“73
Folgende weitere Kriterien stellt der Gerichtshof auf und prüft diese teilweise durch Überschriften strukturiert:74 das innerstaatliche Recht muss der Öffentlichkeit zugänglich und rechtsverbindlich sein,75 der Umfang der Anwendung geheimer Überwachungsmaßnahmen muss präzise benannt werden.76 Die oft genutzten Begriffe der nationalen Sicherheit und schwere Verbrechen sind an sich bestimmt genug.77 Doch ist ein beinahe uneingeschränktes Ermessen der Behörde bei Feststellung einer Bedrohung der nationalen Sicherheit und anderer Schutzgüter zu missbrauchsanfällig.78 Hinsichtlich der Kommunikation zwischen Anwältünnen und Mandantinnen muss das Gesetz klare Schutzmechanismen vorsehen, damit diese nicht Gegenstand einer Überwachung werden.79 Die Dauer der geheimer Überwachungsmaßnahmen muss gesetzlich festgelegt sein, ebenso wie das einzuhaltende Verfahren bei Speicherung, Prüfung, Verwendung, Weitergabe und Vernichtung abgehörter Daten sowie bei Zugang zu diesen.80 Das geheime Abhören ist ein so starker Eingriff in die Privatsphäre, dass der Gerichtshof einen vorgeschalteten Rechtsschutz in Form einer Genehmigung durch eine Stelle fordert, die auch die Befugnis besitzt, den Überwachungsantrag zurückzuweisen.81 Diese Stelle soll unabhängig von der Exekutive und Legislative sowie unparteiisch sein.82 Die Kontrollinstanz soll Zugang zu Materialien aus den geheimen Ermittlungsmaßnahmen haben, damit geprüft werden kann, ob ein hinreichender Tatverdacht besteht.83 Darüber hinaus wird eine Aufsicht über die Umsetzung geheimer Überwachungsmaßnahmen gefordert, wobei auch eine parlamentarische Kontrolle ausreichen kann. Diese soll weisungsunabhängig von der Exekutive sein und ausreichende Ressourcen und Befugnisse zur Kontrolle besitzen.84 Dies impliziert auch die Notwendigkeit der Protokollierung von Abhörvorgängen zur nachträglichen Überprüfung.85
Eine fehlende Benachrichtigung nach der Maßnahme führt zur faktischen Unmöglichkeit der Nachprüfung, sodass der EGMR in die Konvention ein implizit enthaltenes Recht liest „über jede geheime, von den öffentlichen Behörden getroffene Maßnahme informiert zu werden, die einen Eingriff in seine garantierten Rechte und Freiheiten bedeuten.“86 Eine Nachprüfung wäre sonst ausschließlich bei Einleitung von Strafverfahren inzident möglich.87
IV. Artikel 6 I EMRK
1. Allgemeines
Art. 6 I zielt auf die Gewährleistung elementarer Mindestgarantien in der nationalstaatlichen Verfahrenspraxis und soll die materiellen Konventionsrechte absichern.88 Der Gerichtshof bleibt in den Urteilen bei einer kasuistischen Einzelfallbetrachtung, was spezifische nationale Kompensationsmechanismen ermöglicht.89 So wird manchmal das Verfahren in einer Gesamtabwägung trotz der Feststellung einer Verletzung eines Teilrechts des Art. 6 I als fair betrachtet.90
Fraglich ist, ob Art. 6 I schon im Ermittlungsverfahren zu beachten ist, da dieser an eine strafrechtliche Anklage anknüpft. Zur Gewährleistung effektiver Verteidigung legt der EGMR einen materiellen Anklagebegriff zugrunde.91 Solange aber keine Unterrichtung über den Vorwurf stattfand, gibt es bei heimlichen Maßnahmen auch kein Bedürfnis für eine Verteidigung, da es am Inkulpa- tionsakt mit intendierter Außenwirkung fehlt.92 Nichtsdestotrotz müssen die Verfahrensgarantien schon im Ermittlungsverfahren beachtet werden, insbesondere, wenn sie die Grundlage für nicht korrigierbare Nachteile in der späteren Hauptverhandlung bilden.93 Umgehen Behörden bewusst Schutzvorschriften im Ermittlungsverfahren, ist Art. 6 I unstrittig anwendbar.94 Für den Bereich der Gefahrenabwehr gilt der Fair-Trial-Grundsatz mangels Anklage nicht direkt, jedoch können einzelne Garantien über die Rechtsstaatsverpflichtung aus der Präambel entsprechend übertragen werden.95 Bei legendlerten Kontrollen,96 bei denen die Polizei eigentlich repressiv handelt, aber dies ermittlungstaktisch geheimhalten will und sich daher ins voraussetzungsärmere Polizeirecht flüchtet, muss der Art. 6 I wegen des materiellen Anklagebegriffs Anwendung finden.
Gern. Art. 19 hat der EGMR die Pflicht zur Überwachung der Einhaltung Konventionsgarantien und trifft daher keine Entscheidung über die Zulässigkeit einzelner Beweismittel. Ihm obliegt nicht die Beurteilung fehlerhafter Rechtsanwendung des nationalen Rechts, soweit dies nicht gleichzeitig einen Konventionsverstoß darstellt.97 So wird das Verfahren als Ganzes als fair eingestuft, wenn trotz der Verwertung rechtswidrig erlangter Beweise die Verteidigungsrechte gewahrt und keine willkürliche Beurteilung der Beweise oder eine Tatprovokation vorgenommen wurden.98 Dementsprechend wird der Grundsatz der Waffengleichheit nicht verletzt, wenn trotz der Verwertung von Ergebnissen konventionswidriger Abhörmaßnahmen eine effektive Möglichkeit zur Stellungnahme und Konfrontation dagegen bestanden hat.99
2. Spezielle Rechtsprechung zu geheimen Abhörmaßnahmen
Bei der Verwertung von Aussagen von VP für Informationen, deren Erlangung in einer Vernehmung nicht möglich gewesen wäre, stellt sich die Frage, ob das Schweigerecht, als elementares Strukturprinzip rechtsstaatlicher Strafverfahren,100 umgangen wurde, wenn diese zur alleinigen Urteilsgrundlage gemacht wurden.101 Der Nemo-Tenetur-Grundsatz soll Zwangsmethoden zur Gewinnung von Beweismitteln verhindern, was nicht nur bei unmittelbarem Zwang gilt, sondern auch bei Täuschungen, die den Willen der Betroffenen missachten, obwohl sie sich konsequent auf ihr Schweigerecht berufen haben.102 Der Schutz der Selbstbelastungsfreiheit gilt jedoch nicht erst durch die tatsächliche Ausübung des Schweigerechts.103 Im Fall Allan gegen das Vereinigte Königreich104 entwickelte der EGMR Voraussetzungen für die Unzulässigkeit der Aussageverwertung: zunächst müsste das Handeln von Privaten dem Staat zugerechnet werden, was bei Beauftragung, Betreuung und/oder Instruierung bejaht werden kann. Weiter muss die Information dem Beschuldigten entlockt (elicited) worden sein. Dies ist der Fall, wenn das Gespräch das funktionale Äquivalent zu einer Vernehmung darstellt, indem eine Drucksituation und eine gezielte Lenkung des Gesprächs auf den Tatvorwurf vorliegen.105 Zusätzlich muss ein bestandenes Vertrauen ausgenutzt worden sein, z.B. indem gefühlsmäßige Bindungen instrumentalisiert wurden.106 Damit wäre die Waffengleichheit als zentrale Teilgarantie des Art. 6 I nicht mehr gewahrt.107
Den rechtsstaatlichen Mindestanforderungen genügt es beim Einsatz von VE, wenn es ein geregeltes und abstrakt vorhersehbares Verfahren gibt und die Authentizität der Aussagen der VE nachvollziehbar und nachprüfbar sind.108 Eine Verletzung von Art. 6 I scheidet bei Gesprächen bezüglich konkreter Straftaten mit VE aus, da man im kriminellen Milieu mit Spitzeln zu rechnen habe.109 Keine Anwendung findet der Nemo-Tenetur-Grundsatz beim Abhören nur zum Erhalt einer Stimmprobe, weil die Stimme an sich keine belastende Erklärung enthält und objektiv untersucht werden kann.110 Des Weiteren liegt keine Verletzung des Art. 6 I vor, wenn bei der Überprüfung von geheimen Überwachungsmaßnahmen nicht-öffentlich verhandelt wird, da dadurch legitimes Staatsinteressen gewahrt werden sollen.111
V. Artikel 13 EMRK
Eine wirksame Beschwerde i.S.v. Art. 13 muss der zuständigen nationalen Instanz erlauben, sich mit dem wesentlichen Inhalt der behaupteten Menschenrechtsverletzung zu beschäftigen und angemessene Abhilfe zur Verfügung zu stellen.112 Entscheidend ist daher die Zugänglichkeit zu den Rechtsbehelfen sowie die Verbindlichkeit und praktische Umsetzung von Entscheidungen. Die kontrollierende Instanz benötigt eine gewisse Unabhängigkeit vom beschuldigten Rechtsträger.113 Um eine Verletzung festzustellen, ist ein vertretbarer Vortrag der Verletzung eines anderen Konventionsrechts notwendig. Wenn dies bereits verneint wurde, dann gilt der Teil der Beschwerde als offensichtlich unbegründet i.S.d. Art. 35 III.114 Art. 13 enthält institutionelle und prozessuale Garantien und geht damit über eine einfache Akzessorietät hinaus.115 Zudem kommt Art. 13 eine Ersatzfunktion für verfassungsrechtlich legitimierte Eingriffe wegen des verengten Prüfungsmaßstabes zu.116 Auf die gesonderte Prüfung des Art. 13 verzichtet der EGMR regelmäßig,117 da die Anforderungen an innerstaatliche Rechtsbehelfe gegen geheime Überwachungsmaßnahmen schon im Rahmen der Rechtfertigung des Art. 8 geprüft werden und er daher im Sinne der Einheit der Konvention118 dessen Schranken überträgt.119
D. Rechtsschutz in der Bundesrepublik Deutschland
Im Folgenden werden der materielle und formelle Rechtsschutz des bundesrepublikanischen bzw. sächsischen Überwachungsregimes an den vom EGMR aufgestellten Grundsätzen evaluiert, wobei vorrangig Problematisches in den Blick genommen wird. Die Bundesrepublik Deutschland ratifizierte die Konvention am 05.12.1952, sodass diese seitdem alle ihre Gewalten verpflichtet.
I. Materieller Rechtsschutz: Rechtsgrundlagen für Abhörmaßnahmen
Beim materiellen Rechtsschutz, also der gesetzlichen Einhegung der im Grundsatz verliehenen Befugnisse, gegen innerstaatliche Abhörmaßnahmen bestehen keine Bedenken bezüglich der Zugänglichkeit der in Rede stehenden Parlamentsgesetze und der in den Rechtsgrundlagen genannten Beschränkungsziele sowie der Schutzmechanismen für Zeugnisverweigerungsberechtigte.
1. Telekommunikationsüberwachung
a. Präventive TKÜ: § 66 SächsPVDG und §3G10
§ 66 SächsPVDG120 erlaubt ohne Wissen der betroffenen Person deren Telekommunikation zu überwachen und aufzeichnen. Die Verfahrensvorschriften sind für alle präventiven Maßnahmen des Sächsischen Polizeigesetzes detailliert festgelegt und entsprechen den Anforderungen des EGMR. Umfang und Dauer der Überwachungsmaßnahmen müssen gern. §66112 Nr. 3 SächsPVDG im Antrag angegeben werden. Der potentiell betroffene Personenkreis und die Art der Straftaten sind im §661 SächsPVDG konkretisiert, was dem gesetzlich festzulegenden Umfang der Maßnahme gerecht wird. Die Dauer der Maßnahme ist jedoch nicht gesetzlich begrenzt, was einen Widerspruch zum Befris- tungserfordemis121 darstellt. Damit verstößt § 66 SächsPVDG gegen Art. 8.
Gemäß § 1 I Nr. 1 G10 (i.V.m. § 5 II 1 SächsVerfSchG) dürfen die Verfassungsschutzbehörden (VS) des Bundes und der Länder Telekommunikation überwachen und aufzeichnen.122 Der Umfang der Maßnahme ist in § 3 I G10 (Art der Straftaten) und § 3 II G10 (betroffener Personenkreis) festgelegt. Das Verfahren und der Umgang mit den erhobenen Daten sind in §§ 4 und 9 G10 ff. bestimmt, insbesondere sind hier Prüf-, Kennzeichnungs- und Löschungspflichten aufgeführt sowie Grundsätze für Übermittlungen, Zweckbindung und Weiterverarbeitung. Eine vorherige Genehmigung ist gern. § 10 I G10 vorgesehen, ebenso eine Benachrichtigungspflicht gern. § 12 G10. Bedenken bestehen hinsichtlich des Ausschlusses des Rechtsweges gern. § 13 G10, was jedoch im Rahmen des formellen Rechtsschutzes vertieft werden soll.
b. Repressive TKÜ: §100a StPO
Der Umfang der TKÜ ergibt sich aus § 100 a I-III StPO. § 100 a VI StPO schreibt Protokollierungspflichten vor. Das einzuhaltende Verfahren bei Speicherung, Prüfung, Verwendung, Weitergabe und Vernichtung abgehörter Daten sowie der Zugang zu diesen (§§ 100 e VI, 101 VIII, 474 ff. StPO) und Benachrichtigungspflichten gern. § 101 IV StPO sind gesetzlich festgelegt, § 100 e I StPO regelt Anordnung und Befristung.123 Diese detaillierte Regelung entspricht den Anforderungen des EGMR, da diese materiellen Eingrenzungen ausreichend Garantien gegen Missbrauch der Befugnis gewährleisten sollen. Fraglich ist allerdings, ob die Aufsicht über die Umsetzung unabhängig genug von der anordnenden und der durchführenden Stelle ist. Die Anordnung trifft grundsätzlich die Ermittlungsrichterün, doch gibt es die Möglichkeit der staats- anwaltschaftlichen Eilanordnung gern. § lOOe I StPO. Wird diese nicht innerhalb von drei Werktagen vom Gericht bestätigt, tritt sie außer Kraft. Die Möglichkeit der Eilanordnung kann im Angesicht der praktischen Notwendigkeit einer adäquaten Reaktion auf gegenwärtige Gefahren menschenrechtlich wohl noch hingenommen werden, da die Anordnung auf ein notwendiges Mindestmaß beschränkt ist und durch ein Gericht kontrolliert wird. Dies steht jedoch unter dem Vorbehalt, dass es jedenfalls Verwaltungsvorschriften gibt, die das Ermessen der Staatsanwaltschaft (StA) bezüglich der Feststellung des Vorliegens von Gefahr im Verzug begrenzen.124 StA und Ermittlungsrichterinnen sind institutionell und sachlich unabhängig voneinander. Die aufsichtshabende Stelle ist gem. § 160 I StPO die StA, die sich der Polizei gern. § 161 StPO zur Durchführung der Maßnahmen bedient. Im Fall Zakharov verneint der EGMR die Unabhängigkeit der russischen StA im Rahmen einer effektiven Aufsicht aufgrund des Verfahrens ihrer Ernennung und der Vermischung von Funktionen im Rahmen der Strafverfolgung. Im Ergebnis spricht er ihr die Fähigkeit ab, wirksame Garantien gegen Missbrauch durch die durchführende Stelle vorzusehen.125 Ähnliche Bedenken können auch gegenüber der bundesrepublikanischen StA geltend gemacht werden, zum einen aufgrund ihrer Weisungsgebundenheit gern. § 146 GVG,126 zum anderen aufgrund ihrer jedenfalls informellen Abhängigkeit zur Polizei.127 Eine abschließende Beurteilung zur Konventionswidrigkeit erfordert allerdings eine nähere Untersuchung, die im Rahmen dieser Arbeit nicht erbracht werden kann.
2. Akustische Überwachung
a. Präventive akustische Überwachung: §§ 63 I Nr. 2, 65 SächsPVDG
§ 63 I SächsPVDG erlaubt das Abhören und Aufzeichnen des nicht-öffentlich gesprochenen Wortes außerhalb von Wohnungen. Hier sind, anders als bei der akustischen Wohnraumüberwachung gern. § 65 I, IV 3 SächsPVDG, keine Höchstfrist oder Verlängerungsmöglichkeiten gesetzlich festgelegt, was eine Verletzung von Art. 8 darstellt.
b. Repressive akustische Überwachung: §§ 100 c, 100 fStPO
Eine Abhör- und Aufzeichnungsbefugnis für Wohnraum besteht gern. § 100 c StPO, für Gespräche außerhalb von Wohnraum gern. § 100 f StPO. § 100 elll StPO sieht für die Wohnraumüberwachung die Anordnung durch eine Kammer eines Landgerichts vor und ist gern. Satz 4 auf höchstens einen Monat zu befristen. Unterschiede zu § 100 a StPO bezüglich dem vom EGMR geforderten materiellen Rechtsschutz bestehen darüber hinaus nicht.
3.Abhören durch V-Personen und Verdeckte Ermittler:innen
Bei der Bewertung des Einsatzes von VE sollte auch die jüngste Verurteilung der Londoner Metropolitan Police wegen zahlreicher Menschenrechtsverstöße beachtet werden, u.a. wegen sexistischer Diskriminierung gern. Art. 14, weil sie zahlreiche Polizisten intime Beziehungen mit Frauen eingehen ließ.128
a. Präventiver Einsatz von VE und VP: § 64 SächsPVDG
Beim Einsatz von VE oder VP zur Erhebung von personenbezogenen Daten ist in § 64 VII 3 SächsPVDG eine Höchstfrist von sechs Monaten festgelegt, sodass Art. 8 nicht verletzt ist. Die Hörfalle unter Einsatz von Privaten ist nicht speziell geregelt. Sie bewegt sich in Hinblick auf die menschenrechtliche Zulässigkeit zwischen der den Willen missachtenden und damit Art. 6 I verletzenden Täuschung und der zulässigen kriminalistischen List.129
b. Repressiver Einsatz von VE: §110 a StPO
VE dürfen gern. §§ 110 b I i.V.m. 110 a I StPO durch die Polizei eingesetzt werden, wobei hier die Zustimmung der StA, außer bei Gefahr im Verzug, notwendig ist. Nur zum Betreten von Wohnungen benötigt der Einsatz die Zustimmung des Gerichts gern. § 100 b II StPO. Inwiefern geführte Gespräche aufgezeichnet werden können oder welche sonstige Befugnisse VE haben, ist in der StPO nicht explizit geregelt, sondern nur durch eine unspezifische Verweisung auf „diesefs] Gesetz und andere Rechtsvorschriften“ gern. § 100 c S. 3 StPO benannt. Den Anforderungen des EGMR an die Qualität des Gesetzes gern. Art. 8 II bezüglich Präzision und Klarheit wird dies nicht gerecht, da nicht transparent gemacht wird, aus welchen Vorschriften sich die weiteren Befugnisse ergeben und eine Nachforschung deswegen, jedenfalls für juristische Laien, kaum möglich ist. Es ist somit nicht vorhersehbar unter welchen Voraussetzungen abgehört werden kann,130 was einen Verstoß gegen Art. 8 darstellt.
II. Formeller Rechtsschutz
Formeller Rechtsschutz ist die vorbeugende oder nachträgliche Überprüfung der Rechtmäßigkeit von Maßnahmen und gewährt Entschädigung. Folgend sollen die Rechtsbehelfe und ihre Voraussetzungen betrachtet und sodann beurteilt werden, ob diese ausreichenden Rechtsschutz gegen Abhörmaßnahmen geben.
1. Voraussetzung für formellen Rechtsschutz: Benachrichtigung
Grundlage für formellen Rechtsschutz ist die Kenntnis von den Maßnahmen, was in realitas oftmals die erste Hürde bei der Geltendmachung von Rechten darstellt.131 Benachrichtigungspflichten dienen der Transparenz und Überprüfbarkeit von Maßnahmen und sind unerlässliche Voraussetzung für effektiven Rechtsschutz. Diese bleiben in der bundesrepublikanischen Praxis hinter den gesetzlichen Vorgaben zurück.132 Benachrichtigungsberechtigt sind alle an der abgehörten Kommunikation Beteiligte sowie Anschlussinhaberünnen. Einschränkungen, z. B. wenn es sich bei den abgehörten Gesprächen nur um Terminabsprachen des alltäglichen Lebens handelt, sollen hier jedoch die Uferlo- sigkeit eindämmen und Interessen der Abgehörten vor Bekanntwerden des Sachverhaltes in der Öffentlichkeit schützen.133 Bei verdeckten Ermittlungen mit VE oder VP sind es die Zielperson und jedenfalls einzelne Dritte, die einen hohen Schaden unter dem Einfluss der Ermittlungen erlitten haben.134 Bei Zurückstellung der Benachrichtigung muss diese von einer kontrollierenden Stelle angeordnet und nicht nur beanstandet werden können, wenn die Voraussetzungen für die Zurückstellung nicht vorliegen.135 Sonst würde der Rechtsschutz unter Verweis auf sicherheitspolitische Interessen dauerhaft ausgehebelt werden können. Art. 13 enthält auch die Garantie eines vorläufigen Rechtsschutzes, ggf. mit automatisch aufschiebender Wirkung bei drohender Verletzung von Fundamentalgarantien,136 dieser bleibt aber ebenso außer Betracht wie die „formlose, fristlose und fruchtlose“137 Dienstaufsichtsbeschwerde.
2. Vorbeugender Rechtsschutz durch den Richtervorbehalt
Der EGMR verlangt bei geheimen Abhörmaßnahmen einen vorgeschalteten Rechtsschutz in Form einer Genehmigung, die eine Nachprüfung der Tatsachengrundlage ermöglicht.138 Diese besteht zumindest theoretisch bei allen geprüften Maßnahmen in Form eines Richtervorbehalts bzw. StA-Vorbehalts. Neben dem Richtervorbehalt bestehen in anderen Rechtssystemen Alternativen: so gibt es in Dänemark kontradiktorische Verfahren unter Beiziehung von Rechtsanwältinnen und in Norwegen Berichtspflichten von Kontrollkommissionen und Ombudsvertreterünnen.139 In der Rechtswissenschaft wird die bundesrepublikanische Handhabung des Richtervorbehaltes kritisiert, da die richterliche Anordnung oft nur pauschal Ausführung des Antrages wiederholt, es kaum Ablehnungen sowie keine eigene Ermittlungsmöglichkeit der Richterünnen gibt.140 Die Ermittlungsrichterünnen müssen sich auf die Richtigkeit der Angaben der Polizei verlassen, die sich ihrerseits auf Quellenschutz beruft.141
3. Gerichtlicher nachträglicher Rechtsschutz
Sekundärer Rechtsschutz kann durch eine Amtshaftungsklage geltend gemacht werden. Der EGMR hält bei rechtswidrigen Überwachungsmaßnahmen die Feststellung der Rechtswidrigkeit für ausreichende Genugtuung, sodass diese grundsätzlich nicht entschädigt werden braucht.142 Welcher Primär-Rechtsbe- helf gewählt werden soll hängt vom Rechtsschutzziel ab. So kann, sofern die Maßnahme noch nicht erledigt ist, die Einstellung, oder nach Erledigung die Feststellung der Rechtswidrigkeit der Anordnung oder der Art und Weise der Vollziehung sowie die Löschung der Daten angestrebt werden. Differenziert werden muss zwischen gefahrenabwehrrechtlichen und strafprozessualen Maßnahmen. Bei Vorliegen einer doppelfunktionalen Maßnahme wird entweder nach Schwerpunkt der Maßnahme entschieden oder Doppelspurigkeit des Rechtsweges angenommen.143
a. Rechtsmittel bei präventiven und repressiven Maßnahmen
Noch nicht erledigte präventive Maßnahmen können mit einer verwaltungsgerichtlichen Anfechtungsklage, Erledigte mit der Fortsetzungsfeststellungsklage bezüglich der Abhöranordnung angegriffen werden. Mangels Benachrichtigung, welche den Untersuchungszweck gefährden würde, haben Betroffene i.d.R. keine Kenntnis vor der Beendigung der Maßnahme. Vor Erledigung wäre daher nur eine zufällige Entdeckung denkbar, durch die Untersuchung technischer Geräte oder fehlerhaft gewährte Akteneinsicht. Zur Aufhebung der Überwachungsanordnung wäre der einschlägige Rechtsbehelf bei den Eilanordnungen durch Polizei oder StA die richterliche Entscheidung nach § 98 II 2 StPO analog.144 Bei Anordnung durch die Ermittlungsrichterin ist die Beschwerde gern. § 304 StPO einschlägig. Diese Rechtsbehelfe gelten auch für die Art und Weise der Vollziehung sowie für die Feststellung der Rechtswidrigkeit nach Beendigung der Maßnahme. Die in § 101 VII 2 StPO geregelte richterliche Überprüfung nach Beendigung der Maßnahme tritt in Konkurrenz zu den allgemeinen Rechtsbehelfen. Diese Entscheidung hat für das erkennende Gericht in einem Strafverfahren aber keine Bindungswirkung, sodass die Verwertbarkeit der, ggf. rechtswidrig erlangten, Beweise zunächstunberührtbleibt.145
Dies führt zu einer großen Bedeutung der inzidenten tatrichterlichen Kontrolle, wobei die TKÜ-Ergebnisse selbst selten in Hauptverfahren eingeführt werden, weil sie zu umfangreich für die Verlesung der Protokolle sind und informell durch Geständnisse und Sachbeweise fortwirken; ebenso entfällt die tatrichterliche Kontrolle bei Verfahrenseinstellungen gegenüber allen Beschuldigten.146 Eklatante Rechtsverletzungen führen zu Beweisverwertungsverboten, welche sich entweder direkt aus dem Gesetz ergeben (z.B. §§ 100 d, 160 a StPO) oder aus rechtsstaatlichen Erwägungen, wobei Letzteres regelmäßig den Widerspruch der Angeklagten voraussetzt.147 Art. 13 gewährleistet ein vorbehaltloses Beschwerderecht, sodass diesem die richterrechtlich geschaffene Widerspruchslösung nicht gerecht wird.148 Beachtung muss darüber hinaus die Umsetzung der RL (EU) 2016/680 im seit dem 25. Mai 2018 geltenden BDSG finden, welches Datenschutzregeln für das Polizeirecht und Strafverfahrensrecht aufstellt, vgl. § 500 StPO. § 47 Nr. 1 BDSG stellt ein Verbot mit Erlaubnisvorbehalt auf, sodass die Verarbeitung rechtswidrig erlangter personenbezogener Daten grundsätzlich unzulässig ist. § 51 BDSG ersetzt die Widerspruchslösung durch eine Einwilligungslösung, wobei hier höchstrichterliche Entscheidungen noch ausstehen.149 Sofern Erkenntnisse aus der TKÜ trotz Widerspruch verwendet wurden und es keine Aushändigung von Kopien an die Verteidigung gegeben hat, ist die informationelle Waffengleichheit betroffen, was basierend auf Art. 6 I einen absoluten Revisionsgrund gern. § 338 Nr. 8 StPO darstellt.150
b. Außerordentlicher Rechtsbehelf: Verfassungsbeschwerde
Ferner gibt es den außerordentlichen Rechtsbehelf der Verfassungsbeschwerde zum Verfassungsgericht, für die entsprechend ihrer Kompetenz für Gefahrenabwehr bzw. Strafverfolgung entweder die Länder oder der Bund zuständig ist. Diese prüfen, ob spezifisches Verfassungsrecht verletzt worden ist, bevor eine Individualbeschwerde zum EGMR erhoben werden kann.
4. Parlamentarischer nachträglicher Rechtsschutz
Für die Überwachung durch den VS ist gern. § 13 G10 der Rechtsweg ausgeschlossen, was durch die parlamentarische Kontrolle der Parlamentarischen Kontrollkommission sowie die G10-Kommission kompensiert werden soll. Hierzu entschied der EGMR im Rahmen seiner Prüfung einer Verletzung von Art. 8 und 13, dass diese eine ausreichende Kontrolle gewährleisten, weil sie, jedenfalls durch die vorangegangene Bundesverfassungsgerichtsentscheidung zum G10,151 ausreichend Schutzvorkehrungen gegen einen Missbrauch der staatlichen Überwachungsbefugnisse geben.152 Dies liegt daran, dass sie genug Kompetenzen und Ermittlungsbefugnisse haben und unabhängig und unparteilich sind, insbesondere wegen einer ausgewogenen Besetzung mit Vertreterün- nen der parlamentarischen Opposition.153
III. Zwischenfazit
Das Fehlen von gesetzlichen Befristungen bei der präventiven TKÜ und der akustischen Überwachung außerhalb von Wohnraum im Sächsischen Polizeigesetz verstößt gegen Art. 8. Gezweifelt werden kann an der Unabhängigkeit der StA bei der Aufsicht der Durchführung repressiver geheimer Abhörmaßnahmen durch die Polizei. Bedenken bestehen außerdem hinsichtlich der Befugnisse der VE in der StPO, die nicht klar und präzise genug benannt sind. Darüber hinaus ist zusammenfassend festzuhalten, dass die Anforderungen des EGMR an den materiellen Rechtsschutz im Übrigen nicht offensichtlich verkannt werden. In Hinblick auf den formellen Rechtsschutz wird, anschließend an den Fall Klass,154 konstatiert, dass es einen in der Regel wirksamen vorbeugenden und nachträglichen, gerichtlichen und parlamentarischen Rechtsschutz durch die Gesamtheit aller Beschwerderechte,155 in der bundesrepublikanischen Rechtsordnung gibt. Dies wird den von Art. 8 II geforderten Garantien und Art. 13 gerecht. Verstöße gegen Art. 6 wurden bei den Gesetzen nicht entdeckt.
E. Rechtsschutz auf unionsrechtlicher Ebene
I. Europäische Architektur der Inneren Sicherheit
Den Mitgliedsstaaten der EU obliegt mangels Kompetenzübertragung die Primärverantwortung für die Innere Sicherheit, sodass zwischenstaatliche Kooperation und sekundärrechtliche Harmonisierung die Architektur der Inneren Sicherheit der Union prägen. Europol wurde erst mit dem Vertrag von Lissabon 2009 eine Agentur der Union und, somit anders als zuvor, der gerichtlichen Kontrolle des EuGH sowie des Europäischen Datenschutzbeauftragten (EDSB) unterworfen. Mit dem Vertrag wurde die demokratische Mitbestimmung gestärkt,156 doch bei der Entscheidung über die Erweiterung operativer Maßnahmen kommt dem Parlament gern. Art. 87 III AEUV weiterhin nur ein Anhörungsrecht zu.157 Eine geheimdienstliche Vernetzung findet durch die beiden Lagezentren der Intelligence Analysis Centre und European Union Military Staff - Intelligence Directorate statt, die ebenso wegen fehlender Kompetenz der Union keine eigenen operativen Befugnisse haben. Sie erstellen Bedrohungsanalysen mitFokus auf Terrorismus und sog. Organisierte Kriminalität.[157]158
II. Anwendbarkeit des Unionsrechts bei Ermittlungsmaßnahmen
Aufgrund der sich verstärkenden Kooperation der Sicherheitsbehörden und der Kompetenz für Datenschutz gern. Art. 16 AEUV hat die EU einige sekundärrechtliche Regelungen für den Bereich der Justiz und Inneren Sicherheit erlassen, die durch außergewöhnliche Komplexität und Unübersichtlichkeit ausgezeichnet sind.159 Die unionsrechtlichen Bestimmungen zum Zugriff auf Telekommunikation sind allerdings lückenhaft, sodass mangels unionsrechtlich determiniertem Regelungskomplex selten Bindung der nationalen Ermittlungsbehörden gern. Art. 51 I GrCh besteht.160 Die GrCh ist zu beachten, wenn es sich gern. Art. 52 I GrCh um Abhörmaßnahmen wegen Straftaten handelt, für welche die Union Richtlinien erlassen kann, wie z. B. solche zulasten des EU- Haushalts gern. Art. 325 III AEUV bei grenzüberschreitenden Sachverhalten, oder bei der Einschlägigkeit der RL 2016/680 (Datenschutz in Strafsachen).161 Die Leitung der Ermittlungen bezüglich solcher Straftaten obliegt der Europäischen StA (EuStA), was allerdings auf menschenrechtliche Bedenken hinsichtlich der Vereinbarkeit mit dem Fair-Trial-Grundsatz in Ausformung seines Waffengleichheitsprinzips stößt, da hier durch einen „Summierungseffekt“ verschiedener nationaler Ermittlungsmethoden mangels spezieller Verteidigungsrechte das Schutzniveau der Beschuldigten abzusinken droht.162
III. Rechtsschutz
Parallel dazu wird auch der Rechtsschutz gegen Maßnahmen der EuStA kritisiert, indem es keine klare Zuständigkeitsverteilung zwischen nationalen Gerichten und dem EuGH gibt.163 Gern. Art. 276 AEUV ist der EuGH nicht zuständig für mitgliedstaatliche Polizeimaßnahmen. Dies birgt Probleme in Hinblick auf den Individualrechtsschutz bei grenzübergreifendem Zusammenwirken der Polizeien. Dies wird jedoch zumeist, wie folgend gezeigt werden soll, fälschlicherweise mit dem Argument relativiert, dass Sicherheitsinstitutionen der EU keine Zwangsbefugnisse besitzen oder sich die Polizeien gern, den Prüm-Beschlüssen164 bei Tätigwerden auf einem Hoheitsgebiet eines anderen Mitgliedsstaates dessen Weisungen, Gesetzen und Gerichtsbarkeiten unterwerfen müssen.165 Seit 2016 wird Europol auch durch einen Gemeinsame Parlamentarische Kontrollausschuss überwacht, vgl. Art. 88 AEUV i.V.m. 51 Europol-VO. Die mangelnde Transparenz und Rechenschaftspflicht166 wurde dadurch dennoch nicht behoben, da sich die Überprüfung nur auf eine allgemeine politische Kontrolle beschränkt, wobei nicht einmal der Zugang zu allen relevanten Dokumenten oder ein durchsetzbares Fragerecht gewährleistet ist.167 Dass diese den vom EGMR geforderten Garantien für die parlamentarischen Kontrolle gerecht wird, kann stark bezweifelt werden, allerdings ist sie, anders als z.B. im Rahmen des G10, kein Rechtswegersatz. Die Nichtigkeitsklage gegen Maßnahmen von Europol ist erst seit 2017 direkt möglich, davor musste gern. Art. 263 V AEUV i.V.m. 32 Europol-Beschluss erst der Gemeinsame Parlamentarischen Kontrollausschusses oder der EDSB angerufen werden.168
IV. Europol als europäischer Nachrichtendienst
Gem. Art. 88 III AEUV darf Europol operative Maßnahmen nur in Verbindung und in Absprache mit denjenigen Behörden der Mitgliedstaaten ergreifen, deren Hoheitsgebiet betroffen ist, wobei Zwangsmaßnahmen ausschließlich den einzelstaatlichen Behörden vorbehalten bleiben. Kemaufgabe von Europol ist das Sammeln und Verteilen von Daten und die Erstellung von Lageberichten über aktuelle Bedrohungslagen.169 Dafür verwaltet Europol personenbezogenen Daten in zahlreichen Datenbanken,170 die auch aus Geheimdienst- und Militärquellen oder aus Data-Mining stammen.171 Die EU vergibt milliardenschwere Forschungsaufträge an Unternehmen, die Data-Mining- und Prognosesysteme entwickeln sollen, obwohl diese als menschenrechtswidrig angesehen werden.172 Hier stellt sich die Frage nach der Effektivität des nationalen Rechtsschutzes insbesondere in Hinblick auf die geplante Reform der Europol-VO, die auch die Erhebung von Daten von Privaten (Bank-, Verkehrs- und Versicherungsunternehmen) und Geheim- bzw. Nachrichtendiensten von Drittstaaten vorsieht und dabei Datenschutzbestimmungen eigenständig umgehen darf, mit besonderer Dringlichkeit.173 Es ist vorgesehen, die bisher bestehende rechtswidrige Praxis zu legalisieren, dass Europol nach einer Datensammlung bestimmt, welche mitgliedstaatlichen Ermittlungsbehörden Interesse an diesen Datensätzen haben könnten und diese dann entsprechend weiterleitet.174 Die Encrochat-Er- mittlungen, bei denen nationale Strafverfolgungsbehörden die Herkunft der Daten verschleiern wollten und dies nur durch präzise und arbeitsaufwändige Verteidigungsbemühungen aufgedeckt wurde, werden als Auftakt dafür gesehen.175
F. Unterlaufen des Rechtsschutzes durch (informelle) Europäisierung und Transnationalisierung
Unter welchen Voraussetzungen in der Bundesrepublik personenbezogene Daten von Geheimdiensten an die Polizei weitergeben werden dürfen, regelt (neben spezialgesetzlichen Vorschriften) § 7 IV G10. Diese Weitergabebefugnisse stellen eine Durchbrechung des informationellen Trennungsprinzips176 zwischen Polizei und Nachrichtendiensten dar, welches aus historischen Gründen eine große rechtspolitische Bedeutung hat.177 In den Encrochat-Verfahren argumentieren Verteidigerünnen die Verletzung des Fair-Trial-Grundsatzes mit der Praxis, Hacks von ausländischen statt von deutschen Behörden durchführen zu lassen, weil es dort kein Trennungsgebot und keinen so starken Grundrechtsschutz gibt.178 Diese Verfahrensweise hatte sich bereits im NSA-Skandal abgezeichnet.179 Auf ähnliche Bedenken stößt auch die Vernetzung der Nachrichten- dienstschefünnen der Unionsstaaten, der Schweiz und Norwegen im Rahmen des informellen Berner Clubs, in der sie sich mit Nachrichtendiensten aus der gesamten sog. Westlichen Welt austauschen, sowie ihrer Untergruppe Counter Terrorist Group. Hier wird die Herkunft von Informationen aus innerstaatlichen Abhörmaßnahmen oder nachrichtendienstlicher strategischer Aufklärung in einer Weise verschleiert, dass weder gerichtliche noch öffentliche oder parlamentarische Kontrolle möglich ist.180 Die fehlende Institutionalisierung und rechtsstaatlich notwendige Eingliederung in ein System zur Gewährleistung von Grund- und Menschenrechten untergräbt so die nationalen formellen und materiellen Rechtsschutzmechanismen. Der EGMR wurde nun von Verurteilten aus dem Encrochat-Verfahren angerufen. Dieser hat in einer richterlichen Zwischenverfügung bei den französischen Behörden nachgefragt, inwiefern die Eingriffe gesetzlich vorgesehen und notwendig im Sinne von Art. 8 II waren und ob es wirksame innerstaatliche Rechtsbehelfe gibt.181 Dies lässt darauf schließen, dass der EGMR starke Zweifel an der Vereinbarkeit der Praxis mit den Europäischen Menschenrechten hat.
G. Fazit
Schon 1978 konstatierte der EGMR in seiner Grundsatzentscheidung, dass Abhörmaßnahmen Demokratien untergraben und zerstören können.182 Daher hat er von den Konventionsstaaten zu beachtende Anforderungen aufgestellt, die insbesondere die Privatsphäre, aber auch gewisse Rechtsschutzgarantien gewährleisten sollen, wenn er schon zugesteht, dass es Bedrohungslagen gibt, die starke Menschenrechtseingriffe erfordern mögen. Es wurde gezeigt, dass an den bestehenden materiellen und formellen Rechtsschutzmöglichkeiten insbesondere die Praxis der Umsetzung der die staatliche Gewalt einhegenden Gesetze problematisch ist. So wird der deutschen Justiz und den Ermittlungsbehörden vorgeworfen, es werde sich eher ausnahmsweise an die gesetzlichen und richterrechtlichen Anordnungs- und Eingriffsvoraussetzungen gehalten.183 Des Weiteren leiten sich Behörden international Daten weiter, die sie in einem anderen Land haben erheben lassen, weil Gesetze dort ein niedrigeres Niveau an Menschenrechtsschutz bieten. Wird die Datenherkunft verborgen, ist es nicht mehr möglich, gegen die primäre Datenerhebung durch Abhörmaßnahmen vorzugehen. Angesichts transnationaler Entgrenzungstendenzen besteht eine große Gefahr der Erosion der innerstaatlicher Rechtsbehelfe.
Hinzu kommt eine auf vielen Ebenen zu beobachtende etatistische Entwicklung, bei der mit dem Ziel einer „Verschiebung der Machbarkeit“ bewusst konventionswidrige Gesetze erlassen werden, die vermutlich angesichts der geltenden Rechtslage kassiert würden, jedoch zum Zeitpunkt der gerichtlichen Entscheidung Jahre später schon so normalisiert sind, dass eine Rücknahme der Befugnisse selten in Betracht gezogen wird. So wird die Rechtslage zunehmend zulasten der Menschenrechte an die technischen Möglichkeiten angepasst. In Hinblick auf die rasante Technologisierung des alltäglichen Lebens ist das beängstigend, da durch das Zusammenwirken verschiedener Überwachungsmaßnahmen die Erstellung eines umfassenden Persönlichkeits- und Bewegungsprofils184 möglich ist und diese Daten insbesondere von Privaten zur Kapitalisierung oder autoritären Regimen missbraucht werden können. So stößt beispielsweise die technisch mögliche akustische Überwachung mittels informationstechnischer Systeme auf unüberbrückbare menschenrechtliche Bedenken.185 Aber es gibt schon Bestrebungen186 die Spracherkennungs- und Steuerungssysteme, wie z.B. Amazon Echo oder Ok Google, die nach Aktivierung des Mikros durch das Wake Word Gespräche in Clouds speichern,187 für die Ermittlungen fruchtbar zu machen.188 So bleibt nur zu hoffen, dass sich die technischen Möglichkeiten nicht in einer Weise verselbstständigen, die eine rechtliche Einhegung ausschließen und Staaten die Menschenrechte wieder ernsthafter bei ihren Gesetzgebungsverfahren und Praxen beachten. Fehlt der politische Wille der Konventionsstaaten dazu, braucht es eine starke Zivilgesellschaft, die die demokratischen und rechtsstaatlichen Errungenschaften verteidigen.
[...]
1 Krempl, Stefan, Chatkontrolle: Informatiker und IT-Verbände gegen EU-weite Massenüberwachung, 2022, abrufbar unter: https://www.heise.de/news/Chatkontrolle-Informatiker- und-IT-Verbaende-gegen-EU-weite-Massenueberwachung-6656545.html, zuletzt aufgerufen am 30.03.2022.
2 Zur Abgrenzung von Polizei, Nachrichtendiensten, Geheimdiensten, Verfassungsschutz und Staatsschutz in der Bundesrepublik siehe König, Marco, Trennung und Zusammenarbeit von Polizei und Nachrichtendiensten, Berlin 2005, S. 22 ff.
3 Schäfer, Heike, Präventive TKÜ, Freiburg i. Br. 2008, S. 13.
4 Von zur Mühlen, Nicolas, Zugriffe auf elektronische Kommunikation, Berlin 2019, S. 252.
5 Verordnungsvorschlag zur Änderung der VO (EU) 2016/794 in Bezug auf die Zusammenarbeit von Europol mit privaten Parteien, die Verarbeitung personenbezogener Daten durch Europol zur Unterstützung strafrechtlicher Ermittlungen und die Rolle von Europol in Forschung und Innovation, COM (2020) 796 und COM (2020) 795.
6 Berner, Georg/Köhler, Gerd Michael, HK PAG, Heidelberg, München, Landsberg, Berlin 2008, S. 384.
7 Eingeführt in der Bundesrepublik mit der Reform des G10 und anderer Gesetze der Nachrichtendienste durch das am 9.7.2021 in Kraft getretene Gesetz zur Anpassung des Verfassungsschutzrechts, BGBl. 2021 I S. 2274.
8 Poscher, Ralf/Kappler, Katrin, Staatstrojaner für Nachrichtendienste, 2021, abrufbar unter: https://verfassungsblog.de/staatstrojaner-nachrichtendienste/, zuletzt aufgerufen am 05.04.2022.
9 Für die BRD vgl. § 170 I TKG, welcher Betreiberinnen von Telekommunikationsanlagen verpflichtet technische Einrichtungen zur Umsetzung gesetzlich vorgesehener Maßnahmen zur Überwachung der Telekommunikation vorzuhalten.
10 Wiese, Birthe, Akustische Überwachung mittels informationstechnischer Systeme zur Strafverfolgung und Gefahrenabwehr, Berlin 2019, S. 79 ff.
11 Allerdings geschah dies aufgrund der Einwilligung des Angeklagten und Amazon, vgl. Chavez, Nicole, Arkansas judge drops murder charge in Amazon Echo case, 2017,abrufbar unter: https://edition.cnn.com/2017/ll/30/us/amazon-echo-arkansas-murder-case-dismis- sed/index.html, zuletzt aufgerufen am 01.04.2022.
12 PM Rat der EU vom 06.06.2019, Rat beauftragt Kommission mit der Aushandlung internationaler Übereinkünfte über elektronische Beweismittel in Strafsachen.
13 Pevestorf, Adrian/Söllner, Sebastian/Tölle, Oliver, Polizei-und Ordnungsrecht Kommentar, Köln 2017, § 26 Rn. 2.
14 Guder, Martin André, Die repressive Hörfalle im Lichte der EMRK, Berlin 2007, S. 153.
15 Grabenwarter/Pabel, EMRK, § 1 Rn. 1.
16 Grabenwarter/Pabel, EMRK, § 2 Rn. 1.
17 Nicht weiter bezeichnete Artikel sind solche der EMRK.
18 Karpenstein/Mayer/ Meyer, EMRK, Art. 46 Rn. 31.
19 Karpenstein/Mayer/ Meyer, EMRK, Art. 46 Rn. 20 ff.
20 Karpenstein/Mayer/ Meyer, EMRK, Art. 46 Rn. 40.
21 Karpenstein/Mayer/ Meyer, EMRK, Art. 6 Rn. 2.
22 Grabenwarter/Pabel, EMRK, § 16 Rn. 20.
23 Grabenwarter/Pabel, EMRK, § 4 Rn. 1, 9.
24 Meyer-Ladewig/Nettesheim/von Raumer, HK EMRK, Baden-Baden 2017, Einl. Rn. 22.
25 Bosphorus gg. Irland (GK), Urt. v. 30.6.2005, 45036/98, Ziff. 152 ff.
26 Klass u.a. gg. Deutschland, Urt. v. 6.9.1978, 5029/71 = EuGRZ 1979, 278, Ziff. 31 ff.; Kennedy gg. Vereinigtes Königreich, Urt. v. 18.5.2010, 26839/05 = NLMR 2010, 156, Ziff. 123 ff.; Zakharov gg. Russland (GK), Urt. v. 4.12.2015, 47143/06 = NLMR 2015, 509, Ziff. 171 ff.
27 Schmahl, Stefanie, Effektiver Rechtsschutz gegen Überwachungsmaßnahmen ausländischer Geheimdienste?, JZ 05/2014, S. 228.
28 Zakharov gg. Russland (GK), Urt. v. 4.12.2015, 47143/06 = NLMR 2015, 509, Ziff. 177.
29 Kennedy gg. Vereinigtes Königreich, Urt. v. 18.5.2010, 26839/05 = NLMR 2010, 156, Ziff. 112.
30 Klass u.a. gg. Deutschland, Urt. v. 6.9.1978, 5029/71 = EuGRZ 1979, 278, Ziff. 34.
31 Kennedy gg. Vereinigtes Königreich, Urt. v. 18.5.2010, 26839/05 = NLMR 2010, 156, Ziff. 128 f.
32 Schmahl, Stefanie, Effektiver Rechtsschutz gegen Überwachungsmaßnahmen ausländischer Geheimdienste?, JZ 05/2014, S. 228.
33 Meyer-Ladewig/Nettesheim/von Raumer, HK EMRK, Baden-Baden 2017, Art. 8 Rn. 9.
34 P.G. u. J.H. gg. Vereinigtes Königreich, Urt. v. 25.9.2001, 44787/98, Ziff. 56; Grabenwar- ter/Pabel, EMRK, § 22 Rn. 6.
35 Dörr/Grote/Marauhn/Maraubn/Tborn, EMRK/GG, Art. 8 Rn. 27 f.; Kopp gg. Schweiz, Urt. v. 25.3.1998, 23224/94, Ziff. 50.
36 Halford gg. Vereinigtes Königreich, Urt. v. 25.6.1997, 20605/92, Ziff. 44 f.
37 Paefgen, Franziska, Der von Art. 8 EMRK gewährleistete Schutz vor staatlichen Eingriffen in die Persönlichkeitsrechte im Internet, Berlin, Heidelberg 2017, S. 81.
38 P.G. u. J.H. gg. Vereinigtes Königreich, Urt. v. 25.9.2001, 44787/98, Ziff. 56 ff.
39 Guder, Martin André, Die repressive Hörfalle im Lichte der EMRK, Berlin 2007, S. 158 m.w.N.
40 Dörr/Grote/Marauhn/Maraubn/Tborn, EMRK/GG, Art. 8 Rn. 29.
41 Der EGMR nimmt die Datenschutzkonvention nicht als Maßstab, sondern lehnt seine Auslegung der EMRK nur inhaltlich an diese, wie den Grundsatz der Bearbeitung nach Treu und Glauben oder das Prinzip der Zweckbindung, an, vgl. Paefgen, Franziska, Der von Art. 8 EMRK gewährleistete Schutz vor staatlichen Eingriffen in die Persönlichkeitsrechte im Internet, Berlin, Heidelberg 2017, S. 153, 161.
42 S. u. Marper gg. Vereinigtes Königreich (GK), Urt. v. 4.12.2008, 30562/04 und 30566/04, Ziff. 99.
43 Dörr/Grote/Marauhn/Maraubn/Tborn, EMRK/GG, Art. 8 Rn. 55.
44 Bykov gg. Russland (GK), Urt. v. 10.3.2009, 4378/02, Ziff. 72.
45 P.G. u. J.H. gg. Vereinigtes Königreich, Urt. v. 25.9.2001, 44787/98, Ziff. 37.
46 Frowein/Peukert Art. 8 Rn. 46; Grabenwarter/Pabel, EMRK, § 22 Rn. 34.
47 Karpenstein/Mayer/Pd’tzoM, EMRK, Art. 8 Rn. 86.
48 Grabenwarter/Pabel, EMRK, § 22 Rn. 25.
49 Von zur Mühlen, Nicolas, Zugriffe auf elektronische Kommunikation, Berlin 2019, S. 239.
50 Malone gg. Vereinigtes Königreich, Urt. v. 2.8.1984, 8691/79 = EuGRZ 1985, 17, Ziff. 84.
51 Klass u.a. gg. Deutschland, Urt. v. 6.9.1978, 5029/71 = EuGRZ 1979, 278, Ziff. 31.
52 Zakharov gg. Russland (GK), Urt. v. 4.12.2015, 47143/06 = NLMR 2015, 509, Ziff. 167.
53 Malone gg. Vereinigtes Königreich, Urt. v. 2.8.1984, 8691/79 = EuGRZ 1985, 17, Ziff. 64.
54 Paefgen, Franziska, Der von Art. 8 EMRK gewährleistete Schutz vor staatlichen Eingriffen in die Persönlichkeitsrechte im Internet, Berlin, Heidelberg 2017, S. 143.
55 Weber u. Savaria gg. Deutschland, Urt. v. 29.6.2006, 54934/00 = NL 2006, 177, Ziff. 79. Im Fall wurde das G 10 bzgl. strategischer Femmeldeaufklärung durch den BND angegriffen, bei der internationale Telekommunikationsbeziehungen hinsichtlich bestimmter Suchbegriffe ausgewertet werden. Sofern hier auf dieses Urteil verwiesen wird, bezieht sich der EGMR aber auf Abhörmaßnahmen generell, sodass die Rechtsprechung jedenfalls entsprechend auf das Abhören durch Polizei und Inlandsnachrichtendienste übertragbar ist.
56 Paefgen, Franziska, Der von Art. 8 EMRK gewährleistete Schutz vor staatlichen Eingriffen in die Persönlichkeitsrechte im Internet, Berlin, Heidelberg 2017, S. 120.
57 Malone gg. Vereinigtes Königreich, Urt. v. 2.8.1984, 8691/79 = EuGRZ 1985, 17, Ziff. 71.
58 A. gg. Frankreich, Urt. v. 23.11.1993, 14838/89, Ziff. 36.
59 M.M. gg. Niederlande, Urt. v. 8.4.2003, 39339/98, Ziff. 45, aber Sondervotum von Palm: Polizei habe nur Ratschlag für Beweissammlung für die Privatklagevorbereitung gegeben.
60 Gaskin gg. Vereinigtes Königreich, Urt. v. 7.9.1989, 10454/83 = EuGRZ 2010, 371, Ziff. 49; Dörr/Grote/Marauhn/Maraubn/Tborn, EMRK/GG, Art. 8 Rn. 29.
61 Paefgen, Franziska, Der von Art. 8 EMRK gewährleistete Schutz vor staatlichen Eingriffen in die Persönlichkeitsrechte im Internet, Berlin, Heidelberg 2017, S. 156.
62 Klass u.a. gg. Deutschland, Urt. v. 6.9.1978, 5029/71 = EuGRZ 1979, 278, Ziff. 49.
63 Centrum för Rättvisa gg. Schweden, Urt. v. 19.6.2018, 35252/08= NLMR 2018, 248, Ziff. 112.
64 Szabo u. Vissy gg. Ungarn, Urt. v. 12.1.2016, 37138/14 = NL 2016, 45, Ziff. 69.
65 Lambert gg. Frankreich, Urt. v. 24.8.1998, 23618/94, Ziff. 29; Guder, Martin André, Die repressive Hörfalle im Lichte der EMRK, Berlin 2007, S. 236.
66 Guder, Martin André, Die repressive Hörfalle im Lichte der EMRK, Berlin 2007, S. 238.
67 Kopp gg. Schweiz, Urt. v. 25.3.1998, 23224/94, Ziff. 55.
68 Paefgen, Franziska, Der von Art. 8 EMRK gewährleistete Schutz vor staatlichen Eingriffen in die Persönlichkeitsrechte im Internet, Berlin, Heidelberg 2017, S. 140 m.w.N.; Guder, Martin Andre, Die repressive Hörfalle im Lichte der EMRK, Berlin 2007, S. 228 m.w.N.
69 Malone gg. Vereinigtes Königreich, Urt. v. 2.8.1984, 8691/79 = EuGRZ 1985, 17, Ziff. 67 f.; Zakharov gg. Russland (GK), Urt. v. 4.12.2015, 47.143/06 = NLMR 2015, 509, Ziff. 230.
70 Zakharov gg. Russland (GK), Urt. v. 4.12.2015, 47143/06 = NLMR 2015, 509, Ziff. 231; Zum Zusammenhang zwischen margin of appreciation und Kontrolldichte siehe Graben- warter/Pabel, EMRK, § 18 Rn. 20.
71 Malone gg. Vereinigtes Königreich, Urt. v. 2.8.1984, 8691/79 = EuGRZ 1985, 17, Ziff. 79.
72 Paefgen, Franziska, Der von Art. 8 EMRK gewährleistete Schutz vor staatlichen Eingriffen in die Persönlichkeitsrechte im Internet, Berlin, Heidelberg 2017, S. 169.
73 Weber u. Savaria gg. Deutschland, Urt. v. 29.6.2006, 54934/00 = NL 2006, 177, Ziff. 95.
74 Zakharov gg. Russland (GK), Urt. v. 4.12.2015, 47143/06 = NLMR 2015, 509.
75 Khan gg. Vereinigtes Königreich, Urt. v. 12.5.2000, 35394/97, Ziff. 27.
76 Zakharov gg. Russland (GK), Urt. v. 4.12.2015, 47143/06 = NLMR 2015, 229.
77 Kennedy gg. Vereinigtes Königreich, Urt. v. 18.5.2010, 26839/05 = NLMR 2010, 156, Ziff. 161.
78 Zakharov gg. Russland (GK), Urt. v. 4.12.2015, 47.143/06 = NLMR 2015, 509, Ziff. 248.
79 Kopp gg. Schweiz, Urt. v. 25.3.1998, 23224/94, Ziff. 75.
80 Zakharov gg. Russland (GK), Urt. v. 4.12.2015, 47143/06 = NLMR 2015, 509, Ziff. 251 f.
81 Kennedy gg. Vereinigtes Königreich, Urt. v. 18.5.2010, 26839/05 = NLMR 2010, 156, Ziff. 165 ff.
82 Bejahend: Kennedy gg. Vereinigtes Königreich, Urt. v. 18.5.2010, 26839/05 = NLMR 2010, 156, Ziff. 167; Verneinend wegen gleichzeitiger Verantwortlichkeit für Beantragung der Abhörmaßnahmen und Beaufsichtigung deren Durchführung: Zakharov gg. Russland (GK), Urt. v. 4.12.2015, 47143/06 = NLMR 2015, 509, Ziff. 279ff.
83 Zakharov gg. Russland (GK), Urt. v. 4.12.2015, 47143/06 = NLMR 2015, 509, Ziff. 261, 281.
84 Klass u.a. gg. Deutschland, Urt. v. 6.9.1978, 5029/71 = EuGRZ 1979, 278, Ziff. 49.
85 Zakharov gg. Russland (GK), Urt. v. 4.12.2015, 47143/06 = NLMR 2015, 509, Ziff. 272.
86 Klass u.a. gg. Deutschland, Urt. v. 6.9.1978, 5029/71 = EuGRZ 1979, 278, Ziff. 31.
87 Zakharov gg. Russland (GK), Urt. v. 4.12.2015, 47143/06 = NLMR 2015, 509, Ziff. 289 ff.
88 Karpenstein/Mayer/ Meyer EMRK, Art. 6 Rn. 1.
89 Karpenstein/Mayer/ Meyer, EMRK, Art. 6 Rn. 3.
90 Khan gg. Vereinigtes Königreich, Urt. v. 12.5.2000, 35394/97, Ziff. 38.
91 Guder, Martin André, Die repressive Hörfalle im Lichte der EMRK, Berlin 2007, S. 199 m.w.N.; zu den „Engel-kriteiien“ siehe: Dörr/Grote/Marauhn/Grabenwarter/Rabe/, EMRK/GG, Art. 6Rn.21.
92 Guder, Martin André, Die repressive Hörfalle im Lichte der EMRK, Berlin 2007, S. 200 f.
93 Karpenstein/Mayer/ Meyer, EMRK, Art. 6 Rn. 46; Guder, Martin André, Die repressive Hörfalle im Lichte der EMRK, Berlin 2007, S. 198.
94 Allan gg. Vereinigtes Königreich, Urt. v. 5.11.2002, 48539/99, Ziff. 42 ff.; Bykov gg. Russland (GK), Urt. v. 10.3.2009, 4378/02, Ziff. 88 ff.
95 So z.B. das Recht auf eine Anwälten bei Gewahrsam zur Gefahrenabwehr vgl. MüKoSt- PO/Gaede EMRK Art. 6 Rn. 169.
96 Löffelmann, Markus, Rechtsfragen »legendierter Kontrollen« zum BGH Urteil v. 26.4. 2017, Juristische Rundschau, 11/2017, S. 588 ff.
97 Allan gg. Vereinigtes Königreich, Urt. v. 5.11.2002, 48539/99, Ziff. 42.
98 Allan gg. Vereinigtes Königreich, Urt. v. 5.11.2002, 48539/99, Ziff. 48.
99 Karpenstein/Mayer/ Meyer, EMRK, Art. 6 Rn. 127 f.;
100 Karpenstein/Mayer/ Meyer, EMRK, Art. 6 Rn. 140.
101 Eine Verletzung v. Art. 6 I verneinend, weil weitere Beweismittel Grundlage d. Urteils waren: Bykov gg. Russland (GK), Urt. v. 10.3.2009, 4378/02, Ziff. 103.
102 Allan gg. Vereinigtes Königreich, Urt. v. 5.11.2002, 48539/99, Ziff. 50, 52.
103 Saunders gg. Vereinigtes Königreich, Urt. v. 17.12.1996, 19187/91, Ziff. 68 ff.
104 Allan gg. Vereinigtes Königreich, Urt. v. 5.11.2002, 48539/99, Ziff. 42 ff. unter Bezug auf den kanadischen Supreme Court.
105 Allan gg. Vereinigtes Königreich, Urt. v. 5.11.2002, 48539/99, Ziff. 52.; Im Fall wurde der Betroffene durch einen eingeschleusten Gefängnisnachbam ausgehorcht, sodass sich die Frage nach der Übertragbarkeit der Rechtsprechung auf in Freiheit befindliche Personen stellt, wobei im Ergebnis eine Verallgemeinerung möglich sein soll, vgl. Guder, Martin Andre, Die repressive Hörfalle im Lichte der EMRK, Berlin 2007, S. 210.
106 Allan gg. Vereinigtes Königreich, Urt. v. 5.11.2002, 48539/99, Ziff. 52.
107 Guder, Martin Andre, Die repressive Hörfalle im Lichte der EMRK, Berlin 2007, S. 216.
108 Meyer-Ladewig/Nettesheim/von Raumer, HK EMRK, Baden-Baden 2017, Art. 6 Rn. 158; Karpenstein/Mayer/ Meyer, EMRK, Art. 6 Rn. 152.
109 Lüdi gg. Schweiz, Urt. v. 15.6.1992, 12433/86, Ziff. 40, 49.
110 P.G. u. J.H. gg. Vereinigtes Königreich, Urt. v. 25.9.2001, 44787/98, Ziff. 80.
111 Kennedy gg. Vereinigtes Königreich, Urt. v. 18.5.2010, 26839/05 = NLMR 2010, 156, Ziff. 190.
112 Khan gg. Vereinigtes Königreich, Urt. v. 12.5.2000, 35394/97, Ziff. 44.
113 Karpenstein/Mayer/ Meyer, EMRK, Art. 13 Rn. 23.
114 Weber u. Savaria gg. Deutschland, Urt. v. 29.6.2006, 54934/00 = NL 2006, 177, Ziff. 156.
115 Klaushofer, Reinhard, Strukturmerkmale d. Art. 13 EMRK, NLMR, Salzburg 2014, S. 186.
116 So z.B. bei Klass u.a. gg. Deutschland, Urt. v. 6.9.1978, 5029/71 = EuGRZ 1979, 278; Karpenstein/Mayer/ Meyer, EMRK, Art. 13 Rn. 7.
117 Vgl. unter vielen: Centrum för Rättvisa gg. Schweden, Urt. v. 19.6.2018, 35.252/08= NLMR 2018, 248, Ziff. 184 ; Malone gg. Vereinigtes Königreich, Urt. v. 2.8.1984, 8691/79 = EuGRZ 1985, 17, Ziff. 90.
118 Karpenstein/Mayer/ Meyer, EMRK, Art. 13 Rn. 69.
119 Klass u.a. gg. Deutschland, Urt. v. 6.9.1978, 5029/71 = EuGRZ 1979, 278, Ziff. 68.
120 Nach § 72 ZFdG ist auch das Zollkriminalamt zur Verhütung von Straftaten nach dem Kriegswaffenkontrollgesetz berechtigt den Femmeldeverkehr zu überwachen und aufzuzeichnen. Hier soll sich jedoch auf die vorstehenden Vorschriften beschränkt werden.
121 Zakharov gg. Russland (GK), Urt. v. 4.12.2015, 47143/06 = NLMR 2015, 509, Ziff. 251.
122 Als Auslandsgeheimdienst bleibt der BND für die vorliegende Arbeit ebenso außer Betracht wie der MAD, dessen Aufgabenkreis nur die Einrichtungen der Bundeswehr umfasst. Vertiefend zur Begriffsbestimmung vgl. Lisken, Hans/Denniger, Erhard, Handbuch des Polizeirechts, München 2021, S. 191 ff.
123 Gilt auch für die weiteren repressiven Abhörmaßnahmen nach der StPO.
124 Zakharov gg. Russland (GK), Urt. v. 4.12.2015, 47143/06 = NLMR 2015, 509, Ziff. 230.
125 Zakharov gg. Russland (GK), Urt. v. 4.12.2015, 47143/06 = NLMR 2015, 509, Ziff. 272 ff.
126 Vgl. zum Streit im Rahmen des Europäischen Haftbefehls: EuGH Urt. v. 27.05.2019, Az. C-508/18.
127 Große Strafrechtskommission des Deutschen Richterbundes, Gutachten: Das Verhältnis von Gericht, Staatsanwaltschaft und Polizei im Ermittlungsverfahren, strafprozessuale Regeln und faktische (Fehl-?)Entwicklungen, im Auftrag des Bundesministeriums der Justiz, Berlin 2008, S. 131 ff.
128 Wilson v (1) Commissioner of Police of The Metropolis (2) National Police Chiefs' Council, Urteilv. 30.09.21, abrufbar unter: www.ipt-uk.com/judgments.asp?id=63, zuletzt aufgerufen am 29.03.22.
129 Guder, Martin Andre, Die repressive Hörfalle im Lichte der EMRK, Berlin 2007, S. 223 ff.
130 Zakharov gg. Russland (GK), Urt. v. 4.12.2015, 47143/06 = NLMR 2015, 509, Ziff. 229.
131 Neuling, Marleen, Klage gegen den Verfassungsschutz, in: CfLfP 123, Berlin 2020, S. 88.
132 Krüpe-Gescher, Christiane, TKÜ n. §§ 100a, 100b StPO in der Rechtspraxis 2004, S. 23 ff.
133 Löwe, Ewald/Rosenberg, Wemer/Hauck, StPO Kommentar, Berlin 2019, § 101 Rn. 20.
134 Löwe, Ewald/Rosenberg, Wemer/Hauck, StPO Kommentar, Berlin 2019, § 101 Rn. 24.
135 Schäfer, Heike, Präventive TKÜ, Freiburg i. Br. 2008, S. 236.
136 Gebremedhin [Gaberamadhien] gg. Frankreich, Urt. v. 26.4.2007, 25389/05, Ziff. 66 f.
137 Hölscher, Christiane, Rechtsschutz und Mitteilungspflicht bei heimlichen strafprozessualen Zwangsmaßnahmen, Frankfurt am Main 2000, S. 25.
138 Zakharov gg. Russland (GK), Urt. v. 4.12.2015, 47143/06 = NLMR 2015, 509, Ziff. 259 ff.
139 Schäfer, Heike, Präventive TKÜ, Freiburg i. Br. 2008, S. 171.
140 Roggan, Fredrik/Kutscha, Martin/Gercke, Handbuch zum Recht der inneren Sicherheit, Berlin 2006, S. 150.
141 Krüpe-Gescher, Christiane, TKÜ n. §§ 100a, 100b StPO in der Rechtspraxis 2004, S. 228.
142 Khan gg. Vereinigtes Königreich, Urt. v. 12.5.2000, 35394/97, Ziff. 49; Centrum för Rättvi- sa gg. Schweden, Urt. v. 19.6.2018, 35252/08= NLMR 2018, 248, Ziff. 380.
143 Hölscher, Christiane, Rechtsschutz und Mitteilungspflicht bei heimlichen strafprozessualen Zwangsmaßnahmen, Frankfurt am Main 2000, S. 75. m.w.N.
144 Hölscher, Christiane, Rechtsschutz und Mitteilungspflicht bei heimlichen strafprozessualen Zwangsmaßnahmen, Frankfurt am Main 2000, S. 69f.
145 Meyer-Mews, Hans, TKÜ im Strafverfahren, Bremen 2019, S. 54 m.w.N.
146 Krüpe-Gescher, Christiane, TKÜ n. §§ 100a, 100b StPO in der Rechtspraxis 2004, S. 182, 189.
147 Bruns, Michael, Karlsruher StPO-Kommentar, München 2019, § 100 a Rn. 49, 53.
148 Meyer-Mews, Hans, TKÜ im Strafverfahren, Bremen 2019, S. 66.
149 Meyer-Mews, Hans, TKÜ im Strafverfahren, Bremen 2019, S. 95.
150 Meyer-Mews, Hans, TKÜ im Strafverfahren, Bremen 2019, S. 46.
151 BVerfGE 30, 1 ff., Urt. v. 15.12.1970.
152 Klass u.a. gg. Deutschland, Urt. v. 6.9.1978, 5029/71 = EuGRZ 1979, 278, Ziff. 63 ff., 71.
153 Klass u.a. gg. Deutschland, Urt. v. 6.9.1978, 5029/71 = EuGRZ 1979, 278, Ziff. 56.
154 Klass u.a. gg. Deutschland, Urt. v. 6.9.1978, 5029/71 = EuGRZ 1979, 278, Ziff. 72.
155 Klaushofer, Reinhard, Strukturmerkmale d. Art. 13 EMRK, NLMR, Salzburg 2014, S. 189.
156 Albrecht, Jan Philipp/Janson, Nils, Die Kontrolle des Europäischen Polizeiamtes durch das Europäische Parlament nach dem Vertrag von Lissabon und dem Europol-Beschluss, in: EuR 2012, 230, 235 f.
157 Davoli, Alessandro, Europäisches Parlament: Polizeiliche Zusammenarbeit, 2021, https:// www.europarl.europa.eu/factsheets/de/sheet/156/polizeiliche-zusammenarbeit zuletzt aufgerufen am 19.4.2022.
158 Monroy, Matthias, Die Vergeheimdienstlichung der EU, in: CILIP 128, Berlin 2022, S. 41.
159 Möstle, Markus, Grundfragen Europäischer Polizeilicher Kooperation, in: Kugelmann, Dieter (Hrsg.), Migration, Datenübermittlung & Cybersicherheit, Baden-Baden 2016, S. 12 ff., 28; eine Übersicht zu Institutionen von Europol und Rechtsquellen: Davoli, Alessandro, Europäisches Parlament: Polizeiliche Zusammenarbeit, 2021, https://www.europarl.euro- pa.eu/factsheets/de/sheet/156/polizeiliche-zusammenarbeit zuletzt aufgerufen am 19.4.2022.
160 Von zur Mühlen, Nicolas, Zugriffe auf elektronische Kommunikation, Berlin 2019, S. 245.
161 Wiese, Birthe, Akustische Überwachung mittels informationstechnischer Systeme zur Strafverfolgung und Gefahrenabwehr, Berlin 2019, S. 154 f.
162 Peters, Almut, Die Europäische Staatsanwaltschaft - Eine Gefahr für den fair trial-Grundsatz?, 2014, abrufbar unter: https://verfassungsblog.de/europaeische-staatsanwaltschaft-ge- fahr-fuer-fair-trial-grundsatz/, zuletzt aufgerufen am 19.4.2022.
163 Böse, Martin, Die Europäische Staatsanwaltschaft „als“ nationale Strafverfolgungsbehörde, JZ 2/2017, S. 82 ff.
164 Bes. 2008/615/JI v. 23.6.2008 zur Vertiefung der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit, insbes. zur Bekämpfung des Terrorismus und der grenzüberschreitenden Kriminalität.
165 Möstle, Markus, Grundfragen Europäischer Polizeilicher Kooperation, in: Kugelmann, Dieter (Hrsg.), Migration, Datenübermittlung & Cybersicherheit, Baden-Baden 2016, S. 27, 34.
166 Berthélémy, Chloé/Lund, Jesper, Die neue Europol-Reform, in: CILIP 128, Berlin 2022, S. 24.
167 Monroy, Matthias, Mehr parlamentarische Kontrolle für Europol: Geht das überhaupt?, 2016, abrufbar unter: https://netzpolitik.org/2016/mehr-parlamentaiische-kontrolle-fuer-eu- ropol-geht-das-ueberhaupt/ zuletzt aufgerufen am 19.4.2022.
168 Schoppa, Katrin, Europol im Verbund der Europäischen Sicherheitsagenturen, Berlin 2013, S. 266.
169 Möstle, Markus, Grundfragen Europäischer Polizeilicher Kooperation, in: Kugelmann, Dieter (Hrsg.), Migration, Datenübermittlung & Cybersicherheit, Baden-Baden 2016, S. 20 f.
170 Ausführlich zu den Informationssammlungen von Europol vgl. Schoppa, Katrin, Europol im Verbund der Europäischen Sicherheitsagenturen, Berlin 2013, S. 210 ff.
171 Fanta, Alexander, EU-Polizeibehörde lässt offen, ob sie illegale Datensammlung löscht; https://netzpolitik.org/2022/europol-eu-polizeibehoerde-laesst-offen-ob-sie-illegale-daten- sammlung-loescht/; Anordnung des EDSB v. Januar 2022, der verlangt, dass vier Petabyte rechtswidrig erhobene personenbezogene Daten gelöscht werden sollen, PM abrufbar unter https://edps.europa.eu/node/8469_de, zuletzt aufgerufen am 06.04.2022.
172 Jones, Chris, Europäische Sicherheitsforschung, in: CILIP 115, Berlin 2018, S. 59 ff.
173 Berthélémy, Chloé/Lund, Jesper, Die neue Europol-Reform, in: CILIP 128, Berlin 2022, S. 26.
174 Berthélémy, Chloé/Lund, Jesper, Die neue Europol-Reform, in: CILIP 128, Berlin 2022, S. 25.
175 Tremmer, Moritz,"Das führt nur zu unnötigen Nachfragen", 2021, abrufbar unter: https:// www.golem.de/news/bka-das-fuehrt-nur-zu-unnoetigen-nachfragen-2201-162285.html, zuletzt aufgerufen am 19.4.2022.
176 BVerfG Bes. v. 10.11.2020 Az. 1 BvR 3214/15, Amtl. Leitsatz Nr. 1; Ruschemeier, Hannah, Eingriffsintensivierung durch Technik, 2020, abrufbar unter: https://verfassungsblog.de/ eingriffsintensivierung-durch-technik/ zuletzt aufgerufen am 20.4.2022.
177 König, Marco, Trennung und Zusammenarbeit von Polizei und Nachrichtendiensten, Berlin 2005, S. 274.
178 Tremmer, Moritz,"Das führt nur zu unnötigen Nachfragen", 2021, abrufbar unter: https:// www.golem.de/news/bka-das-fuehrt-nur-zu-unnoetigen-nachfragen-2201-162285.html, zuletzt aufgerufen am 19.4.2022.
179 Fuchs, Christian/ Goetz, John/Obermaier, Frederik, Verfassungsschutz beliefert NSA, 2013, abrufbar unter: https://www.sueddeutsche.de/politik/spionage-in-deutschland-verfas- sungsschutz-beliefert-nsa-1.1770672 zuletzt aufgerufen am 20.4.2022.
180 Jirât, Jan/Naegeli, Lorenz, Geheimdienstgilde außer Kontrolle, in: CILIP 121, Berlin 2020, S. 77.
181 A. L. und E. J. gg. Frankreich, Questions pax parties v. 8.12.2021, 44715/20 und 47930/21.
182 Klass u.a. gg. Deutschland, Urt. v. 6.9.1978, 5029/71 = EuGRZ 1979, 278, Ziff. 49.
183 Meyer-Mews, Hans, TKÜ im Strafverfahren, Bremen 2019, S. 7.
184 Dies sei jedenfalls im bundesrepublikanischen Grundrechtsschutz nicht mit der Menschenwürde vereinbar: BVerfGE 65, 1, Ziff. 43; 109, 279, Ziff. 323.
185 Wiese, Birthe, Akustische Überwachung mittels informationstechnischer Systeme zur Strafverfolgung und Gefahrenabwehr, Berlin 2019, S. 427.
186 Unger, Christian, Überwachung von Alexa, Siri oder Google Home - Behörden fordern Befugnisse, 2019, abrufbar unter: https://www.morgenpost.de/politik/article226146985/Ue- berwachung-von-Alexa-und-Co-Kommt-der-Lauschangriff-4-0.html zuletzt aufgerufen am 20.4.2022.
187 Chavez, Nicole, Arkansas judge drops murder charge in Amazon Echo case, 2017, abrufbar unter: https://edition.cnn.com/2017/ll/30/us/amazon-echo-arkansas-murder-case-dismis- sed/index.html zuletzt aufgerufen am 20.4.2022.
Häufig gestellte Fragen
Was ist der Zweck dieses Dokuments?
Dieses Dokument ist eine umfassende Sprachvorschau, die den Titel, das Inhaltsverzeichnis, die Ziele und Hauptthemen, Kapitelzusammenfassungen und Schlüsselwörter enthält. Es analysiert Themen in einer strukturierten und professionellen Art und Weise.
Welche Themen werden im Inhaltsverzeichnis behandelt?
Das Inhaltsverzeichnis umfasst folgende Themen: Literaturverzeichnis, Einleitung, operative und rechtliche Grundlagen (mit Unterpunkten zu Akteuren, Techniken und dem EGMR), menschenrechtliche Anforderungen an den Rechtsschutz bei geheimen Abhörmaßnahmen nach dem EGMR, Rechtsschutz in der Bundesrepublik Deutschland, Rechtsschutz auf unionsrechtlicher Ebene, Unterlaufen des Rechtsschutzes durch Europäisierung und Transnationalisierung und ein Fazit.
Welche Akteure werden im Abschnitt über operative und rechtliche Grundlagen betrachtet?
Der Abschnitt behandelt Polizeien, Inlandsnachrichtendienste und Institutionen der Europäischen Union (Europäische Staatsanwaltschaft und Europol) als relevante Akteure.
Welche Techniken der Abhörmaßnahmen werden im Dokument vorgestellt?
Es werden Telekommunikationsüberwachung (TKÜ), akustische Überwachung und das Abhören durch V-Personen und Verdeckte Ermittler:innen (VE) vorgestellt.
Was sind die menschenrechtlichen Anforderungen an den Rechtsschutz bei geheimen Abhörmaßnahmen nach dem EGMR?
Die menschenrechtlichen Anforderungen werden anhand der Artikel 8, 6 und 13 der EMRK analysiert. Dabei geht es um die Zulässigkeit von Beschwerden, die persönliche Berechtigung, den Schutz der Privatsphäre, Wohnung und Korrespondenz, das Vorliegen eines Eingriffs, dessen Rechtfertigung (Beschränkungsziel, Notwendigkeit und gesetzliche Grundlage), sowie um die Gewährleistung eines fairen Verfahrens (Fair Trial) und einer wirksamen Beschwerde.
Wie wird der Rechtsschutz in der Bundesrepublik Deutschland evaluiert?
Der materielle und formelle Rechtsschutz des bundesrepublikanischen bzw. sächsischen Überwachungsregimes wird an den vom EGMR aufgestellten Grundsätzen evaluiert, wobei insbesondere problematische Aspekte hervorgehoben werden. Es werden die Rechtsgrundlagen für Abhörmaßnahmen (TKÜ, akustische Überwachung, Einsatz von VE/VP) und formelle Rechtsschutzmechanismen (Benachrichtigung, Richtervorbehalt, gerichtlicher und parlamentarischer Rechtsschutz) betrachtet.
Welche Rolle spielt das Unionsrecht beim Rechtsschutz?
Es wird die Anwendbarkeit des Unionsrechts bei Ermittlungsmaßnahmen, der Rechtsschutz auf EU-Ebene, die Rolle von Europol und die Europäische Architektur der Inneren Sicherheit betrachtet.
Was bedeutet "Unterlaufen des Rechtsschutzes durch Europäisierung und Transnationalisierung"?
Dieser Abschnitt behandelt die Problematik, dass nationale Rechtsschutzmechanismen durch informelle Kooperationen und den Austausch von Informationen zwischen Sicherheitsbehörden verschiedener Länder untergraben werden können, insbesondere wenn dabei ein geringerer Menschenrechtsstandard angewendet wird.
- Arbeit zitieren
- Anna-Maria Müller (Autor:in), 2022, Effektiver Rechtsschutz gegen innerstaatliche Abhörmaßnahmen im Rahmen der Rechtsprechung des EGMR, München, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/1289972