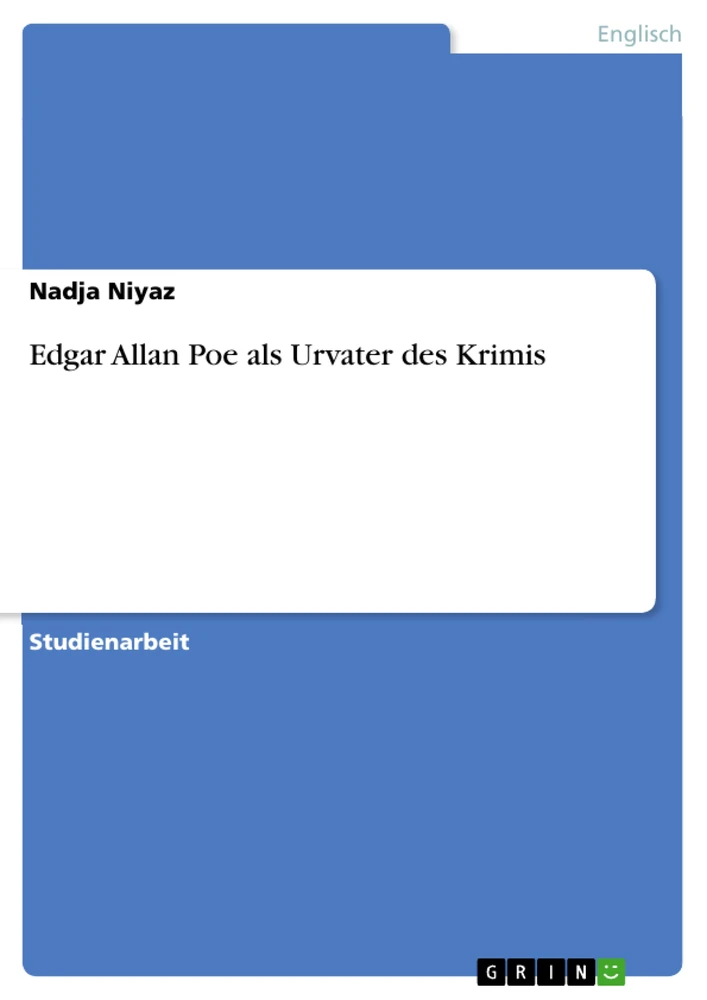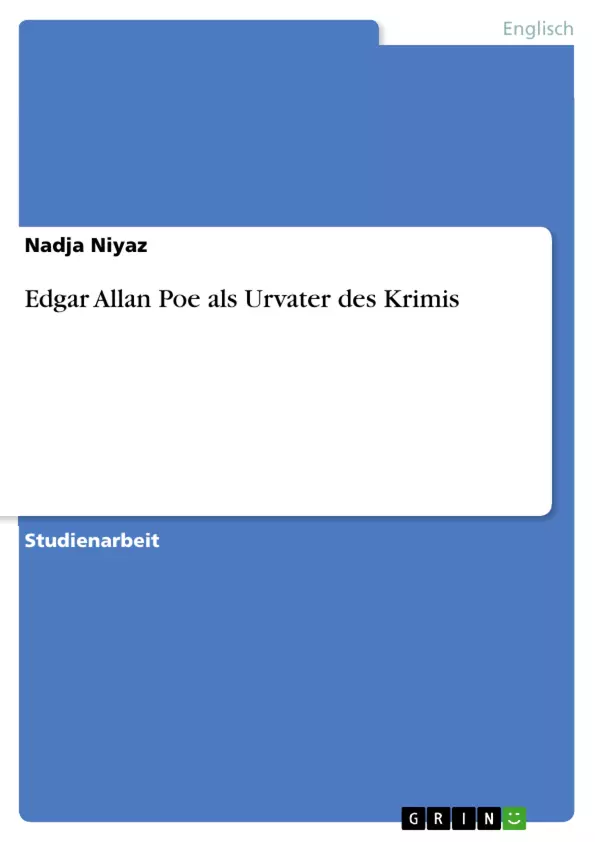Im Rahmen dieser Arbeit sollen vor allem die Werke "The Speckled Band" von Doyle und "Murder in the Mews" von Agatha Christie näher beleuchtet und mit "The Murders in the Rue Morgue" verglichen werden. Dabei wird auf Inhalt und Erzählperspektive sowie Charakter der Hauptpersonen und deren detektivische Methoden eingegangen.
Das sogenannte "locked-room mystery" bezieht sich im traditionellen Sinne auf ein Verbrechen, das in einem abgeschlossenen Raum begangen wurde und somit eigentlich unmöglich und vor allem unlösbar ist. Das Verbrechen, bei welchem es sich fast immer um Mord handelt, wurde unter Umständen begangen, die es zunächst unmöglich erscheinen lassen, dass jemand dieses Verbrechen begehen konnte und die Frage aufwerfen, wie der Mörder ins Zimmer kam und wie er wieder hinausgelangte. Es wirkt so, als hätte er sich in Luft aufgelöst. Die Unmöglichkeit des Verbrechens und die Suche nach einer rationalen Erklärung für das scheinbar übermenschliche Verschwinden des Täters ist es, was den Protagonisten (den Detektiv) in seinen Ermittlungen vorantreibt. Dabei versucht er, hinter diese vordergründigen Gegebenheiten zu blicken und dadurch das Rätsel zu lösen.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Inhalt und Erzählperspektive
- The Murders in the Rue Morgue
- The Adventure of the Speckled Band
- Murder in the Mews
- Charakter und Methodik
- C. Auguste Dupin
- Sherlock Holmes
- Hercule Poirot
- Resümee
- Literaturverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit analysiert verschiedene Locked-Room-Mysterien und untersucht dabei die Rolle des Detektivs und seine Methoden. Im Fokus stehen die Werke "The Murders in the Rue Morgue" von Edgar Allan Poe, "The Speckled Band" von Arthur Conan Doyle und "Murder in the Mews" von Agatha Christie.
- Analyse des Locked-Room-Motivs
- Vergleich der Detektive Dupin, Holmes und Poirot
- Untersuchung der Erzählperspektiven in den Texten
- Bedeutung von Rationalität und Logik in der Kriminalermittlung
- Entwicklung des Krimigenres im 19. Jahrhundert
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung
Die Einleitung stellt das Locked-Room-Mystery als Genre vor und erklärt seine Entstehung sowie seine Bedeutung im Kontext des 19. Jahrhunderts. Dabei wird auch auf die Rolle von Edgar Allan Poe als Wegbereiter des Genres hingewiesen.
Inhalt und Erzählperspektive
The Murders in the Rue Morgue
Die Kurzgeschichte "The Murders in the Rue Morgue" wird als eine der ersten Detective Stories angesehen und beschreibt die Lösung eines Mordfalls, der in einem abgeschlossenen Raum stattfindet. Der Protagonist C. Auguste Dupin löst das Rätsel mithilfe seiner scharfen Beobachtungsgabe und analytischen Fähigkeiten.
The Adventure of the Speckled Band
In dieser Kurzgeschichte von Arthur Conan Doyle ermittelt Sherlock Holmes in einem Fall, der sich in einem abgeschlossenen Raum abspielt. Die Geschichte zeichnet sich durch eine spannende Handlung und die Verwendung ungewöhnlicher Elemente aus.
Murder in the Mews
Der Mordfall, der in diesem Kapitel untersucht wird, spielt ebenfalls in einem abgeschlossenen Raum und erfordert besondere detektivische Fähigkeiten. Der Protagonist, Hercule Poirot, ermittelt mithilfe seiner psychologischen Kenntnisse und Logik.
Schlüsselwörter
Locked-Room-Mystery, Kriminalermittlung, Detektiv, C. Auguste Dupin, Sherlock Holmes, Hercule Poirot, Erzählperspektive, Rationalität, Logik, 19. Jahrhundert.
- Quote paper
- Nadja Niyaz (Author), 2016, Edgar Allan Poe als Urvater des Krimis, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/1289825