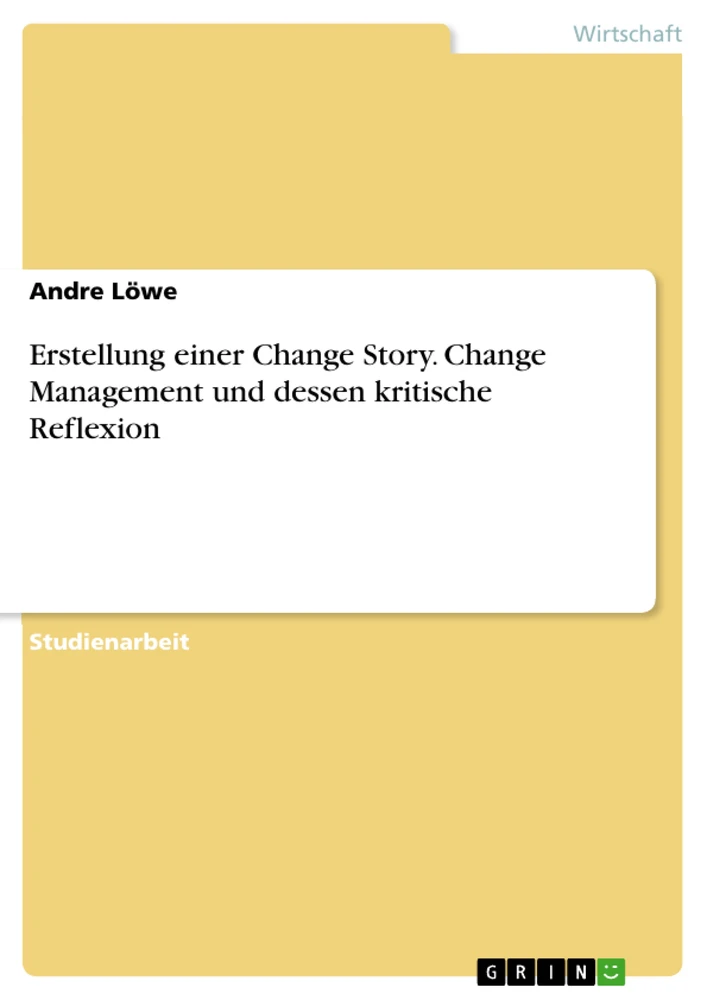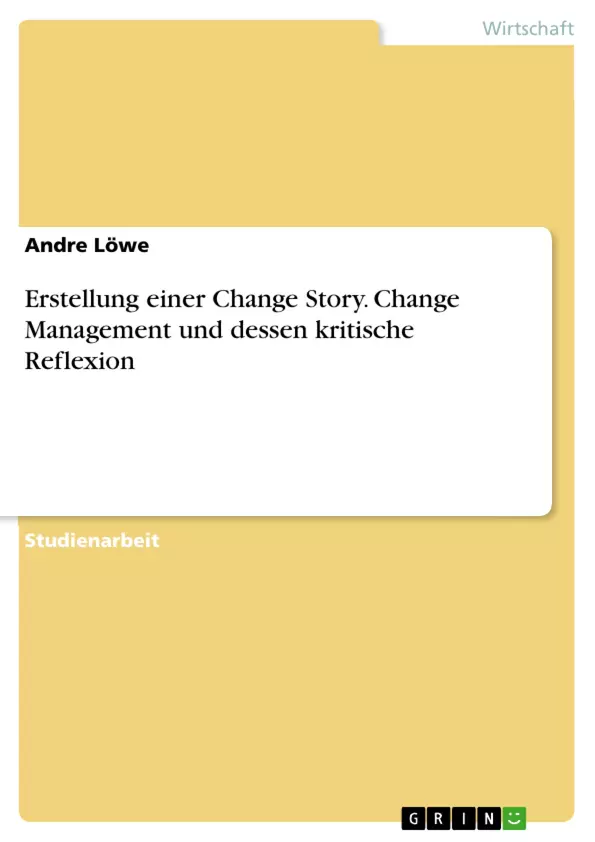Diese Forschungsarbeit soll das Thema Change-Management aufarbeiten. Speziell sollen mögliche Emotionen und Reaktionen von Betroffenen definiert und analysiert werden. Schlussfolgernd steht die Kreation einer Change-Story für die Firma Cyclemanya im Vordergrund.
Die zu entwickelnde Change Story soll für die fiktive Firma Cyclemanya gelten und den Wandel unterstützen. Die Firma Cyclemanya wurde im Jahr 2015 gegründet und spezialisierte sich auf Premium Produkte im Bereich E-Bikes. Im Jahr 2021 sollen alle fünf Standorte zu einem zentralisierten Standort zusammengelegt werden. In diesem Zusammenhang können Herausforderungen für das Unternehmen entstehen, sodass eine Change Story für die erfolgreiche Zusammenlegung vorliegen sollte. Weiterhin sollen auch mögliche Auswirkungen der Beschäftigten beschrieben werden, anhand der Phasenmodelle zu den emotionalen Reaktionen. Die daraus ergebende Forschungsfrage ist: „Wie kann die Cyclemanya eine erfolgreiche Zusammenlegung der Standorte gestalten, unter Berücksichtigung aller emotionalen Reaktionen der Mitarbeiter?“.
Die Arbeit gliedert sich in zwei Blöcke. Einerseits werden theoretische Grundlagen des Change-Managements mit Modellen der emotionalen Reaktionen auf Veränderungen. Im zweiten Block werden die theoretischen Modelle auf die Cyclemanya angewendet und eine Change Story entwickelt. Zur Erklärung der emotionalen Modelle bezieht sich der Autor auf drei stark bekannte Modelle, welche er aus dem Kontext für sinnvoll erachtet. Die drei Modelle werden häufig in der Literatur als die besten beschrieben, somit orientiert sich der Autor ebenfalls an diesen. In der praktischen Anwendung legt der Autor das Augenmerk auf die Erstellung einer Change Story und dessen kritische Reflexion.
Inhaltsverzeichnis
- Veränderungsprozesse gestalten
- Aufgabenstellung und Herausforderung der Arbeit
- Zielsetzung der Ausarbeitung
- Schematischer Ablauf der Forschung
- Bestimmungsfaktor Change Management
- Ursachen von Reaktionen auf Veränderungen
- Ausprägung des Changemanagements
- Phasenmodelle zu den emotionalen Reaktionen
- 7-Phasen-Modell von Streich
- Phasenmodell emotionalen Reaktionen nach Kraus, Becker-Kolle und Fischer
- 8-Phasen-Modell von Kotter
- Change Story der Cyclemanya GmbH
- Corporate Governance
- Begriffsabgrenzung von Corporate Governance
- Determinante Prinzipal Agent Theorie
- Stewardship Theorie
- Kritische Reflexion der Change Story
- Fazit vom Change-Management
- Ausblick von Change-Management
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Forschungsarbeit analysiert die Herausforderungen des Change-Managements und die Gestaltung von Veränderungsprozessen im Kontext der fiktiven Unternehmung Cyclemanya. Die Arbeit beleuchtet die emotionalen Reaktionen von Betroffenen auf Veränderungen und entwickelt eine Change Story für die erfolgreiche Zusammenlegung von Standorten.
- Emotionale Reaktionen auf Veränderungen
- Anwendung von Phasenmodellen im Change Management
- Entwicklung einer Change Story
- Corporate Governance und die Prinzipal-Agent-Theorie
- Stewardship Theorie
Zusammenfassung der Kapitel
Der erste Teil der Arbeit behandelt theoretische Grundlagen des Change Managements. Dabei werden Ursachen von Reaktionen auf Veränderungen und die Ausprägung des Change Managements erläutert. Der Fokus liegt dabei auf Phasenmodellen, die die emotionalen Reaktionen auf Veränderungen beschreiben, wie das 7-Phasen-Modell von Streich, das Phasenmodell emotionaler Reaktionen nach Kraus, Becker-Kolle und Fischer sowie das 8-Phasen-Modell von Kotter.
Kapitel 3 beschäftigt sich mit der Change Story der Cyclemanya GmbH. Es werden die Corporate Governance sowie die Prinzipal-Agent-Theorie und die Stewardship-Theorie im Kontext der Change Story beleuchtet.
Schlüsselwörter
Change Management, Veränderungsprozesse, emotionale Reaktionen, Phasenmodelle, Change Story, Cyclemanya, Corporate Governance, Prinzipal-Agent-Theorie, Stewardship-Theorie.
Häufig gestellte Fragen
Was ist eine "Change Story" im Change Management?
Eine Change Story ist eine motivierende Erzählung, die den Sinn des Wandels erklärt, Ängste abbaut und die Mitarbeiter auf den neuen Weg (z.B. eine Standortzusammenlegung) mitnimmt.
Welche emotionalen Phasen durchlaufen Mitarbeiter bei Veränderungen?
Basierend auf Modellen wie dem 7-Phasen-Modell von Streich durchlaufen Betroffene Phasen wie Schock, Verneinung, Einsicht, Akzeptanz, Ausprobieren, Erkenntnis und Integration.
Wie kann Cyclemanya die Standortzusammenlegung erfolgreich gestalten?
Durch Berücksichtigung der emotionalen Reaktionen und eine klare Kommunikation der Vision, um Widerstände zu minimieren und die Belegschaft zu motivieren.
Was besagt das 8-Phasen-Modell von Kotter?
Kotter beschreibt Schritte wie die Erzeugung eines Dringlichkeitsgefühls, die Bildung einer Führungskoalition und die Verankerung der neuen Ansätze in der Unternehmenskultur.
Welche Rolle spielt die Prinzipal-Agent-Theorie hier?
Sie hilft, Interessenkonflikte zwischen Management und Mitarbeitern während des Wandels zu verstehen, um Informationsasymmetrien und Misstrauen abzubauen.
- Arbeit zitieren
- Andre Löwe (Autor:in), 2022, Erstellung einer Change Story. Change Management und dessen kritische Reflexion, München, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/1289467