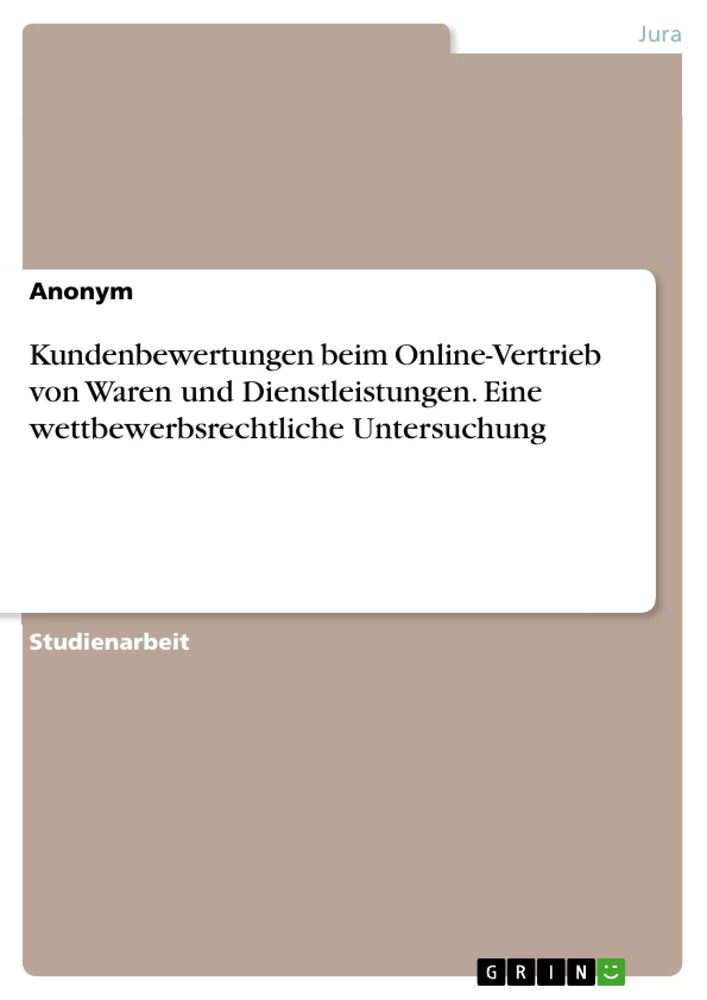Die vorliegende Arbeit untersucht Kundenbewertungen beim Online-Vertrieb von Waren und Dienstleistungen in wettbewerbsrechtlicher Hinsicht. Dabei gibt sie zunächst einen grundlegenden Überblick und arbeitet darauf aufbauend vorrangig die wettbewerbsrechtlichen Problemfelder im Zusammenhang mit Kundenbewertungen aus. Nachdem anhand eines erst vor kurzem entschiedenen BGH Urteils die wettbewerbsrechtliche Haftung von Händlern bezüglich unzulässiger Bewertungen Dritter geklärt wurde, wird das Einschreiten des Bundeskartellamts in komprimierter Form thematisiert. Abgeschlossen wird mit einem Fazit und einem Ausblick, besonders im Hinblick der fortscheitenden Technisierung.
Inhaltsverzeichnis
- A. Einleitung
- B. Grundlegender Überblick
- I. Grundlagen und Entwicklung des Wettbewerbsrechts
- II. Zweck und Wirkung von Kundenbewertungen im Online-Vertrieb
- III. Voraussetzungen für die Anwendung des UWG
- 1. Geschäftliche Handlung
- 2. Mitbewerberstellung
- C. Wettbewerbsrechtliche Problemfelder
- I. Darstellung von Kundenbewertungen
- 1. Gefilterte Bewertungen
- a. Das Sich-zu-eigen-machen
- b. Die Rolle von Algorithmen
- 2. Positive Fake-Bewertungen
- 3. Negative Fake-Bewertungen
- 4. Zwischenergebnis
- 1. Gefilterte Bewertungen
- II. Incentivierte Kundenbewertungen
- 1. (Un-)Zulässigkeit gesamtdarstellender Kundenbewertungen
- 2. Beabsichtigte Platzierung gefälschter Kundenbewertungen
- 3. Gesamtbewertung
- III. Lösungsansätze
- 1. Lockende Aufforderung zur Bewertungsabgabe
- a. Aggressive geschäftliche Handlung
- b. Unzumutbare Belästigung
- 2. Anknüpfendes Veröffentlichen
- a. Finanzierter Einsatz redaktioneller Inhalte
- b. Irreführung
- c. Nichtkenntlichmachung des kommerziellen Zwecks
- 3. Ausnahmen
- 1. Lockende Aufforderung zur Bewertungsabgabe
- D. Wettbewerbsrechtliche Haftungsfrage hinsichtlich Bewertungsinhalte Dritter
- I. Sachverhalt, Vorinstanzen und Entscheidung des BGH
- II. Rechtlicher Unterschied zur eigenbetriebenen Website
- E. Einschreiten des Bundeskartellamts
- F. Fazit und Ausblick
- I. Darstellung von Kundenbewertungen
- Die Entwicklung des Wettbewerbsrechts im Kontext des Online-Handels
- Die Bedeutung und Funktionsweise von Kundenbewertungen im Online-Vertrieb
- Die wettbewerbsrechtlichen Probleme im Zusammenhang mit gefälschten, manipulierten oder incentivized Kundenbewertungen
- Die Haftungsfrage bei Bewertungsinhalten Dritter
- Lösungsansätze zur Eindämmung von Missbrauch und zur Sicherung der Vertrauenswürdigkeit von Kundenbewertungen
- Die Einleitung führt in die Thematik der Kundenbewertungen im Online-Vertrieb ein und stellt die Relevanz des Themas im Kontext des digitalen Wettbewerbs heraus.
- Kapitel B gibt einen grundlegenden Überblick über die Entwicklung des Wettbewerbsrechts und die Funktionsweise von Kundenbewertungen im Online-Vertrieb.
- Kapitel C analysiert die wettbewerbsrechtlichen Problemfelder im Zusammenhang mit gefälschten und manipulierten Kundenbewertungen. Es beleuchtet verschiedene Arten von Missbrauch, wie z.B. das Filtern von Bewertungen, das Einsetzen von Fake-Bewertungen und die Incentivierung von Bewertungen.
- Kapitel D befasst sich mit der Haftungsfrage bei Bewertungsinhalten Dritter und analysiert die Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs (BGH) zu diesem Thema.
- Kapitel E beleuchtet das Einschreiten des Bundeskartellamts im Bereich der Kundenbewertungen.
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit befasst sich mit der wettbewerbsrechtlichen Untersuchung von Kundenbewertungen im Online-Vertrieb von Waren und Dienstleistungen, insbesondere im Bereich des Medien- und Wirtschaftsrechts. Die Arbeit analysiert die rechtlichen Rahmenbedingungen, die Herausforderungen und die Lösungsansätze im Umgang mit Kundenbewertungen im digitalen Zeitalter.
Zusammenfassung der Kapitel
Schlüsselwörter
Die zentralen Themen der Hausarbeit sind das Wettbewerbsrecht, Kundenbewertungen, Online-Vertrieb, Fake-Bewertungen, Manipulation, Incentivierung, rechtliche Rahmenbedingungen, Haftungsfragen, Bundeskartellamt, digitale Wirtschaft.
- Quote paper
- Anonym (Author), 2020, Kundenbewertungen beim Online-Vertrieb von Waren und Dienstleistungen. Eine wettbewerbsrechtliche Untersuchung, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/1289292