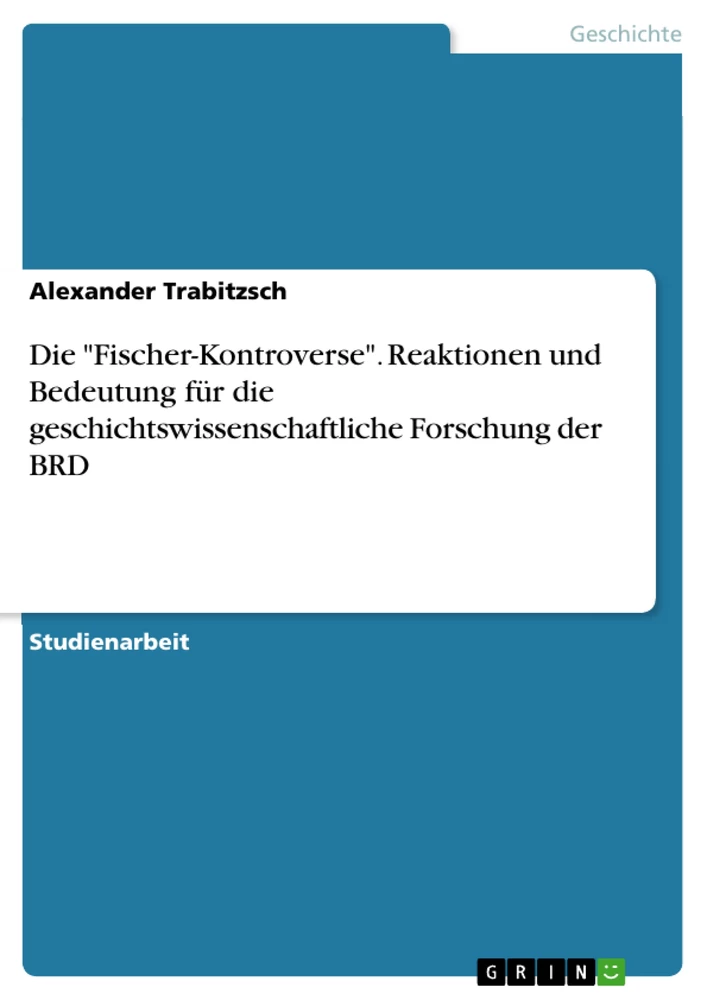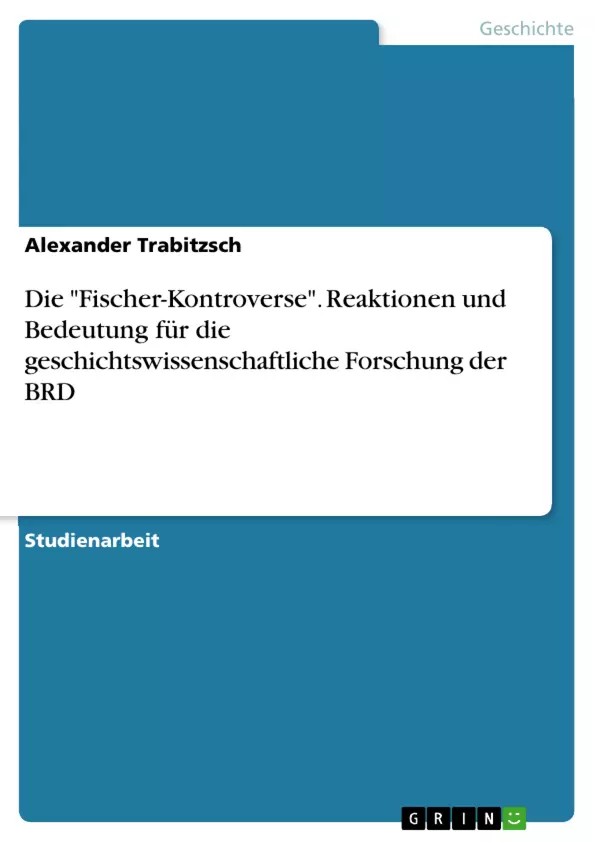Warum waren die Ansichten Fischers für die Deutschen und die geschichtswissenschaftliche Forschung in Deutschland von solcher Bedeutung? Wie gestaltete sich die Kontroverse und welche Argumente, dafür als auch dagegen, führten Historiker an? Und schließlich, was hat Fischer mit seinen, teils radikalen, Thesen wirklich bewirkt?
Anhand ausgewählter Quellen, primär Fischers einflussreichen Monographien "Der Griff nach der Weltmacht - Die Kriegszielpolitik des kaiserlichen Deutschland 1914/1918" und "Krieg der Illusionen - Die deutsche Politik 1911 bis 1914", wird die Arbeit versuchen, einige dieser Fragen hinreichend zu beantworten. In diesem Zusammenhang soll gleichsam, unter Berücksichtigung einflussreicher Reaktionen und Kritiker, die Fischer-Kontroverse und ihr Nachwirken für die deutsche Geschichtswissenschaft bis in die Gegenwart aufgezeigt, zusammengefasst und eingeordnet werden.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Die „Fischer-Kontroverse“
- 2.1. Zentrale Thesen Fritz Fischers
- 2.2. Reaktionen und Ursachen der Debatte
- 2.3. Fischer und seine fachwissenschaftlichen Kritiker
- 3. Gegenwärtige Bedeutung und Einordnung in die geschichtswissenschaftliche Forschung
- 4. Schlussbetrachtung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die „Fischer-Kontroverse“, die durch Fritz Fischers Thesen zur Kriegsschuld des Deutschen Reichs im Ersten Weltkrieg ausgelöst wurde. Es wird analysiert, warum diese Thesen eine so leidenschaftliche Debatte in der Öffentlichkeit und der Wissenschaft hervorriefen und welche Auswirkungen sie auf die deutsche Geschichtswissenschaft hatten.
- Analyse der zentralen Thesen Fritz Fischers zur Kriegsschuldfrage.
- Untersuchung der Reaktionen auf Fischers Thesen in der Öffentlichkeit und der Wissenschaft.
- Bewertung der Argumente für und gegen Fischers Interpretationen.
- Einordnung der „Fischer-Kontroverse“ in den Kontext der deutschen Geschichtswissenschaft.
- Bewertung des langfristigen Einflusses der Kontroverse auf die deutsche Kriegsschulddebatte.
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung legt den Fokus auf die Bedeutung von Fritz Fischers Werk und dessen Einfluss auf die deutsche Geschichtswissenschaft. Sie skizziert die Forschungsfrage – warum lösten Fischers Thesen eine so heftige und prominente Debatte aus? – und umreißt den methodischen Ansatz der Arbeit, der sich auf Fischers Monographien „Der Griff nach der Weltmacht“ und „Krieg der Illusionen“ stützt, um die zentralen Argumente zu analysieren und deren Rezeption in der deutschen Geschichtswissenschaft zu untersuchen. Die Einleitung deutet bereits an, dass die Arbeit die „Fischer-Kontroverse“ im Kontext einflussreicher Reaktionen und Kritik beleuchten wird, um ihr Nachwirken bis in die Gegenwart zu erfassen.
2. Die „Fischer-Kontroverse“: Dieses Kapitel führt in die „Fischer-Kontroverse“ ein, indem es den Begriff definiert und den historischen Kontext der Debatte in den 1960er Jahren um die Kriegsschuldfrage skizziert. Es dient als Brücke zu den folgenden Unterkapiteln, die sich vertieft mit Fischers Thesen, den Reaktionen darauf und der Auseinandersetzung mit seinen Kritikern befassen. Das Kapitel bereitet den Leser somit auf die detaillierte Analyse der zentralen Punkte und der Kontroverse vor, die in den nachfolgenden Abschnitten erfolgt.
2.1. Zentrale Thesen Fritz Fischers: Dieses Unterkapitel präsentiert die Kernaussagen von Fritz Fischers „Griff nach der Weltmacht“. Fischer argumentiert, dass das Deutsche Reich den Ersten Weltkrieg bewusst und gewollt plante und führte, und nicht, wie zuvor oft behauptet, in einen Verteidigungskrieg gezwungen wurde. Wichtige Beispiele werden angeführt, wie das Zurückhalten eines amerikanischen Friedensangebots und das Drängen auf Österreich, gegen Serbien vorzugehen. Das Kapitel analysiert Fischers Verwendung von Archivmaterial und seine Interpretationen der Ereignisse der Julikrise und des Septemberprogramms von 1914, um seine These von der deutschen Kriegsschuld zu untermauern.
Schlüsselwörter
Fritz Fischer, Erste Weltkrieg, Kriegsschulddebatte, „Fischer-Kontroverse“, deutsche Geschichtswissenschaft, Kriegszielpolitik, Julikrise, Septemberprogramm 1914, Präventivkrieg.
FAQ: Analyse der „Fischer-Kontroverse“
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit analysiert die „Fischer-Kontroverse“, die durch Fritz Fischers Thesen zur Kriegsschuld des Deutschen Reichs im Ersten Weltkrieg ausgelöst wurde. Im Fokus steht die Untersuchung der Gründe für die heftige öffentliche und wissenschaftliche Debatte und deren Auswirkungen auf die deutsche Geschichtswissenschaft.
Welche Themen werden behandelt?
Die Arbeit behandelt die zentralen Thesen Fritz Fischers, die Reaktionen darauf in Öffentlichkeit und Wissenschaft, die Bewertung der Argumente für und gegen Fischers Interpretationen, die Einordnung der Kontroverse in den Kontext der deutschen Geschichtswissenschaft und den langfristigen Einfluss der Kontroverse auf die deutsche Kriegsschulddebatte.
Welche Quellen werden verwendet?
Die Arbeit stützt sich auf Fritz Fischers Monographien „Der Griff nach der Weltmacht“ und „Krieg der Illusionen“, um die zentralen Argumente zu analysieren und deren Rezeption in der deutschen Geschichtswissenschaft zu untersuchen.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit gliedert sich in eine Einleitung, ein Kapitel zur „Fischer-Kontroverse“ mit Unterkapiteln zu Fischers Thesen, den Reaktionen und der Auseinandersetzung mit Kritikern, ein Kapitel zur gegenwärtigen Bedeutung und Einordnung in die geschichtswissenschaftliche Forschung und eine Schlussbetrachtung. Ein Inhaltsverzeichnis, eine Zusammenfassung der Kapitel und Schlüsselwörter sind ebenfalls enthalten.
Welche zentralen Thesen von Fritz Fischer werden untersucht?
Die Arbeit untersucht Fischers These, dass das Deutsche Reich den Ersten Weltkrieg bewusst und gewollt plante und führte, und nicht in einen Verteidigungskrieg gezwungen wurde. Dazu werden Beispiele wie das Zurückhalten eines amerikanischen Friedensangebots und das Drängen auf Österreich gegen Serbien analysiert.
Wie werden die Reaktionen auf Fischers Thesen behandelt?
Die Arbeit analysiert die Reaktionen auf Fischers Thesen sowohl in der Öffentlichkeit als auch in der Wissenschaft, um die Intensität und den Einfluss der Kontroverse zu beleuchten. Sie beleuchtet die Argumente der Kritiker und bewertet die Auseinandersetzung mit diesen.
Welche Bedeutung hat die „Fischer-Kontroverse“ für die deutsche Geschichtswissenschaft?
Die Arbeit untersucht die Einordnung der „Fischer-Kontroverse“ in den Kontext der deutschen Geschichtswissenschaft und bewertet ihren langfristigen Einfluss auf die deutsche Kriegsschulddebatte. Sie zeigt auf, wie die Kontroverse die Geschichtswissenschaft nachhaltig geprägt hat.
Welche Schlüsselwörter sind relevant für diese Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Fritz Fischer, Erster Weltkrieg, Kriegsschulddebatte, „Fischer-Kontroverse“, deutsche Geschichtswissenschaft, Kriegszielpolitik, Julikrise, Septemberprogramm 1914, Präventivkrieg.
- Quote paper
- Dipl. Geogr. Alexander Trabitzsch (Author), 2018, Die "Fischer-Kontroverse". Reaktionen und Bedeutung für die geschichtswissenschaftliche Forschung der BRD, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/1288225