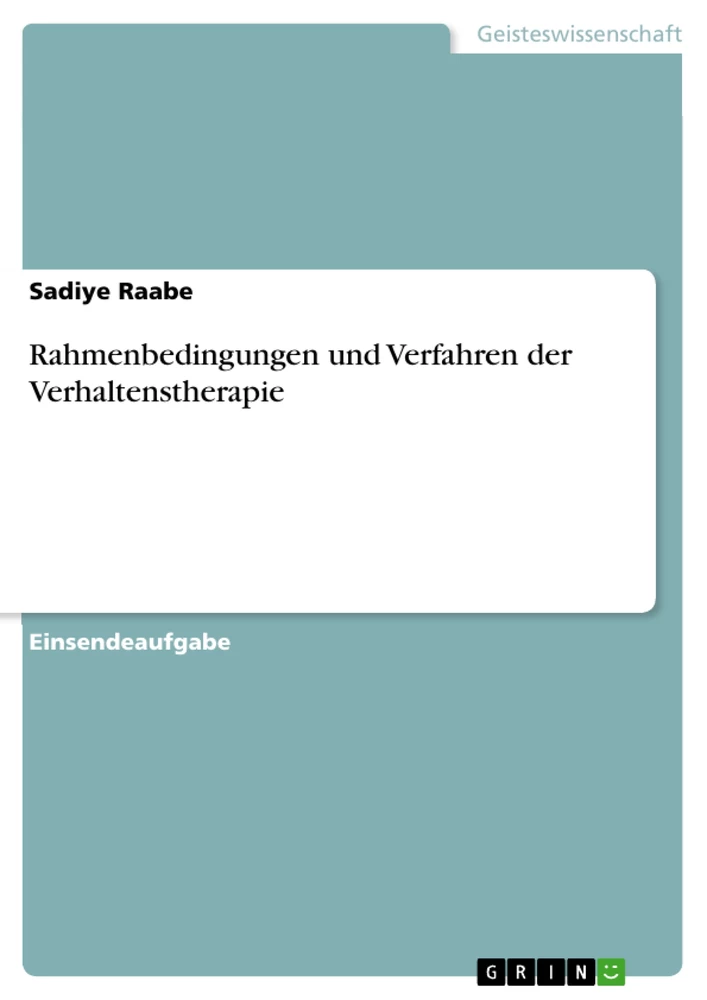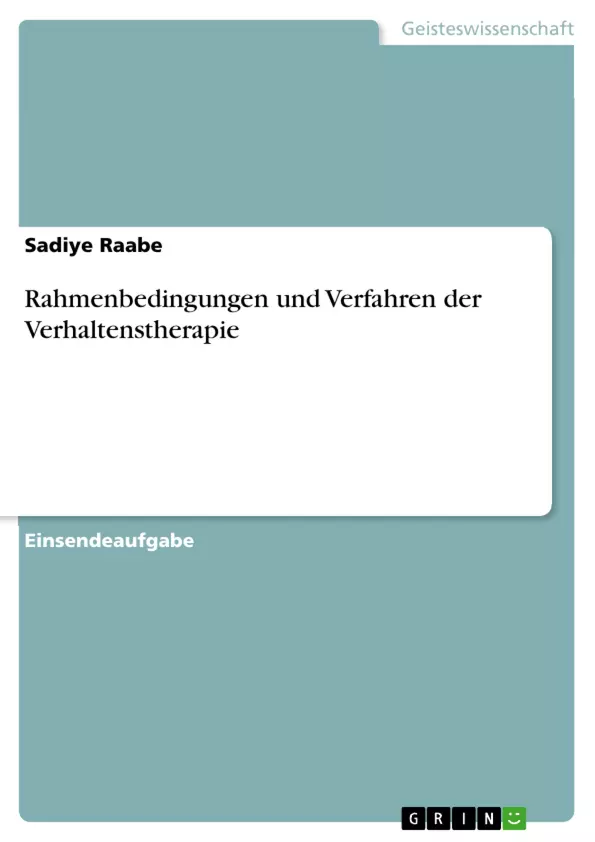In dieser Arbeit werden drei Teilbereiche aus "Rahmenbedingungen und Verfahren der Verhaltenstherapie" bearbeitet: Kunstfehler in der Psychotherapie, Horizontale Verhaltensanalyse nach dem SORKC-Modell, Anforderungen an eine Therapeut-Patient-Beziehung im Erstgespräch.
Inhaltsverzeichnis
- Kunstfehler in der Psychotherapie
- Einführung in unerwünschte negative Folgen der Psychotherapie
- Kunstfehler bzw. Behandlungsfehler
- Arten von Kunstfehlern
- Horizontale Verhaltensanalyse nach dem SORKC-Modell
- Lerntheoretischer Hintergrund der Verhaltensanalyse
- Einführung in die Verhaltensanalyse
- Verhaltensanalyse nach dem SORKC-Modell
- Vorgehen bei der horizontalen Verhaltensanalyse
- Fallbeispiel aus der Verhaltenstherapie
- Anlass der Behandlung und Symptombericht des Patienten
- Resümee aus dem Fallbeispiel
- Horizontale Verhaltensanalyse nach dem SORKC-Modell
- Therapeut-Patient-Beziehung im Erstgespräch
- Einführung in die Therapeut-Patient-Beziehung und das Erstgespräch
- Therapeutische Beziehung als Wirkfaktor
- Ablauf eines Erstgesprächs
- Allgemeine Anforderungen an das Erstgespräch
- Ziele & Ansprüche des Therapeuten im Erstgespräch
- Ziele & Ansprüche des Patienten im Erstgespräch
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit befasst sich mit den Rahmenbedingungen und Verfahren der Verhaltenstherapie. Sie analysiert die Problematik von Kunstfehlern in der Psychotherapie, die horizontale Verhaltensanalyse nach dem SORKC-Modell und die Bedeutung der Therapeut-Patient-Beziehung im Erstgespräch. Dabei werden theoretische Grundlagen und praktische Anwendungsmöglichkeiten beleuchtet.
- Kunstfehler in der Psychotherapie und ihre Ursachen
- Das SORKC-Modell als Instrument der Verhaltensanalyse
- Die Rolle der Therapeut-Patient-Beziehung im Erstgespräch
- Die Relevanz von fachlichen Standards in der Psychotherapie
- Die Bedeutung ethischen Verhaltens in der therapeutischen Praxis
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel beschäftigt sich mit der Thematik der Kunstfehler in der Psychotherapie. Es wird ein Systematik von negativen Effekten von Psychotherapie vorgeschlagen und die verschiedenen Kategorien von unerwünschten Therapieeffekten erläutert. Im Fokus steht die Definition und Abgrenzung von Kunstfehlern bzw. Behandlungsfehlern als negative Therapiefolgen einer inkorrekt durchgeführten Therapie.
Das zweite Kapitel widmet sich der horizontalen Verhaltensanalyse nach dem SORKC-Modell. Es werden die lerntheoretischen Grundlagen dieser Analysemethode vorgestellt und deren Anwendung anhand eines Fallbeispiels aus der Verhaltenstherapie veranschaulicht. Die Kapitel beleuchtet die verschiedenen Elemente des Modells (S, O, R, K, C) und erklärt deren Bedeutung für die Analyse und Intervention von Verhaltensproblemen.
Das dritte Kapitel befasst sich mit der Therapeut-Patient-Beziehung im Erstgespräch. Es werden die Bedeutung der therapeutischen Beziehung als Wirkfaktor sowie der Ablauf eines Erstgesprächs erläutert. Zudem werden die allgemeinen Anforderungen an das Erstgespräch aus Sicht des Therapeuten und des Patienten analysiert und wichtige Aspekte des Erstgesprächs beleuchtet.
Schlüsselwörter
Die Arbeit fokussiert auf die Schlüsselwörter: Kunstfehler, Behandlungsfehler, Verhaltenstherapie, Verhaltensanalyse, SORKC-Modell, Therapeut-Patient-Beziehung, Erstgespräch, fachliche Standards, ethische Prinzipien, Psychotherapie.
- Quote paper
- Sadiye Raabe (Author), 2021, Rahmenbedingungen und Verfahren der Verhaltenstherapie, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/1287985