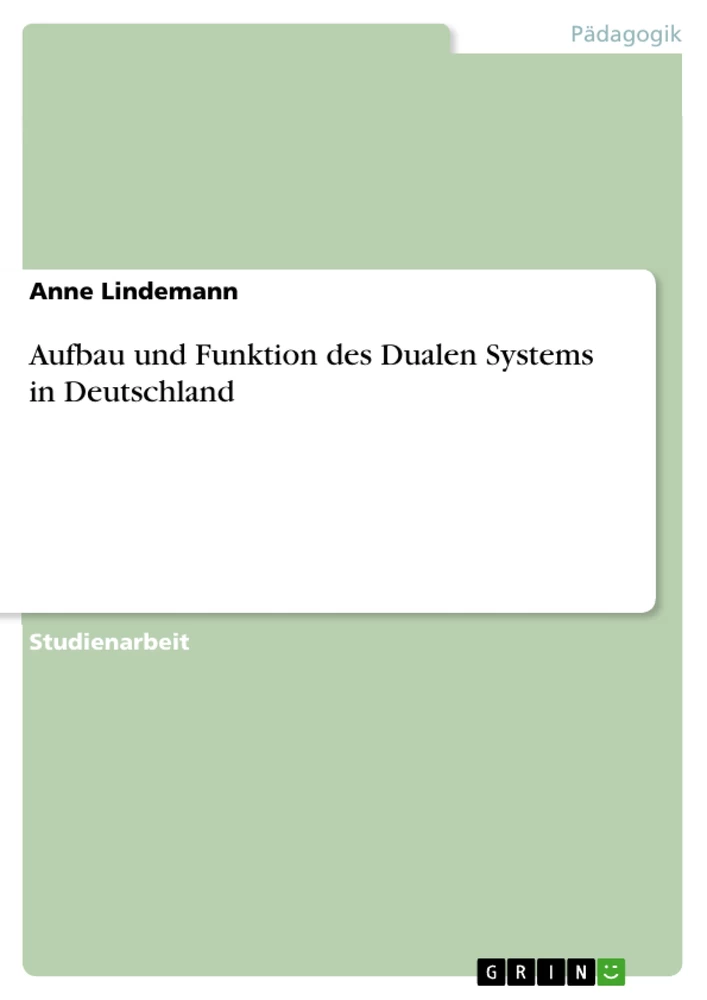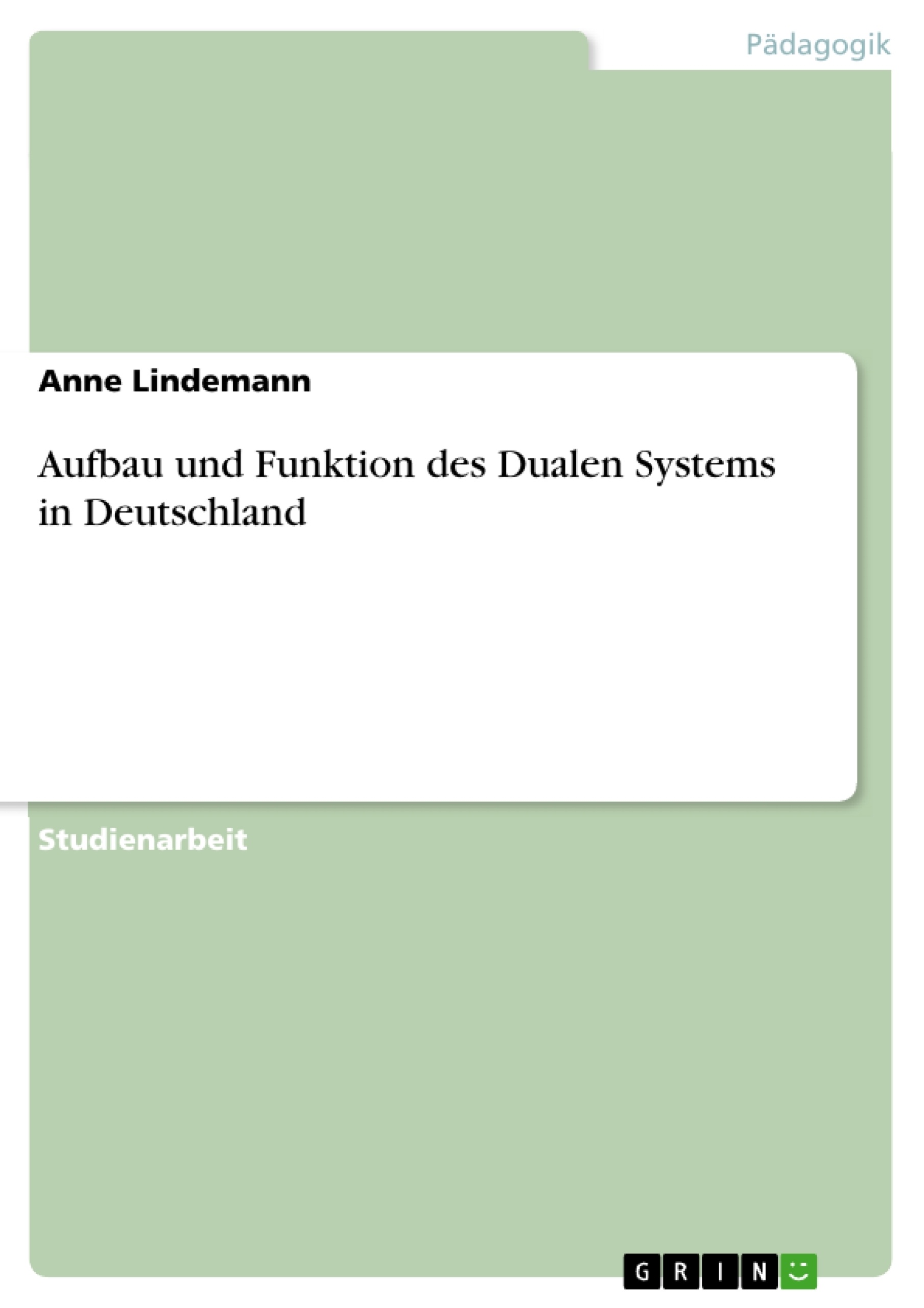Die Veränderungen in den letzten zwei Jahrzehnten werden umgangssprachlich häufig als digitale Revolution bezeichnet. Auch die Arbeitswelt muss sich diesen Veränderungen anpassen, sie mittragen und teilweise auch vorantreiben. Diese Schnelligkeit der Veränderungen wird es in den nächsten Jahren immer wieder notwendig machen, auch die berufliche Ausbildung zu verändern, anzupassen, sich von veralteten Berufen zu verabschieden und neue zu erschaffen.
Um diesen Prozess besser verstehen zu können, lohnt ein Blick in die Geschichte – zurück zu einer vorangegangenen Revolution, die ebenfalls einen einschneidenden Wendepunkt in der Arbeitswelt mit sich brachte. Folgend wird daher die Entstehung der heutigen Berufsausbildung in ihrem Dualen System näher beleuchtet.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Historischer Abriss zur Entstehung des Dualen Systems
- Die Zünfte als Vorreiter der beruflichen Ausbildung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit befasst sich mit der Entstehung des dualen Ausbildungssystems in Deutschland. Sie verfolgt das Ziel, die historischen Wurzeln und Entwicklungen aufzuzeigen, die zu diesem Modell führten. Dabei werden die Herausforderungen und Chancen beleuchtet, die sich aus der digitalen Revolution für die berufliche Bildung ergeben.
- Die Entwicklung des dualen Systems von den Zünften bis zur heutigen Zeit
- Die Rolle der Zünfte im Mittelalter als Vorläufer des dualen Systems
- Die Bedeutung des Theorie-Praxis-Transfers in der Ausbildung
- Die Bedeutung der überbetrieblichen Ausbildung für die Kompetenzen der Auszubildenden
- Der Einfluss des christlichen Glaubens auf die Zünfte und die berufliche Bildung
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung
Die Einleitung führt in die Thematik der digitalen Revolution und deren Auswirkungen auf die Arbeitswelt ein. Sie betont die Notwendigkeit, die berufliche Ausbildung an die sich verändernden Anforderungen anzupassen.
Historischer Abriss zur Entstehung des Dualen Systems
Dieses Kapitel beleuchtet die Entstehung des dualen Ausbildungssystems in Deutschland. Es wird die Rolle der Zünfte als Vorläufer des dualen Systems im Mittelalter dargestellt. Der Fokus liegt auf der Entwicklung des Theorie-Praxis-Transfers im Laufe der Geschichte und der Bedeutung der überbetrieblichen Ausbildung.
Die Zünfte als Vorreiter der beruflichen Ausbildung
In diesem Kapitel werden die Zünfte als kartellartige Zusammenschlüsse von Handwerksbetrieben im Mittelalter vorgestellt. Es werden die Bedeutung der Zünfte für die Ausbildung und die Sozialisation der Lehrlinge sowie deren Einfluss auf die gesellschaftlichen Normen und Werte des Standes beschrieben.
Schlüsselwörter
Zünfte, duales System, berufliche Ausbildung, Theorie-Praxis-Transfer, überbetriebliche Ausbildung, digitale Revolution, mittelalterliche Gesellschaft, Handwerker, Ausbildungsrahmenplan, Sozialisation, Standeszugehörigkeit, christlichen Glauben.
- Arbeit zitieren
- Anne Lindemann (Autor:in), 2022, Aufbau und Funktion des Dualen Systems in Deutschland, München, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/1287078