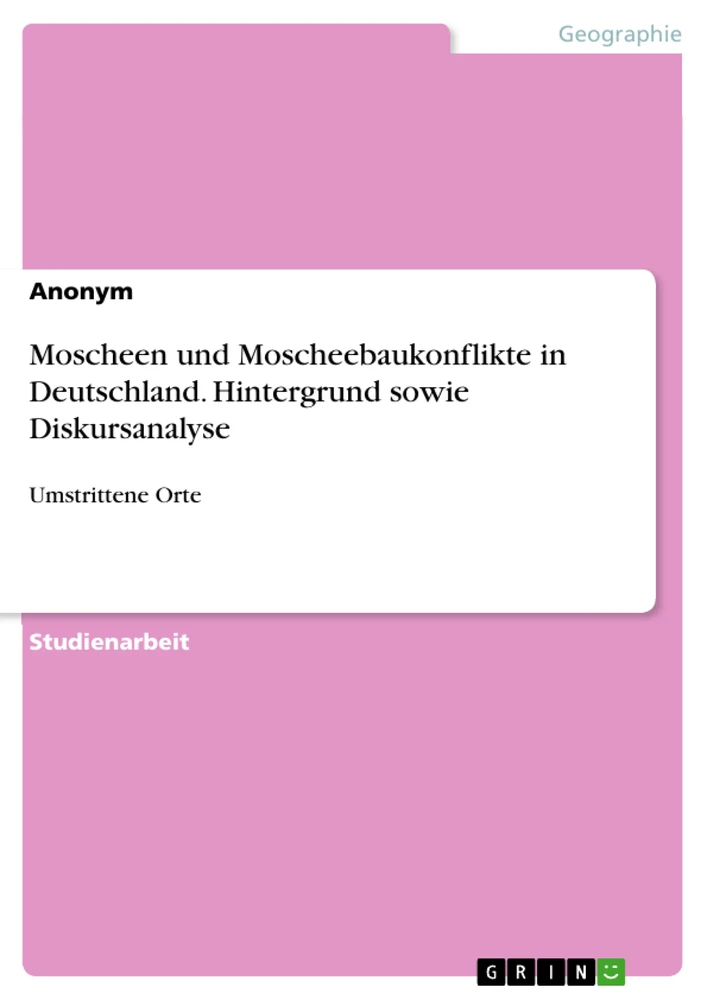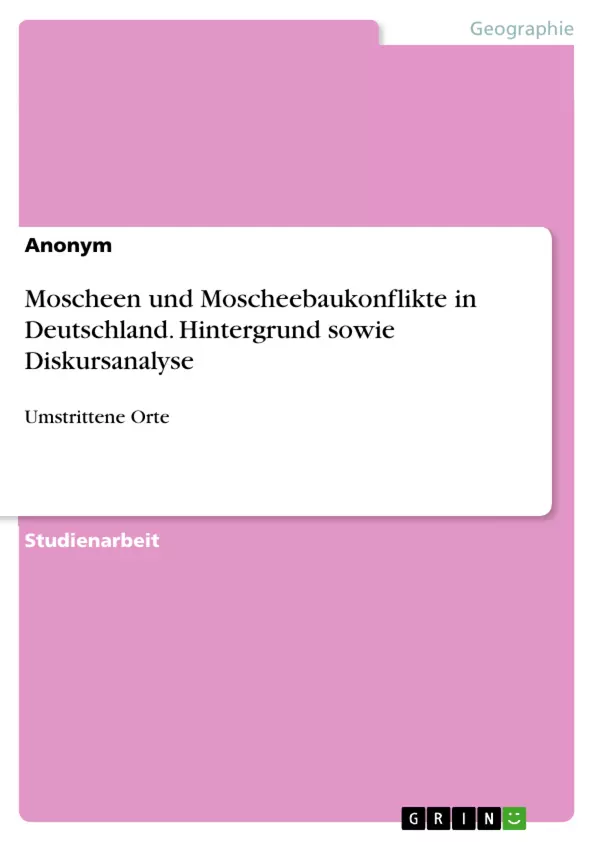In der Arbeit werden Moscheen als umstrittene Orte näher betrachtet. Vorerst müssen diesbezüglich einige Begrifflichkeiten geklärt werden. Hierzu wird die Moschee zunächst definiert und ihre Bedeutung für Muslime aufgezeigt. Um ein besseres Verständnis für die Thematik zu erzeugen, ist es zu Beginn der Arbeit ebenfalls notwendig, das Konzept einer Moschee zu erläutern von ihrer Geschichte, über die Architektur bis hin zur Funktion.
Nach diesen allgemeinen Erläuterungen wird die Lage von Moscheen in Deutschland näher betrachtet. Dabei ist es wichtig, die Entwicklungen der Moscheen in Deutschland von ihren Anfängen bis zum heutigen Sachstand darzulegen. Dabei wird auch gezeigt, wie die Moscheen innerhalb Deutschlands räumlich verteilt sind und weshalb Moscheen ein so großes Konfliktpotenzial besitzen.
Anschließend werden Moscheebaukonflikte im Allgemeinen betrachtet. Dabei werden die beteiligten Akteure dargestellt, die Probleme in der Kommunikation aufzeigt, Lösungsansätze vorgestellt und zuletzt die Folgen geschildert, die solche Konflikte nach sich ziehen können.
Dies wird dann an zwei empirischen Beispielen konkretisiert, um die unterschiedlichen Verläufe solcher Konflikte aufzuzeigen. Zum einen wird Bobingen als positives Beispiel für den Bau einer Moschee vorgestellt und zum anderen Mörfelden-Walldorf als Negativbeispiel eines solchen Konflikts.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Die Moschee
- 2.1. Definition
- 2.2. Geschichte
- 2.3. Architektur und Ausstattung
- 2.4. Funktion
- 3. Moscheen in Deutschland
- 3.1. Historischer Abriss
- 3.2. Sachstand heute
- 3.3. Räumliche Verteilung
- 3.4. Moscheen als Konfliktherd
- 4. Moscheebaukonflikte
- 4.1. Akteure
- 4.2. Perspektive Mensch
- 4.3. Kommunikation
- 4.4. Lösungsansätze
- 4.5. Folgen
- 4.6. Konfliktebenen (vgl. Schmitt 2003)
- 5. Empirische Beispiele
- 5.1. Bobingen (vgl. Schmitt 2003)
- 5.2. Mörfelden-Walldorf (vgl. Beinhauer-Köhler & Leggewie 2009)
- 6. Zusammenfassung und Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit untersucht die Moschee als umstrittenen Ort in Deutschland und beleuchtet den Diskurs rund um ihren Bau. Im Mittelpunkt steht die Analyse der Konflikte, die sich im Zuge des Baus von Moscheen ergeben, sowie die Betrachtung verschiedener Perspektiven und Lösungsansätze.
- Die Bedeutung der Moschee als Sakralbau im Islam
- Die Entwicklung des Moscheebaus in Deutschland
- Die räumliche Verteilung von Moscheen in Deutschland
- Die Ursachen und Folgen von Moscheebaukonflikten
- Die Rolle der Kommunikation und der beteiligten Akteure
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in das Thema „Umstrittene Orte – der Diskurs zum Bau von Moscheen in Deutschland“ ein und skizziert die Problematik der Moscheen als Konfliktfeld in der deutschen Gesellschaft. Das zweite Kapitel beschäftigt sich mit der Moschee als Sakralbau und beleuchtet ihre Definition, Geschichte, Architektur und Funktion. Im dritten Kapitel wird der Fokus auf die Entwicklung von Moscheen in Deutschland gelegt, inklusive einer Betrachtung der räumlichen Verteilung und der Konfliktpotenziale. Kapitel vier analysiert Moscheebaukonflikte im Allgemeinen und betrachtet dabei die beteiligten Akteure, die Kommunikationsprobleme, Lösungsansätze und Folgen solcher Konflikte. Abschließend werden in Kapitel fünf zwei empirische Beispiele für Moscheebaukonflikte vorgestellt, eines mit positivem (Bobingen) und eines mit negativem (Mörfelden-Walldorf) Ausgang.
Schlüsselwörter
Moschee, Moscheebau, Diskurs, Konflikt, Integration, Islamisierung, Parallelwelten, Terrorismus, Akteure, Kommunikation, Lösungsansätze, Bobingen, Mörfelden-Walldorf.
Häufig gestellte Fragen
Warum kommt es in Deutschland oft zu Moscheebaukonflikten?
Ursachen sind oft Ängste vor einer "Islamisierung", Sorgen um die lokale Identität, Lärmbelästigung oder mangelnde Kommunikation zwischen Gemeinde und Anwohnern.
Welche Funktionen hat eine Moschee neben dem Gebet?
Sie dient als soziales Zentrum, Ort für Bildung, Beratung und interkulturellen Austausch innerhalb der muslimischen Gemeinschaft.
Was sind erfolgreiche Lösungsansätze für solche Konflikte?
Frühzeitige Transparenz, Tage der offenen Tür, Einbeziehung der Lokalpolitik und ein offener Dialog können Vorurteile abbauen.
Was zeigt das Beispiel Bobingen?
Bobingen gilt als Positivbeispiel, bei dem durch gute Kommunikation und Integration ein harmonischer Moscheebau gelang.
Welche Rolle spielt die Architektur bei Moscheebaukonflikten?
Sichtbare Symbole wie Minarette oder Kuppeln werden oft als politisches Statement wahrgenommen und lösen stärkere Kontroversen aus als unscheinbare Hinterhofmoscheen.
- Quote paper
- Anonym (Author), 2020, Moscheen und Moscheebaukonflikte in Deutschland. Hintergrund sowie Diskursanalyse, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/1285429