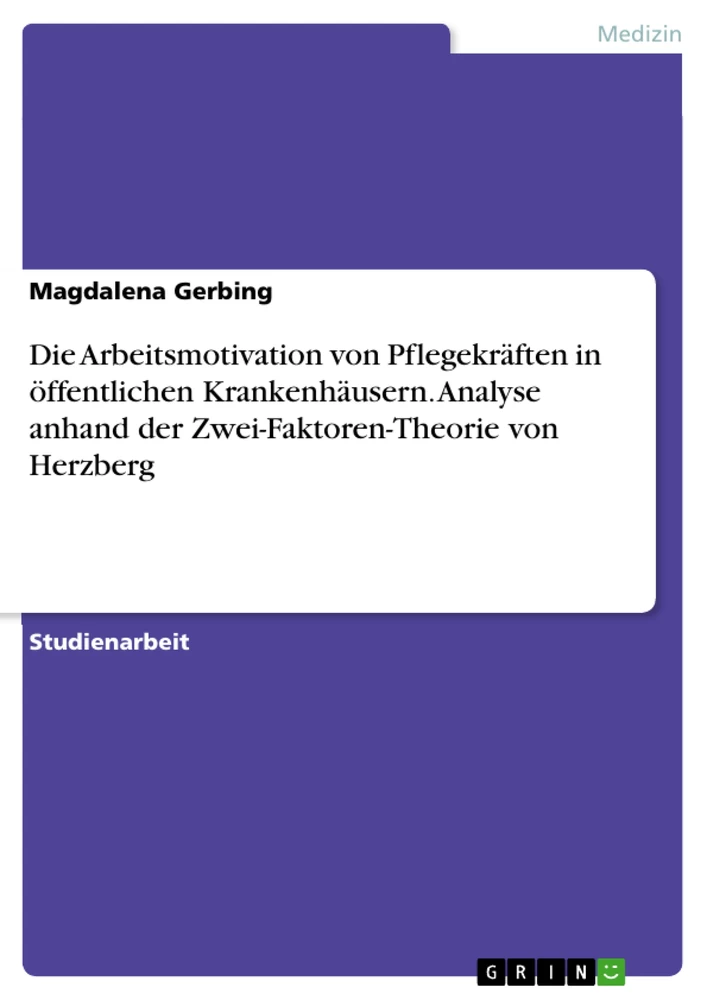Ziel der Arbeit ist es, Faktoren zu ermitteln, die zum einen zur Arbeitszufriedenheit von Pflegekräften beitragen, zum anderen Faktoren identifizieren, die zu Unzufriedenheit führen. Das Zwei-Faktoren-Modell von F. Herzberg (1959) dient hierfür als Grundlage. Die Leitfrage der Arbeit ist dabei, welche Faktoren zur Arbeitsmotivation von Pflegekräften in öffentlichen Einrichtungen beitragen.
Um eine Antwort auf diese Frage zu erhalten, werden zuerst die Grundlagen, die dem Verständnis der Zwei-Faktoren-Theorie dienen, erklärt. Dazu zählen die Begriffe Motiv und Motivation, wobei zwischen der intrinsischen und der extrinsischen Motivation unterschieden wird.
Kaum ein Beruf ist so sehr auf motivierte, engagierte und zufriedene Angestellte angewiesen, wie der Pflegeberuf. Dies wurde besonders durch den Ausbruch des Coronavirus Anfang März 2020 auf Deutschlands Intensivstationen sichtbar. Seit Beginn der Pandemie wird in den Medien fast täglich über Pflegekräftemangel, fehlendes Fachpersonal auf Intensivstationen und Bettenschließungen berichtet.
Prognosen zeigen auf, dass im Jahre 2035 rund 307.000 Pflegekräfte in Deutschland fehlen werden. Diese Zahlen verdeutlichen, dass dringender Handlungsbedarf besteht. Die Pflege muss attraktiver gestaltet werden, um die Fluktuation des Personals zu verhindern und neue Pflegekräfte zu gewinnen.
Inhaltsverzeichnis
- 1 Einleitung
- 2 Motive und Motivation
- 2.1 Extrinsische Motivation
- 2.2 Intrinsische Motivation
- 3 Zwei-Faktoren-Theorie nach Herzberg
- 3.1 Pittsburgh-Studie
- 3.2 Hygienefaktoren und Motivatoren
- 4 Arbeitsbedingungen in Pflegeberufen im öffentlichen Dienst
- 5 Arbeitszufriedenheit in der Pflege und übertrag auf die Zwei-Faktoren-Theorie
- 6 Kritik an der Theorie von Herzberg
- 7 Ausblick: Möglichkeiten zur Steigerung der Arbeitsmotivation in der Pflege
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit zielt darauf ab, Faktoren zu identifizieren, die zur Arbeitszufriedenheit von Pflegekräften beitragen, sowie Faktoren, die zu Unzufriedenheit führen. Die Zwei-Faktoren-Theorie von F. Herzberg dient als Grundlage für die Analyse. Die Leitfrage der Arbeit ist, welche Faktoren die Arbeitsmotivation von Pflegekräften in öffentlichen Einrichtungen beeinflussen.
- Bedeutung von Motivation im Pflegeberuf
- Einflussfaktoren auf die Arbeitszufriedenheit von Pflegekräften
- Anwendung der Zwei-Faktoren-Theorie von Herzberg
- Analyse von Hygienefaktoren und Motivatoren in der Pflege
- Möglichkeiten zur Steigerung der Arbeitsmotivation in der Pflege
Zusammenfassung der Kapitel
- Kapitel 1: Einleitung: Die Einleitung beleuchtet die Bedeutung von motivierten und engagierten Pflegekräften und stellt die Problematik des Pflegekräftemangels in Deutschland dar. Sie benennt die Zielsetzung der Arbeit und die Leitfrage.
- Kapitel 2: Motive und Motivation: Dieses Kapitel erläutert die grundlegenden Konzepte von „Motiven“ und „Motivation“ und unterscheidet zwischen intrinsischer und extrinsischer Motivation.
- Kapitel 3: Zwei-Faktoren-Theorie nach Herzberg: Das Kapitel stellt die Zwei-Faktoren-Theorie von Herzberg vor, die auf der Pittsburgh-Studie basiert. Es werden die Hygienefaktoren und Motivatoren im Kontext der Theorie erläutert.
- Kapitel 4: Arbeitsbedingungen in Pflegeberufen im öffentlichen Dienst: Hier werden die Arbeitsbedingungen in Pflegeberufen im öffentlichen Dienst betrachtet.
- Kapitel 5: Arbeitszufriedenheit in der Pflege und übertrag auf die Zwei-Faktoren-Theorie: In diesem Kapitel werden Faktoren, die zur Arbeitszufriedenheit bzw. Unzufriedenheit in Pflegeberufen führen, untersucht. Es wird der Zusammenhang zur Zwei-Faktoren-Theorie hergestellt.
- Kapitel 6: Kritik an der Theorie von Herzberg: Dieses Kapitel beleuchtet kritische Punkte der Zwei-Faktoren-Theorie von Herzberg.
Schlüsselwörter
Arbeitsmotivation, Pflegekräfte, Zwei-Faktoren-Theorie, Hygienefaktoren, Motivatoren, Arbeitszufriedenheit, Arbeitsbedingungen, Pflegeberuf, öffentliche Einrichtungen, extrinsische Motivation, intrinsische Motivation, Pittsburgh-Studie, Fluktuation.
- Quote paper
- Magdalena Gerbing (Author), 2022, Die Arbeitsmotivation von Pflegekräften in öffentlichen Krankenhäusern. Analyse anhand der Zwei-Faktoren-Theorie von Herzberg, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/1284644