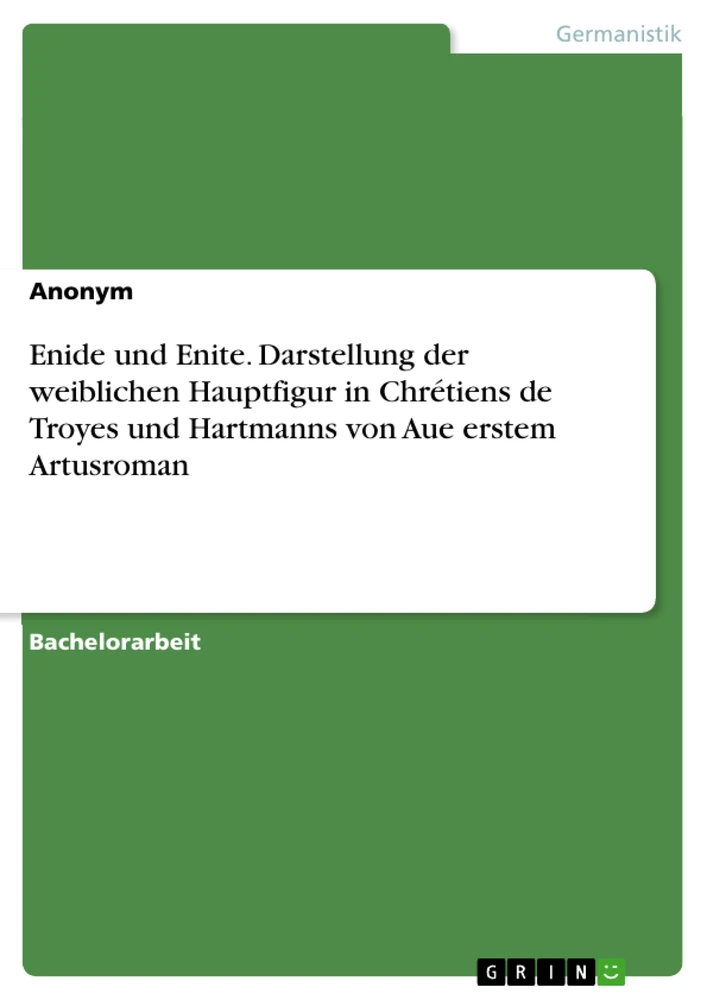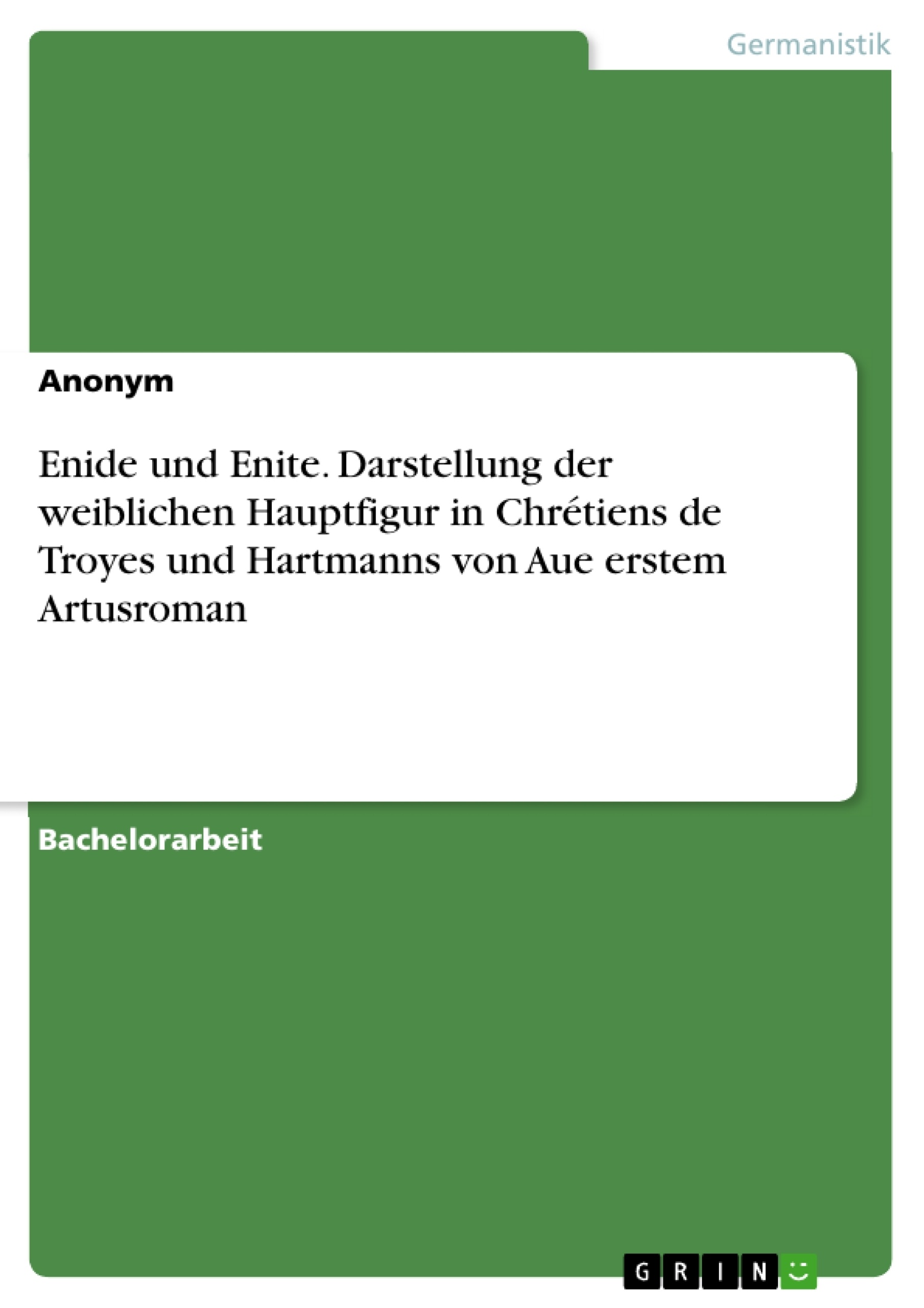Das Ziel dieser Arbeit ist es, die Gemeinsamkeiten und Unterschiede in der Darstellung der beiden Protagonistinnen zunächst darzulegen und die möglichen Auswirkungen anschließend mithilfe ausgewählter Textstellen und unter folgenden Fragestellungen zu interpretieren: In welchem Maß und auf welche Art und Weise greift Hartmann in die textuelle Vorlage ein? Welche konkreten Veränderungen werden vorgenommen? Inwiefern wirken sich die Bearbeitungen auf die Szenen und somit auch auf die Figur der Enite aus?
Ȇrec von Hartmann von Aue gilt als erster deutscher Arturoman seiner Zeit und entstand um kurz nach 1180. In dieser Blütezeit der höfischen Dichtung weisen vor allem die Artusromane besondere Beliebtheit bei den Rezipienten auf. Neben den hohen formalen Ansprüchen sind es insbesondere die dort thematisierten höfischen Werte und Normen eines angepriesenen Gesellschaftsideals nach dem Vorbild Frankreichs, die vom damaligen Publikum positiv rezipiert werden. Diese Romane sind ein Spiegel des Rittertums und der Hofgesellschaft, sie beschreiben und bewerten die in den Artusromanen vorgestellten Tugenden.
Der Erec ist in der wissenschaftlichen Forschung ein oft behandelter und analysierter Gegenstand, der unterschiedlichste Interpretationsansätze zu den divergierenden Themen des Romans zulässt. Lange fokussierte sich die Forschung dabei vor allem auf die männliche Hauptfigur Erec, doch rückt seit den letzten zwei Jahrzehnten die Protagonistin Enite in den Vordergrund. Auch in der vorliegenden Arbeit soll sich mit der Enite-Figur beschäftigt werden. Entsprechend soll auch in der vorliegenden Arbeit Enite in den analytischen Mittelpunkt gesetzt werden, indem die Figur vor dem Hintergrund der französischen Vorlage untersucht wird. Denn Hartmann adaptiert die materia des französischen Dichters "Chrétien de Troyes", dessen arturischer Roman den Titel Erec et Enide trägt. Hartmann bearbeitet künstlerisch die Vorlage "Chrétiens" und nimmt dabei Veränderungen in der Gestaltung seiner Figuren vor, so auch bei seiner Protagonistin Enite.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Zum Forschungsstand
- Das Verständnis mittelalterlicher Dichtkunst
- Enites erster Auftritt vor der Tafelrunde – Analyse, Interpretation und Vergleich
- Die Bedeutung und Auswirkung des verligen bei Hartmann und Chrétien – Analyse, Interpretation und Vergleich
- Aufbruch, Schweigegebot und der Räuberkampf – Analyse, Interpretation und Vergleich
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit analysiert die Darstellung der weiblichen Hauptfigur Enite in Chrétiens de Troyes und Hartmanns von Aues erstem Artusroman "Erec et Enide" bzw. "Erec". Sie untersucht die Gemeinsamkeiten und Unterschiede in der Darstellung beider Figuren und betrachtet dabei Hartmanns Bearbeitungen der Vorlage Chrétiens. Die Arbeit analysiert ausgewählte Szenen mit Enite und untersucht die Auswirkungen von Hartmanns Bearbeitungen auf die Figur.
- Vergleich der Darstellung der Enite-Figur in Chrétiens und Hartmanns Romanen
- Analyse von Hartmanns Bearbeitungen der Vorlage Chrétiens
- Interpretation der Auswirkungen von Hartmanns Bearbeitungen auf die Enite-Figur
- Einblick in mittelalterliche Dichtkunst und ihre Techniken
- Betrachtung von Enites Rolle als Heldin und ihre Beziehung zu Erec
Zusammenfassung der Kapitel
- Einleitung: Diese Einleitung führt den Leser in die Thematik der Arbeit ein, stellt den Forschungsstand dar und benennt die wichtigsten Fragestellungen. Sie betont die Relevanz von Enite als Figur und die Bedeutung des Vergleichs mit der französischen Vorlage Chrétiens.
- Das Verständnis mittelalterlicher Dichtkunst: Dieses Kapitel erläutert die relevanten Aspekte der mittelalterlichen Dichtkunst, insbesondere die Prinzipien der Dilatatio materiae und des „Wiedererzählens und Übersetzens“. Diese Prinzipien bilden die Grundlage für das Verständnis der späteren Szenenanalyse.
- Enites erster Auftritt vor der Tafelrunde – Analyse, Interpretation und Vergleich: Dieses Kapitel analysiert den ersten Auftritt von Enite in beiden Romanen und untersucht, wie sie dargestellt wird und welche Techniken Hartmann anwendet, um seine Figur zu gestalten.
- Die Bedeutung und Auswirkung des verligen bei Hartmann und Chrétien – Analyse, Interpretation und Vergleich: Dieses Kapitel analysiert die Szene des verligen, die für beide Figuren eine Krisensituation darstellt. Es beleuchtet die Unterschiede in der Gestaltung dieser Szene durch die beiden Autoren.
- Aufbruch, Schweigegebot und der Räuberkampf – Analyse, Interpretation und Vergleich: Dieses Kapitel untersucht die Szene des Räuberkampfes, wobei der Fokus auf die erste Räuberbegegnung liegt. Es soll gezeigt werden, wie Enite in dieser Situation agiert und welche Auswirkungen Hartmanns Bearbeitungen auf die Figur haben.
Schlüsselwörter
Die Arbeit beschäftigt sich mit der Darstellung der weiblichen Hauptfigur Enite in zwei Artusromanen. Sie konzentriert sich auf den Vergleich der Figuren in Chrétiens de Troyes' "Erec et Enide" und Hartmanns von Aues "Erec". Die Schlüsselwörter umfassen dabei die Figuren Enide und Enite, die Bearbeitungsstrategien Hartmanns, die mittelalterliche Dichtkunst, die höfischen Werte und Normen, das verligen sowie die Analyse der Darstellung und Rolle von Enite im Kontext der Handlung und der Beziehung zu Erec.
- Quote paper
- Anonym (Author), 2021, Enide und Enite. Darstellung der weiblichen Hauptfigur in Chrétiens de Troyes und Hartmanns von Aue erstem Artusroman, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/1283197