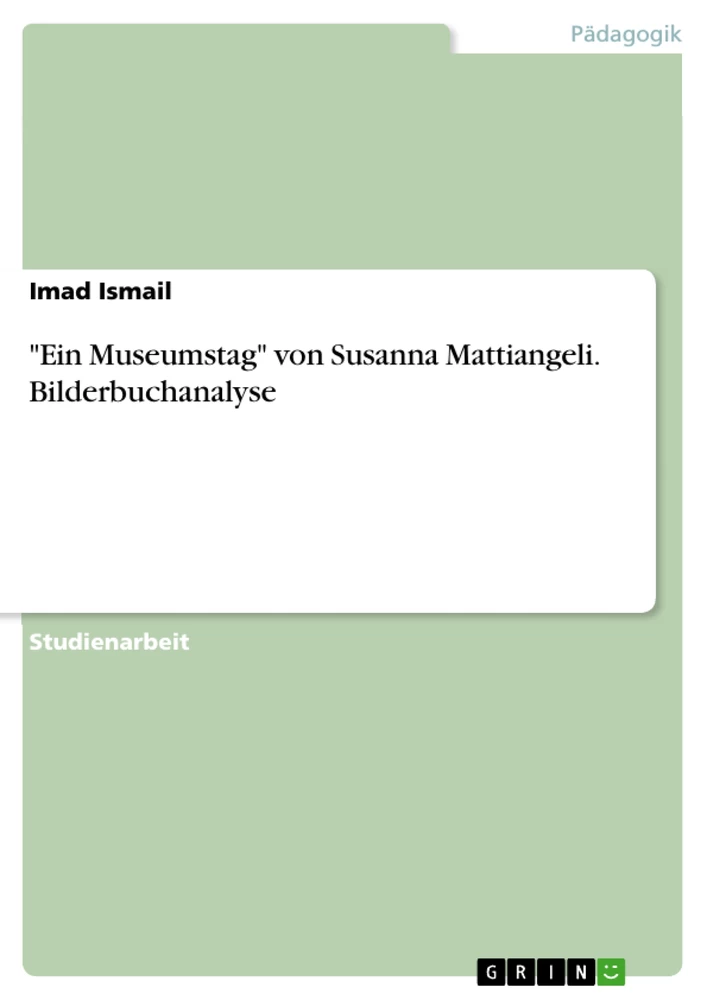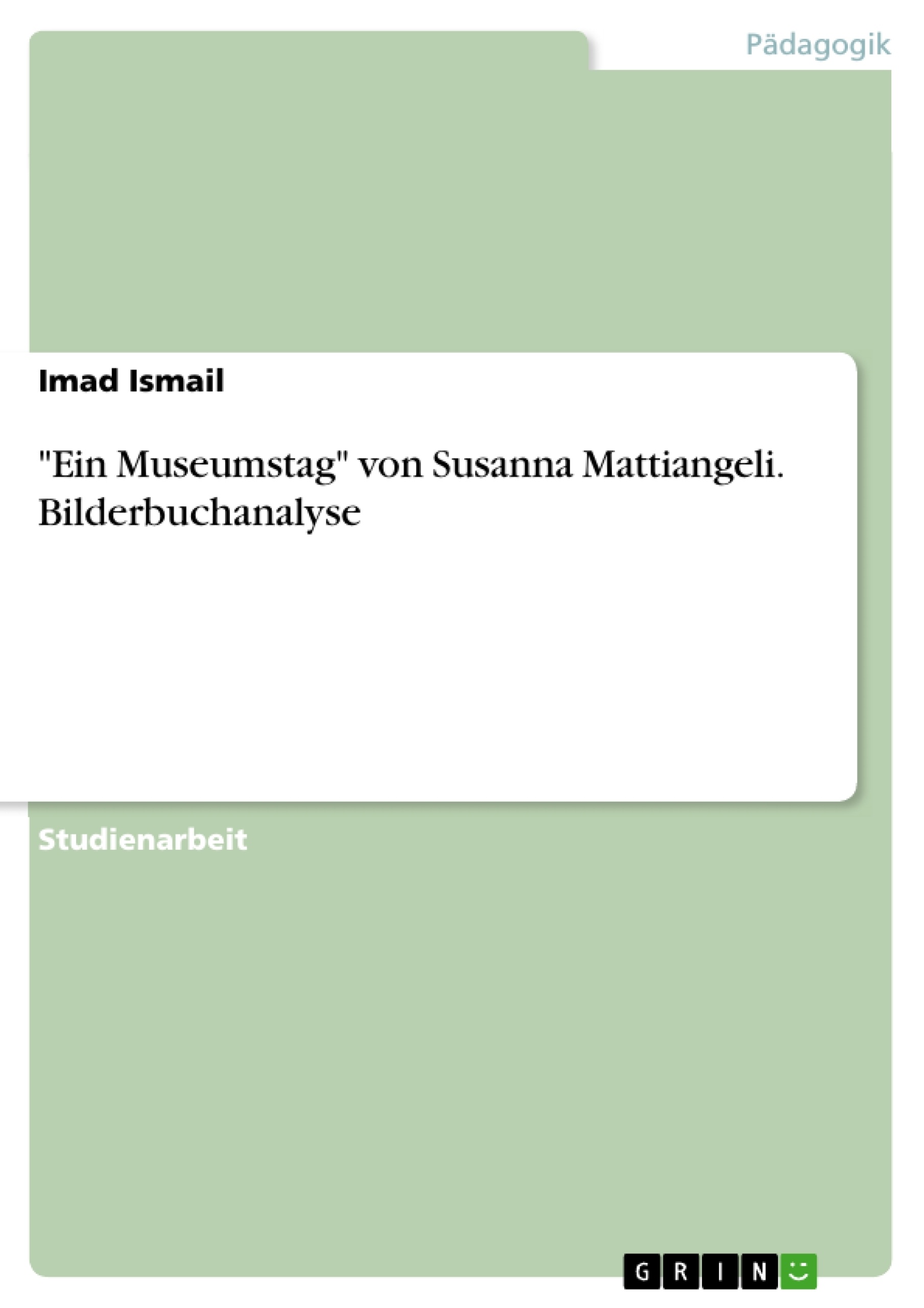Im Folgenden soll eine mehrdimensionale Analyse anhand des Bilderbuchs «Ein Museumstag», geschrieben von Susanna Mattiangeli und illustriert von Vessela Nikolova, anhand des fünfdimensionalen Modells der Bilderbuchanalyse von Michael Staiger und in Anlehnung an die drei grundlegenden Kriterien von Bettina Hurrelmann (Ästhetik – Leser*innenbezug -Wirkung) durchgeführt werden. Das Bilderbuch wurde 2021 vom Bohem Verlag in Münster veröffentlicht und für den Deutschen
Jugendliteraturpreis 2022 von der Kritikerjury in der Sparte Bilderbuch nominiert.
Inhaltsverzeichnis
- Der Deutsche Jugendliteraturpreis
- Einführung in das Buch „Ein Museumstag“.
- Darstellung der für den Praxisteil ausgewählten Gegenstände
- Das Bilderbuch.
- Eine Doppelseite..
- Praxisbezogener Teil: Zwei innovative Vorschläge für die Produktive Bearbeitung im Unterricht
- Betrachten und Vorlesen...
- Handlungs- und produktionsorientierte Aufgaben.
- Szenische Interpretation ..
- Malen und Museumsrundgang.
- Fazit.
- Literaturverzeichnis..
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit analysiert das Bilderbuch „Ein Museumstag“ von Susanna Mattiangeli und Vessela Nikolova, das für den Deutschen Jugendliteraturpreis 2022 nominiert wurde. Ziel ist es, das Buch anhand des fünfdimensionalen Modells der Bilderbuchanalyse von Michael Staiger und den Kriterien von Bettina Hurrelmann (Ästhetik – Leser*innenbezug – Wirkung) zu untersuchen.
- Analyse der narrativen, verbalen, bildlichen, intermodalen und paratextuellen Dimensionen des Buches
- Bedeutung der Ästhetik, des Leser*innenbezugs und der Wirkung des Buches
- Untersuchung des Themas, der Figuren, der Handlung und der Zeitdarstellung
- Beurteilung der Wortauswahl, des Satzbaus und der Textgestaltung
- Analyse des Zusammenspiels von Bild und Text
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel befasst sich mit dem Deutschen Jugendliteraturpreis, seiner Geschichte und seinen Zielen. Das zweite Kapitel bietet eine Einführung in das Bilderbuch „Ein Museumstag“ und stellt die wichtigsten analytischen Dimensionen nach Staiger vor. Das dritte Kapitel geht detailliert auf das Bilderbuch selbst ein, betrachtet die Gestaltung der Titelseite, das Buchformat und die Gestaltung des Inhalts.
Schlüsselwörter
Bilderbuchanalyse, Deutscher Jugendliteraturpreis, Susanna Mattiangeli, Vessela Nikolova, Michael Staiger, Bettina Hurrelmann, Ästhetik, Leser*innenbezug, Wirkung, Museum, Kunstgeschichte, Intermodalität, Paratext, Buchformat, Illustrationen
Häufig gestellte Fragen
Worum geht es in dem Bilderbuch „Ein Museumstag“?
Das Buch von Susanna Mattiangeli beschreibt den Besuch eines Kindes im Museum und verknüpft dabei Alltagsbeobachtungen mit Kunstgeschichte.
Nach welchem Modell wird das Bilderbuch analysiert?
Die Analyse erfolgt nach dem fünfdimensionalen Modell von Michael Staiger (narrativ, verbal, bildlich, intermodal, paratextuell).
Welche Rolle spielen die Kriterien von Bettina Hurrelmann?
Sie dienen der Untersuchung der Ästhetik, des Leserbezugs und der Wirkung des Buches auf Kinder.
Gibt es Vorschläge für den Einsatz im Unterricht?
Ja, die Arbeit enthält innovative Vorschläge wie szenische Interpretationen oder das Malen eines eigenen Museumsrundgangs.
War das Buch für einen Preis nominiert?
Ja, „Ein Museumstag“ wurde für den Deutschen Jugendliteraturpreis 2022 in der Sparte Bilderbuch nominiert.
- Arbeit zitieren
- Imad Ismail (Autor:in), 2023, "Ein Museumstag" von Susanna Mattiangeli. Bilderbuchanalyse, München, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/1283193