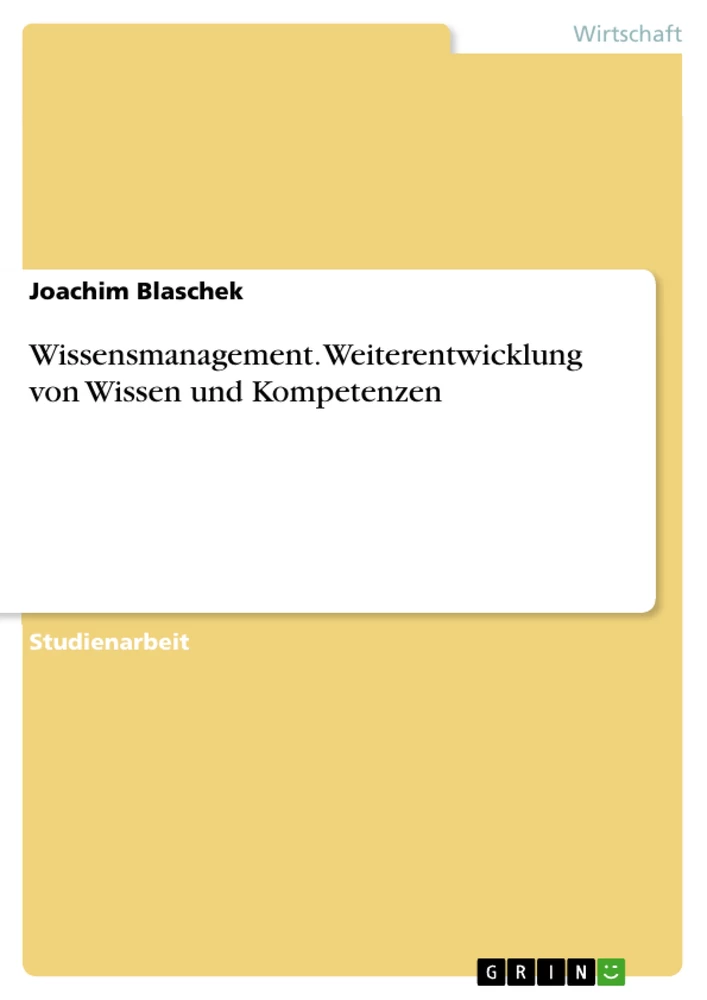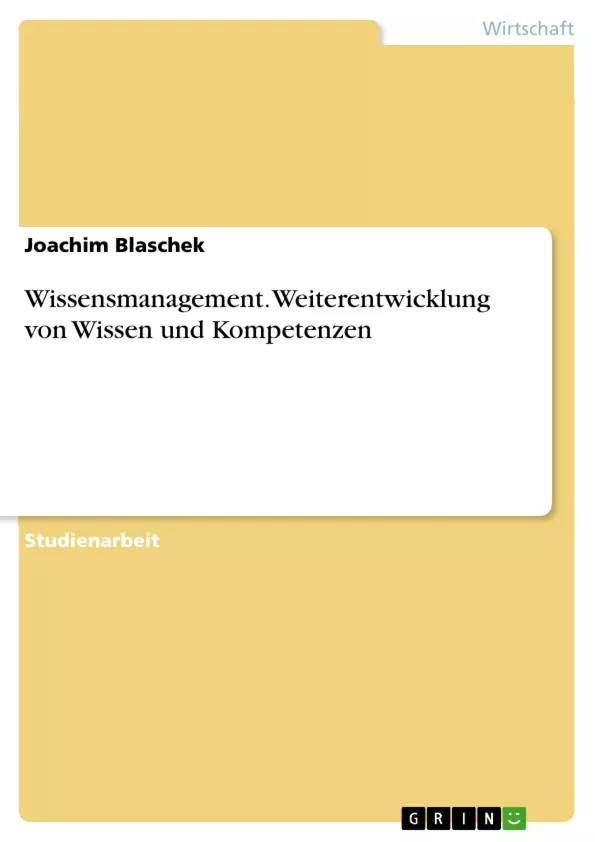Diese Seminararbeit befasst sich mit Wissensmanagement am Beispiel des Unternehmens Daimler Trucks & Buses AG. Im ersten Kapitel werden komprimiert die Entstehung von Wissensmanagement sowie Ansätze des Wissensmanagements vorgestellt.
Die Entwicklung des Wissensmanagements geht bis in die 1970er Jahre zurück. Zu dieser Zeit richtete sich der Fokus der Informationsversorgung auf leitende Führungskräfte, die ausschließlich am Entscheidungsprozess beteiligt waren. In den 1980er Jahren hielten die Ausdrücke Wissensmanagement und explizites Wissen Einzug in die organisationspsychologische Literatur und waren Mittelpunkt für Management- und Führungsaufgaben. Wissen wird meist dokumentenbasiert ausgetauscht. Es wird auch vom Wissensmanagement der ersten Generation gesprochen und häufig als Kodifizierung bezeichnet.
Mitte der 1990er Jahre erweiterte sich der Schwerpunkt des Wissensmanagements als strategische Fähigkeit. Sie beinhaltete das Verständnis, sowohl soziale als auch organisatorische Aspekte in das Wissensmanagement einzubeziehen. Wissen wird, anders als bei der Kodifizierung, als Prozess betrachtet. Dieser Entwicklungsschritt beschreibt das Wissensmanagement der zweiten Generation, welches auch als Personalisierung bekannt ist.
Das Wissensmanagement der dritten Generation wird als ganzheitlicher Prozess betrachtet. Mitarbeiter*innen erhalten Rahmenbedingungen, in denen sie die Möglichkeit haben, Wissen zu generieren und zu verteilen, um dadurch die Unternehmensziele effizienter und effektiver erreichen zu können (Sozialisierung). Dieses Modell wird oft auch als sogenannte Kontextsteuerung bezeichnet.
Inhaltsverzeichnis
- EINLEITUNG: WAS IST WISSENSMANAGEMENT
- ENTSSTEHUNG DES WISSENSMANAGEMENTS
- ANSATZ VON NONAKA
- ANSATZ VON PROBST, RAUB UND ROMHARDT
- WISSENSMANAGEMENT HEUTE
- VORSTELLUNG: DAIMLER TRUCK AG
- FÜHRUNGSKULTUR BEI DER DAIMLER AG BZW. DAIMLER TRUCK AG
- KERNKOMPETENZEN
- WISSENSMANAGEMENT
- ZUSAMMENFASSUNG
- UMSETZUNG: WEITERENTWICKLUNG WISSEN UND KOMPETENZEN
- ZIELSETZUNG
- HERAUSFORDERUNGEN
- AUSGANGSSITUATION
- STRATEGIE
- PROJEKTABLAUF- UND MEILENSTEINPLAN
- ZUSAMMENFASSUNG
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Seminararbeit befasst sich mit dem Thema Wissensmanagement im Kontext der Daimler Truck AG. Ziel ist es, die Entstehung und Entwicklung des Wissensmanagements aufzuzeigen, verschiedene Ansätze und Modelle zu beleuchten und die praktische Umsetzung des Wissensmanagements im Unternehmen zu analysieren.
- Entwicklung des Wissensmanagements
- Verschiedene Ansätze zum Wissensmanagement
- Praxisbeispiele für Wissensmanagement in Unternehmen
- Herausforderungen und Chancen des Wissensmanagements
- Strategien zur Weiterentwicklung von Wissen und Kompetenzen
Zusammenfassung der Kapitel
- Kapitel 1: Einleitung
Dieses Kapitel gibt einen Überblick über die Entstehung und Entwicklung des Wissensmanagements, beleuchtet verschiedene Ansätze wie das SECI-Modell nach Nonaka und das TOM-Modell, und skizziert die Bedeutung des Wissensmanagements in der heutigen Zeit.
- Kapitel 2: Vorstellung: Daimler Truck AG
Dieses Kapitel stellt die Daimler Truck AG vor, beleuchtet die Führungskultur des Unternehmens und analysiert die Kernkompetenzen und das Wissensmanagement in der Praxis.
- Kapitel 3: Umsetzung: Weiterentwicklung Wissen und Kompetenzen
Dieses Kapitel fokussiert sich auf die Herausforderungen und Chancen der Weiterentwicklung von Wissen und Kompetenzen innerhalb des Unternehmens. Es skizziert eine Strategie zur Umsetzung des Wissensmanagements und präsentiert einen Projekt- und Meilensteinplan.
Schlüsselwörter
Die Seminararbeit beschäftigt sich mit den zentralen Themen Wissensmanagement, Unternehmenskultur, Führung, Kompetenzen, Strategien, Projektmanagement und Praxisbeispiele.
- Quote paper
- Joachim Blaschek (Author), 2021, Wissensmanagement. Weiterentwicklung von Wissen und Kompetenzen, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/1282372