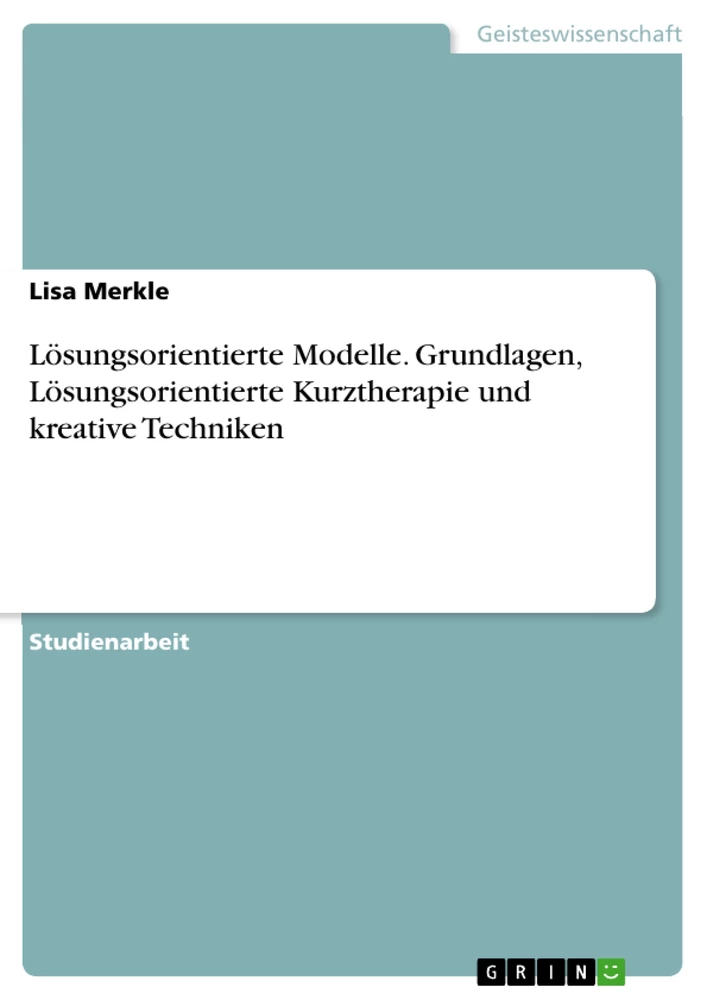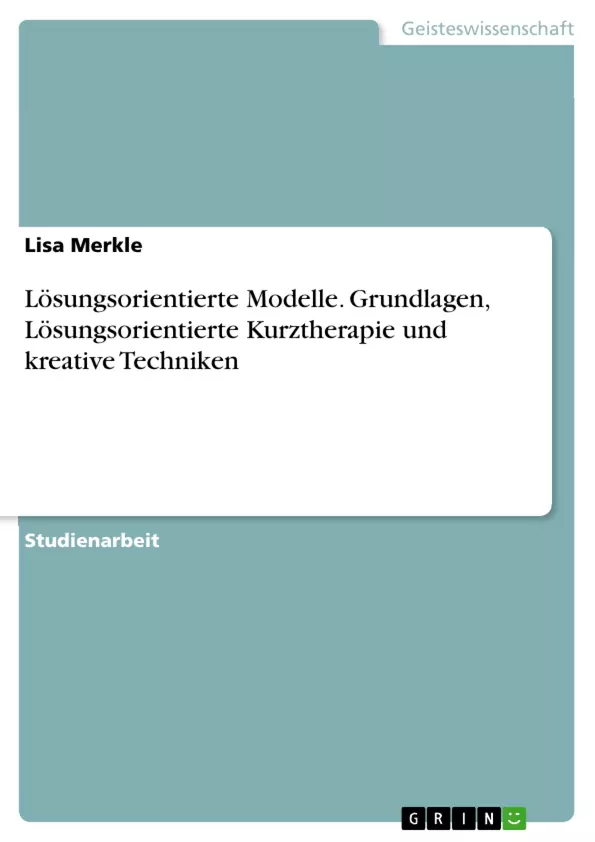In klassischen pädagogisch-psychologischen Therapieansätzen steht der Störungsbegriff oftmals im Fokus der Aufmerksamkeit; in der Verhaltenstherapie wird beispielsweise stark störungsspezifisch interveniert. Lösungsorientierte Modelle, die stark mit den Inhalten der systemischen Therapie verknüpft sind, stellen den Menschen in seinem Systemgefüge in den Mittelpunkt. Der Therapeut fungiert als Berater seines Klienten, der die Gestaltung seines Lebens selbst in die Hand nehmen soll. Dabei spielt die Sprache zur Erschaffung von Wirklichkeit und Problemlösungen eine elementare Rolle.
Zunächst wird die Entstehungsgeschichte der Systemischen Therapie und der lösungsorientierten Modelle beschrieben. Nachfolgend werden die theoretischen Grundprinzipien systemischer Ansätze behandelt. Das Wissen über Konstruktivismus, Systeme, Kybernetik, Komplexität und Zirkularität ist grundlegend, um praxisorientierte Interventionen
lösungsorientierter Modelle erfassen und anwenden zu können. Anschließend wird auf ein bekanntes Modell, das der Lösungsorientierten Kurztherapie, eingegangen. Den Abschluss bildet das Kapitel über die Möglichkeiten kreative Techniken, in den ansonsten stark sprachorientierten Ansatz mit einzubeziehen. Diese Techniken scheinen, nach Erfahrung der Autorin, gut geeignet für die Arbeit mit Menschen mit einer geistigen Behinderung. Dadurch bekommt auch das Berufsfeld und das persönliche Interesse der Autorin Raum in dieser Arbeit.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- 1. Entstehungsgeschichte
- 2. Grundprinzipien lösungsorientierter Modelle
- 2.1 Konstruktivismus
- 2.2 Systeme
- 2.2.1 Autopoetische Systeme
- 2.2.2 Das Systemgefüge
- 2.3 Kybernetik
- 2.4 Zirkularität und Komplexität
- 3. Lösungsorientierte Kurztherapie
- 3.1 Lehrsätze
- 3.2 Therapeutische Prinzipien und Techniken
- 3.2.1 Ressourcenaktivierung in der Kunsttherapie
- 3.2.2 Perspektiventwicklung in der Kunsttherapie
- 3.2.3 Problembewältigung in der Kunsttherapie
- 4. Kreative Techniken
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit befasst sich mit lösungsorientierten Modellen und deren Anwendung in der Praxis. Der Fokus liegt dabei auf der Verbindung zwischen systemischer Therapie und lösungsorientierten Ansätzen, insbesondere der Lösungsfokussierten Kurztherapie. Ziel ist es, die grundlegenden Prinzipien und Techniken dieser Modelle zu beleuchten und deren Relevanz für die Arbeit mit Menschen mit geistiger Behinderung aufzuzeigen.
- Entstehungsgeschichte und Entwicklung der Systemischen Therapie
- Grundprinzipien der systemischen Therapie, wie Konstruktivismus, Systeme, Kybernetik und Zirkularität
- Anwendungsbereiche und Techniken der Lösungsfokussierten Kurztherapie
- Einbindung kreativer Techniken in den lösungsorientierten Ansatz, insbesondere für Menschen mit geistiger Behinderung
- Relevanz von Ressourcenaktivierung, Perspektiventwicklung und Problembewältigung in der Kunsttherapie
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in das Thema lösungsorientierter Modelle ein und stellt den Kernpunkt der Arbeit dar: die Verbindung zwischen systemischem Denken und lösungsfokussierter Therapie. Es werden die Stärken und Schwächen klassischer Therapieansätze gegenübergestellt und der Fokus auf die Selbststeuerung des Klienten durch den Therapeuten als Berater gelegt.
Kapitel 1 befasst sich mit der Entstehungsgeschichte der Systemischen Therapie. Es wird der Wandel vom fokussierten Blick auf das Individuum hin zur Betrachtung des Systems beschrieben, wodurch neue Denkansätze entstanden sind. Die Entwicklung der Familientherapie als Basis für die Systemische Therapie wird detailliert erläutert.
Kapitel 2 widmet sich den Grundprinzipien der systemischen Therapie. Konstruktivismus, Systeme, Kybernetik, Zirkularität und Komplexität werden als wichtige Grundlage für das Verständnis und die Anwendung von lösungsorientierten Interventionen beleuchtet.
Kapitel 3 befasst sich mit der Lösungsfokussierten Kurztherapie (SFBT) und ihren Lehrsätzen, therapeutischen Prinzipien und Techniken. Es werden die Entstehung der SFBT, ihre Wurzeln und die empirische Entstehung des Konzepts vorgestellt.
Kapitel 4 beleuchtet die Integration kreativer Techniken in den lösungsorientierten Ansatz, insbesondere für Menschen mit geistiger Behinderung. Die Anwendung von Kunsttherapie-Techniken zur Ressourcenaktivierung, Perspektiventwicklung und Problembewältigung wird fokussiert.
Schlüsselwörter
Die Arbeit befasst sich mit zentralen Konzepten wie Systemischem Denken, Lösungsorientierter Kurztherapie, Konstruktivismus, Kybernetik, Ressourcenaktivierung, Perspektiventwicklung, Problembewältigung und Kunsttherapie im Kontext der Arbeit mit Menschen mit geistiger Behinderung.
- Arbeit zitieren
- Lisa Merkle (Autor:in), 2012, Lösungsorientierte Modelle. Grundlagen, Lösungsorientierte Kurztherapie und kreative Techniken, München, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/1280204