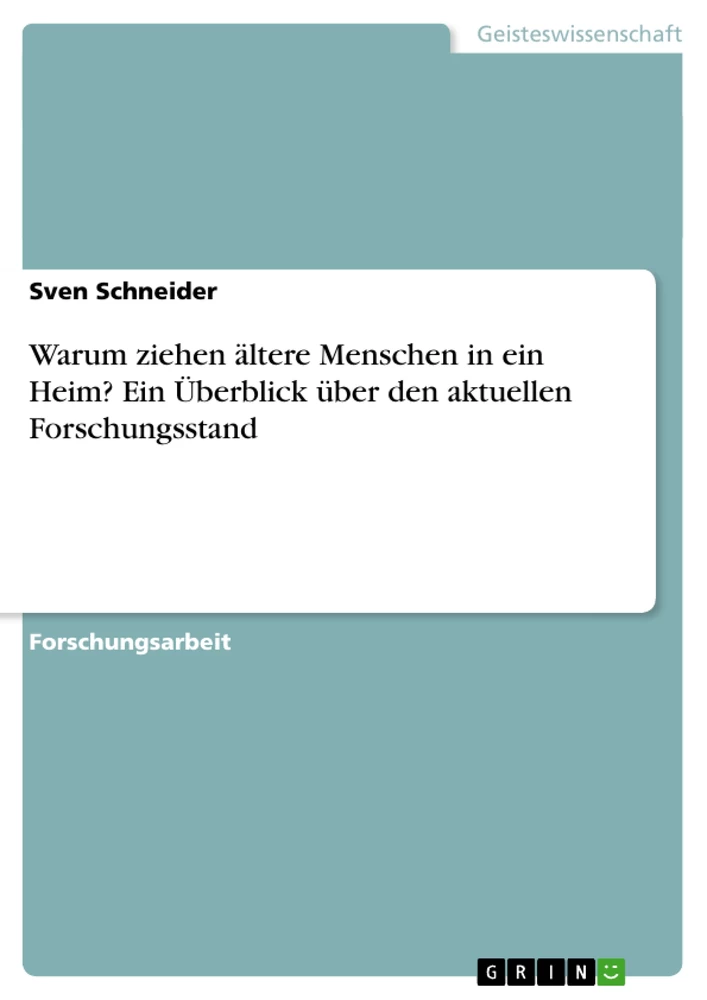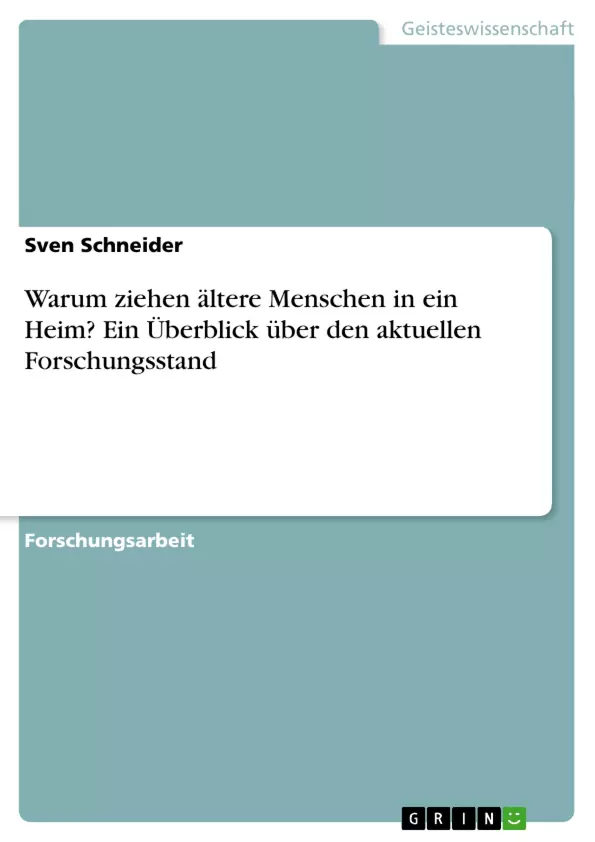Welche Ursachen und Lebensumstände bewegen einen alten Menschen zu dem Entschluß, in ein Heim zu ziehen und welche subjektiven Beweggründe geben alte Menschen dabei an? Lassen sich Prädiktoren ausmachen, anhand derer sich die Bevölkerungsgruppen in Privathaushalten und in Heimen unterscheiden lassen?
Inhaltsverzeichnis
- Soziale Probleme und soziologische Chancen
- Institutionalisierungsquote und Institutionalisierungsrate
- Der Forschungsstand zum Problem des Heimeintrittes
- Institutionalisierungsquote und Institutionalisierungsrate
- Subjektive Umzugsgründe
- Objektive Umzugsgründe
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Der Text untersucht die Gründe, warum ältere Menschen in ein Alten- und Pflegeheim ziehen. Der Fokus liegt dabei auf dem aktuellen Forschungsstand und den soziologischen Aspekten dieses Prozesses.
- Die wachsende Bedeutung des Themas Heimeintritt im Kontext der demografischen Alterung
- Das Forschungsdefizit bezüglich Heimeintritt in der BRD im Vergleich zu den USA
- Die Unterscheidung zwischen objektiven und subjektiven Gründen für den Heimeintritt
- Die Rolle der Institutionalisierungsquote und -rate im Kontext des Themas
- Die Bedeutung der soziologischen Perspektive auf den Heimeintrittsprozess
Zusammenfassung der Kapitel
Soziale Probleme und soziologische Chancen
Dieses Kapitel behandelt die Bedeutung des Themas Heimeintritt im Kontext der demografischen Alterung der deutschen Gesellschaft. Es beleuchtet die Notwendigkeit für wissenschaftliche Forschung in diesem Bereich und hebt die Relevanz der soziologischen Perspektive hervor.
Der Forschungsstand zum Problem des Heimeintrittes
Dieses Kapitel bietet einen Überblick über den aktuellen Forschungsstand zum Heimeintritt älterer Menschen. Es behandelt die Institutionalisierungsquote und -rate, die Bedeutung dieser Kennzahlen und ihre Interpretation im Kontext des Themas. Es werden außerdem die beiden Kategorien der subjektiven und objektiven Gründe für den Heimeintritt vorgestellt.
Schlüsselwörter
Die zentralen Themen des Textes sind die demografische Alterung, der Heimeintritt älterer Menschen, die Institutionalisierungsquote und -rate, subjektive und objektive Gründe für den Heimeintritt, soziologische Perspektiven und Forschungsdefizite im Bereich der Heimeintrittforschung.
- Arbeit zitieren
- Privatdozent Dr. Sven Schneider (Autor:in), 1998, Warum ziehen ältere Menschen in ein Heim? Ein Überblick über den aktuellen Forschungsstand, München, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/12797