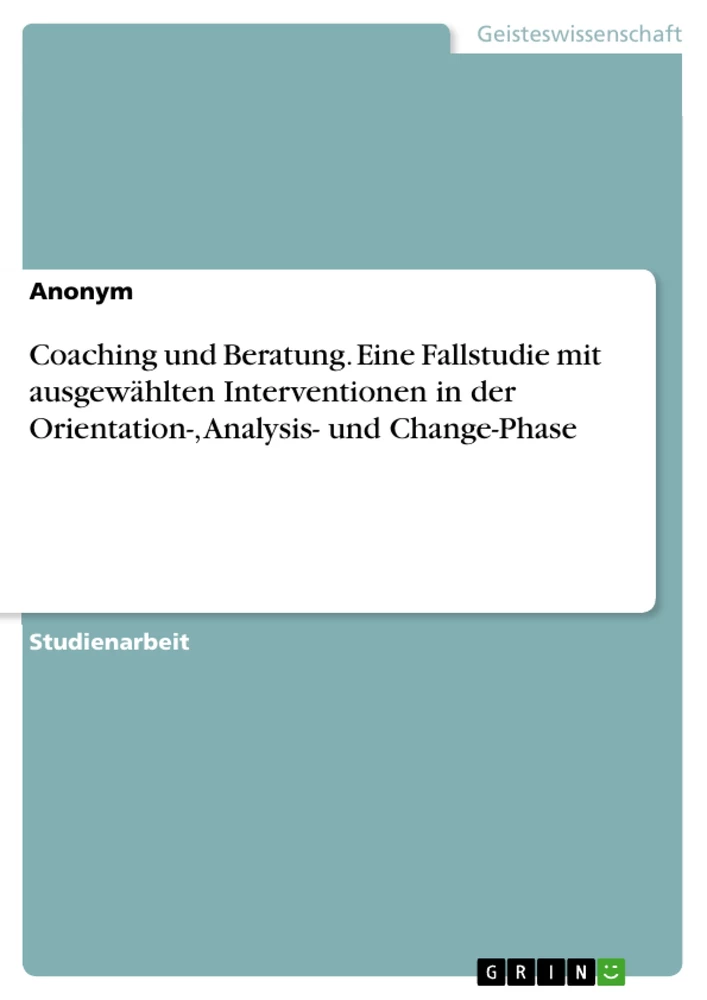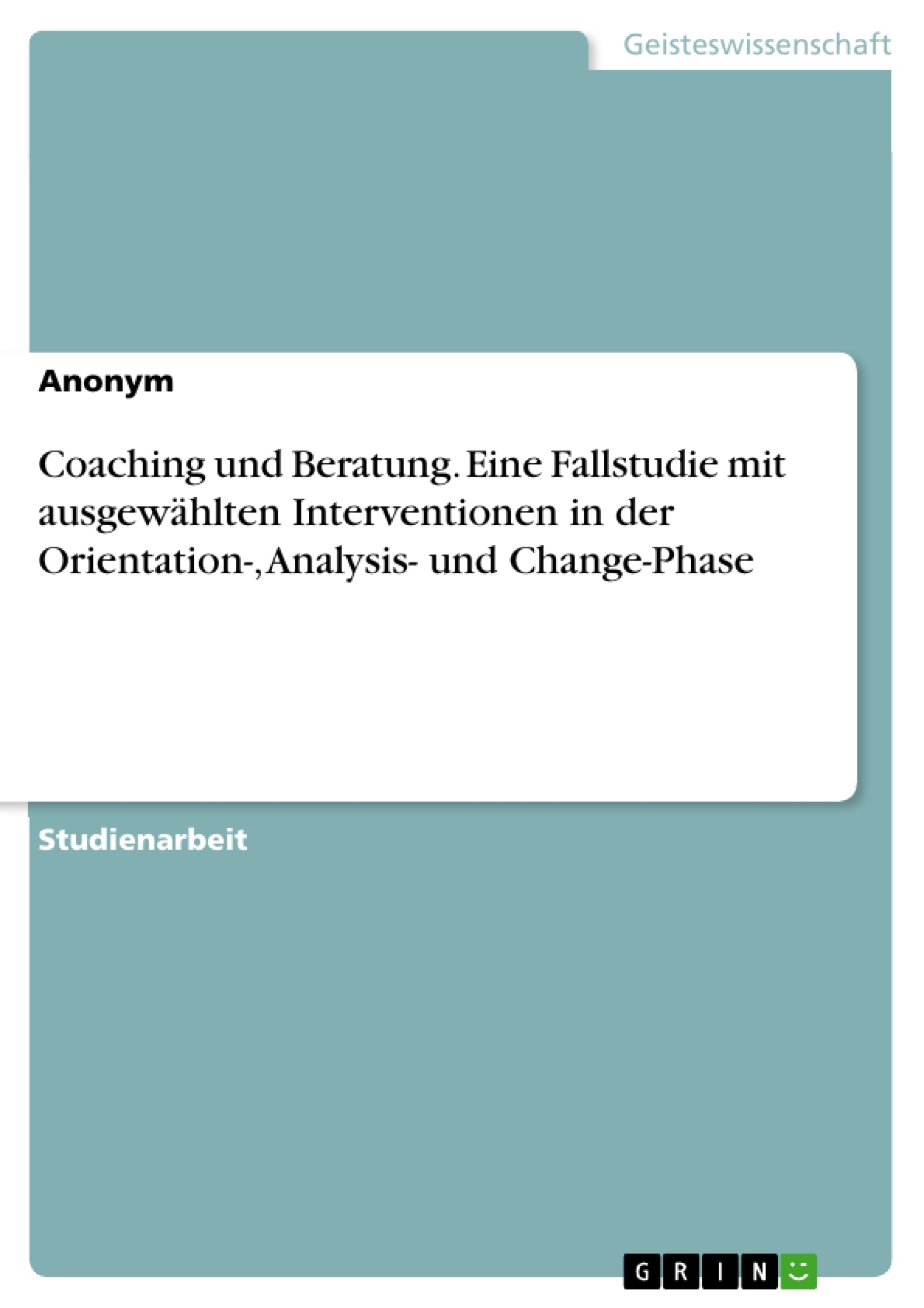Diese Arbeit beschäftigt sich mit Coaching und Beratung und erstellt eine Fallstudie mit ausgewählten Interventionen in der Orientation-, Analysis- und Change-Phase.
Es werden zunächst der Ursprung und die Zielsetzung des Coachings erklärt. Anschließend wird die zu bearbeitende schwierige Lebenssituation von Lena, der Hauptperson in dieser Fallstudie, beschrieben. Darauf basierend erfolgt eine eingehende Analyse der persönlichen Lebensumstände Lenas. Diese Analyse ist dann die Basis für ein maßgeschneidertes Coaching Konzept, das entwickelt und in Form eines Leitfadens dargestellt wird.
Coaching hat sich in den letzten ca. zwei bis drei Jahrzehnten zu einer erfolgreichen Art der Unterstützung für persönliche und berufliche Weiterbildung entwickelt. Erstmalig ist der Begriff im Jahre 1848 in England verwendet worden. Universitätsstudenten bezeichneten ihre privaten Tutoren als Coach. Im Sport ist der Begriff erst Jahre später, um 1885, in den USA und England aufgetaucht.
Im Coaching begegnen sich zwei Experten auf Augenhöhe. Der Coach besitzt die Fähigkeiten für den zielführenden Dialog in der Beratung, für die Skizzierung von Diagnosen, für passende Interventionen und ebenfalls für die Erarbeitung von stringenten Lösungen. Je nach Situation ist er ein rücksichtsvoller und ehrlicher Klärungshelfer, motivierender Entwicklungshelfer und Trainer, Bedenkenträger, geduldiger Zuhörer und immer eine diskrete Person des Vertrauens.
Der Klient, oder auch Coachee genannt, ist der Experte in seinem Tätigkeitsfeld. Der Schwerpunkt des Coachings liegt in der Erarbeitung von Lösungen und Zielen für den Klienten, der sich in ‚anspruchsvollen‘ privaten oder beruflichen Situationen befindet. Ein erfolgreiches Coaching zeichnet sich für den Klienten dadurch aus, dass er sich nicht nur über seine Ziele klar wird, sondern ebenfalls über die Schritte und den Weg dorthin. Auf dieser Basis fühlt er sich gestärkt und zuversichtlich, um notwendige Veränderungen eigenverantwortlich herbeizuführen.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einführung in die Arbeit
- 1.1 Ursprung und Zielsetzung des Coachings
- 1.2 Ausgangssituation
- 1.3 Analyse von Lenas Situation
- 2. Der Coaching-Prozess für Lena
- 2.1 Vorphase
- 2.1.1 Passung
- 2.1.2 Mandat und Vertrag
- 2.2 Hauptphase
- 2.2.1 Auftragsklärung und Orientierung
- 2.2.2 Das Coaching Konzept
- 2.2.3 Systemisches Coaching
- 2.2.4 Persönliches Coaching
- 2.2.5 Business Coaching
- 2.3 Abschlussphase
- 3. Coaching Leitfaden für Lena
- 4. Diskussion und weitere Übertragungen
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit untersucht das Coaching als Instrument zur Unterstützung von persönlicher und beruflicher Weiterentwicklung. Die Fallstudie von Lena, einer 32-jährigen Teamleiterin in einer Kreativagentur, dient als Beispiel für die Anwendung von Coaching-Methoden in einer schwierigen Lebenssituation.
- Ursprung und Entwicklung des Coachings
- Analyse der Ausgangssituation von Lena
- Anwendung verschiedener Coaching-Konzepte
- Entwicklung eines maßgeschneiderten Coaching-Plans
- Diskussion der Übertragbarkeit der Erkenntnisse auf andere Fälle
Zusammenfassung der Kapitel
Kapitel 1 führt in das Thema Coaching ein, erläutert dessen Ursprung und Zielsetzung sowie die aktuelle Situation im deutschen Coachingmarkt. Die Fallstudie von Lena, einer 32-jährigen Teamleiterin in einer Kreativagentur, wird vorgestellt und ihre schwierige Lebenssituation wird analysiert.
Kapitel 2 beschreibt den Coaching-Prozess für Lena und gliedert ihn in die Phasen der Vorphase, Hauptphase und Abschlussphase. Die verschiedenen Coaching-Konzepte wie Systemisches Coaching, Persönliches Coaching und Business Coaching werden erläutert.
Schlüsselwörter
Coaching, Persönliche und Berufliche Weiterentwicklung, Fallstudie, Lena, Kreativagentur, Lebenskrise, Systemisches Coaching, Persönliches Coaching, Business Coaching, Coaching-Plan, Übertragbarkeit, Coaching-Markt.
- Arbeit zitieren
- Anonym (Autor:in), 2022, Coaching und Beratung. Eine Fallstudie mit ausgewählten Interventionen in der Orientation-, Analysis- und Change-Phase, München, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/1279060