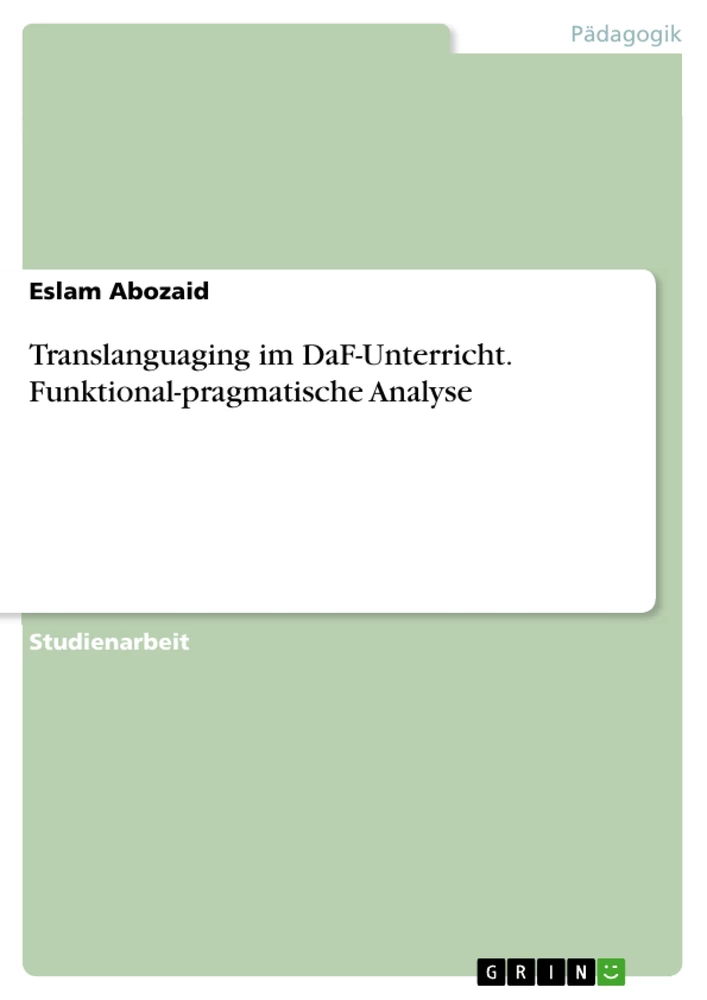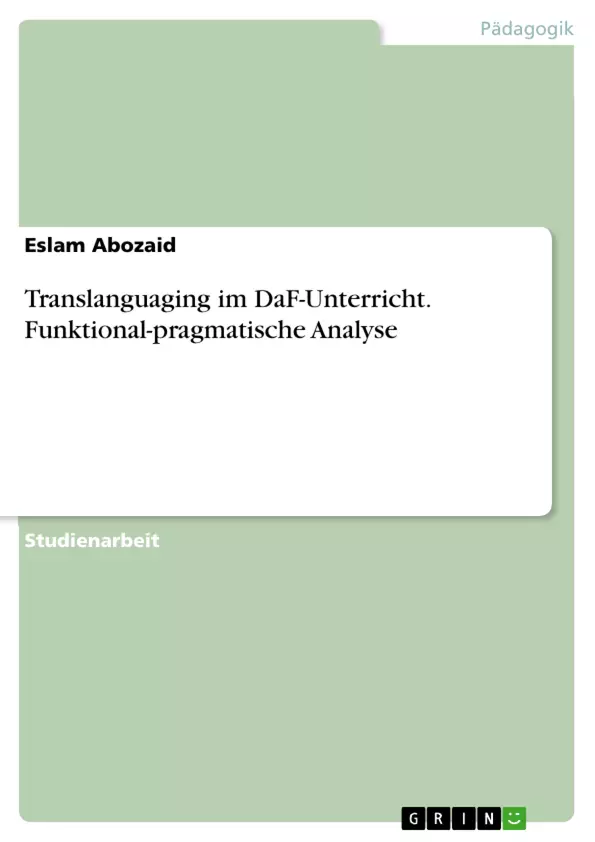Die vorliegende Hausarbeit setzt sich mit der pragmatischen Analyse eines Transkripts im Deutschunterricht auseinander. Wir stützen uns auf dieses Transkript und wollen einen Beitrag für ein umfassenderes Verständnis von Pragmatik und Translanguaging im Fremdsprachunterricht leisten. Vor diesem Hintergrund beschäftigt sich die vorliegende Arbeit mit folgender zentraler Fragestellung: Wann benutzen die Lernenden Translanguaging beim Gespräch im Deutschunterricht und was sind die Ursachen für Translanguaging?
Im ersten Teil dieser Arbeit wird die Pragmatik und ihre Funktionen im Sprachunterricht vorgestellt. Darüber hinaus werden die Geschichte der Pragmatik und ihre Entwicklung sowie ihr Entstehen im Fremdsprachenunterricht skizziert. Das zweite Kapitel der Arbeit beschäftigt sich mit dem Begriff Translanguaging und Code-Switching. Weiterhin wird sowohl der Gebrauch von Translanguaging und Code-Switching als auch ihr Umfeld erläutert. Im Fokus des dritten Kapitels werden zuerst der Begriff Gespräche definiert und Eigenschaften von Gesprächen aufgezeigt.
Daneben werden die Dokumentation und Transkription der Gespräche erörtert. Darauf aufbauend wird das Material im praktischen Teil das Transkript untersucht und pragmatisch analysiert. Nachfolgend werden die Quelle und Herkunft des Transkripts dargelegt. Letztendlich schließt dieses Kapitel mit einer Zusammenfassung der pragmatischen Analyse und ihrer Ergebnisse. Am Ende der Hausarbeit wird ein allgemeiner, kurzer Überblick zu der Gesamtheit der vorliegenden Arbeit und ihrer Ergebnisse wiedergegeben.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung und Aktualität
- 2. Einführung in die Pragmatik
- 2.1 Definition von Sprachwissenschaft und Sprachunterricht
- 2.2 Funktion der Pragmatik
- 2.3 Entwicklung der Pragmatik
- 2.4 Pragmatik im Fremdsprachunterricht
- 2.5 Pragmatik und Handeln
- 3. Translanguaging
- 3.1 Der Begriff Translanguaging
- 3.2 Gebrauch des Translanguagings
- 3.2.1 Translanguaging - Umfelder
- 3.3 Code-Switching und sein Gebrauch
- 4. Gesprächsanalyse
- 4.1 Definition der Gesprächsanalyse
- 4.2 Eigenschaften von Gesprächen
- 4.3 Transkription der Gespräche und Vorgehensweise in der Gesprächsforschung
- 5. Quelle des Korpusmateriales
- 5.1 Die pragmatische Analyse des Transkripts
- 5.2 Zusammenfassung der Analyseergebnisse und Fazit
- 6. Arbeitsergebnisse und Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit analysiert pragmatisch ein Transkript aus dem Deutschunterricht, um ein tieferes Verständnis von Pragmatik und Translanguaging im Fremdsprachunterricht zu gewinnen. Die zentrale Fragestellung lautet: Wann nutzen Lerner Translanguaging im Gespräch im Deutschunterricht und welche Gründe liegen dem zugrunde?
- Definition und Funktion der Pragmatik im Sprachunterricht
- Entwicklung der Pragmatik und ihre Anwendung im Fremdsprachunterricht
- Der Begriff Translanguaging und seine Verwendung
- Code-Switching und seine Rolle in Translanguaging-Prozessen
- Gesprächsanalyse und die pragmatische Analyse eines Transkripts aus dem Deutschunterricht
Zusammenfassung der Kapitel
Kapitel 1 führt in die Thematik der Arbeit ein und erläutert die Relevanz von Pragmatik im Kontext von Kommunikation und sprachlichem Handeln. Kapitel 2 bietet eine detaillierte Einführung in die Pragmatik, ihre Funktionen, Entwicklung und Anwendung im Fremdsprachunterricht. Kapitel 3 fokussiert auf den Begriff Translanguaging, seinen Gebrauch und die verschiedenen Umfelder, in denen er Anwendung findet. Code-Switching wird in diesem Zusammenhang ebenfalls beleuchtet. Kapitel 4 widmet sich der Gesprächsanalyse und erläutert die Eigenschaften von Gesprächen sowie die Transkription von Gesprächsdaten.
Schlüsselwörter
Pragmatik, Translanguaging, Code-Switching, Gesprächsanalyse, Deutschunterricht, Fremdsprachunterricht, Kommunikation, sprachliches Handeln, Interaktion, Analyseergebnisse, Lernerverhalten.
- Quote paper
- Eslam Abozaid (Author), 2020, Translanguaging im DaF-Unterricht. Funktional-pragmatische Analyse, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/1278518