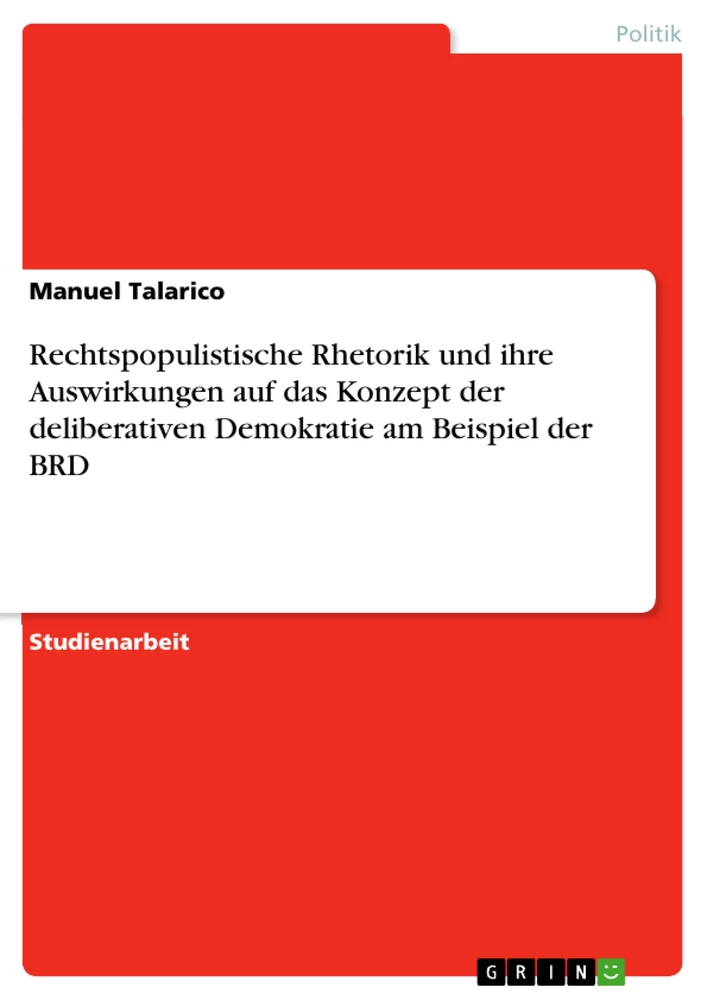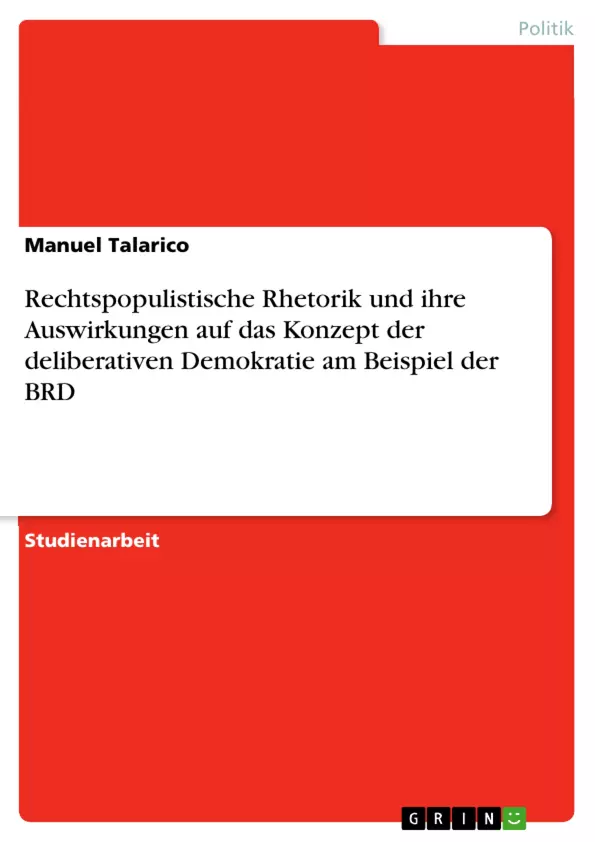In dieser Arbeit wird sich die Frage gestellt, ob es sich aufgrund des Wandels der Rhetorik im politischen Alltag um das Ende des friedlichen Verhandelns, respektive des Konzepts der deliberativen Demokratie handelt. Diese Arbeit möchte sich gezielt damit befassen und hinterfragen, welche Auswirkungen speziell rechtspopulistische Rhetorik auf das Modell der deliberativen Demokratie hat. Befinden wir uns bereits in einer post-deliberativen Zeit oder besitzen die Parolen keinen, wenn nicht sogar positive Einflüsse?
Es wurden in der 19. Wahlperiode mit insgesamt 47 Ordnungsrufen so viele wie noch nie seit der Wiedervereinigung vergeben. Analysiert man die Statistiken der momentanen Legislatur des Deutschen Bundestages, so scheint sich der Trend bezüglich der Verschärfung des Tons zu bestätigen. In gerade einmal neun Monaten wurden 13 Verfahren eingeleitet, mehrheitlich gegen Mitglieder der Alternativen für Deutschland (AfD). Den genauen Gründen des Verlaufs gebührt eine eigene Arbeit, jedoch kann der hervorstechende Wert der 19. Legislatur unter anderem mit dem Einzug der AfD-Fraktion gedeutet werden. Zwar existierten beispielsweise mit den Republikanern und der Schill-Partei bereits davor Vertreter eines ähnlichen politischen Lagers, der exponentielle Anstieg rhetorischer Übertretungen, speziell im Bundestag, kann in jüngerer Vergangenheit aber vor allem mit dem Aufstieg der AfD erklärt sowie statistisch belegt werden. Diese Entwicklung kann überraschen. So ist es paradoxerweise doch vor allem die Alternative für Deutschland, die in einem überproportionalen Maße den 5. Artikel des Grundgesetzes, die Meinungsfreiheit betont, ohne welche „Demokratie nicht [funktionieren] würde“. Dass die Meinungsfreiheit „den Vorschriften der all-gemeinen Gesetze“ unterliegt und Anhänger der AfD in ihren Reden oftmals strafrechtlich über die Stränge schlagen, wirkt dabei unverständlich.
Inhaltsverzeichnis
- Der Ton macht die Musik...
- Vorgehen und Literaturübersicht
- Verlauf und Methode der Studie
- Literaturbericht.
- Begrifflichkeiten und theoretische Konzeptualisierung...
- Rechtspopulismus und rechtspopulistische Rhetorik
- Die deliberative Demokratie.……………….
- Empirische Analyse…………………………
- Björn Höcke - Rede vom 17.01.2017 ...
- Stilistische Merkmale
- Negative Effekte auf die deliberative Demokratie
- Positive Effekte auf die deliberative Demokratie.......
- Fazit....
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit befasst sich mit den Auswirkungen rechtspopulistischer Rhetorik auf das Konzept der deliberativen Demokratie. Sie untersucht, ob und wie die zunehmende Nutzung von aggressiven und polarisierenden Sprechweisen das friedliche Verhandeln in der Politik beeinträchtigt und das Ideal der deliberativen Demokratie untergräbt.
- Analyse der Entwicklung der Rhetorik im Deutschen Bundestag
- Bedeutung des Rechtspopulismus für die politische Landschaft
- Theoretische Einordnung von Rechtspopulismus und deliberativer Demokratie
- Empirische Analyse einer rechtspopulistischen Rede
- Bewertung der Auswirkungen auf das Modell der deliberativen Demokratie
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel der Arbeit stellt den Kontext des Themas dar und beleuchtet die steigende Anzahl von Ordnungsrufen im Deutschen Bundestag, die insbesondere auf das Auftreten der AfD zurückzuführen ist. Es wird die Frage aufgeworfen, ob diese Entwicklung auf ein Ende des friedlichen Verhandelns und damit des Konzepts der deliberativen Demokratie hindeutet.
Das zweite Kapitel beschreibt die Vorgehensweise der Studie und bietet einen Überblick über die relevante Literatur. Es wird die Methodik erläutert und die Forschungsfrage präzisiert.
Das dritte Kapitel widmet sich der theoretischen Fundierung der Arbeit. Es definiert den Begriff des Rechtspopulismus und erläutert das Konzept der deliberativen Demokratie. Die Bedeutung des Rechtspopulismus für die deutsche Politik wird hervorgehoben.
Das vierte Kapitel widmet sich der empirischen Analyse einer Rede von Björn Höcke. Die Analyse beleuchtet die stilistischen Merkmale, die negativen und positiven Effekte der Rede auf die deliberative Demokratie. Die Ergebnisse werden im Rahmen des theoretischen Rahmens interpretiert.
Schlüsselwörter
Rechtspopulismus, deliberative Demokratie, Rhetorik, politische Kommunikation, Meinungsfreiheit, AfD, Bundestag, Ordnungsrufe, Björn Höcke, empirische Analyse
- Arbeit zitieren
- Manuel Talarico (Autor:in), 2022, Rechtspopulistische Rhetorik und ihre Auswirkungen auf das Konzept der deliberativen Demokratie am Beispiel der BRD, München, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/1278029