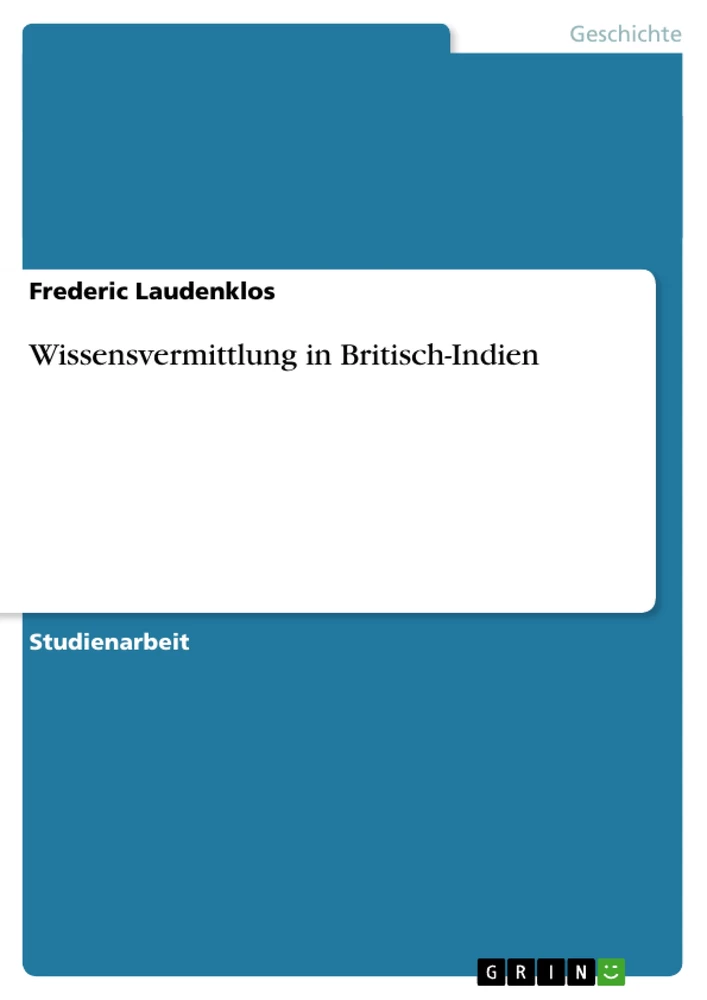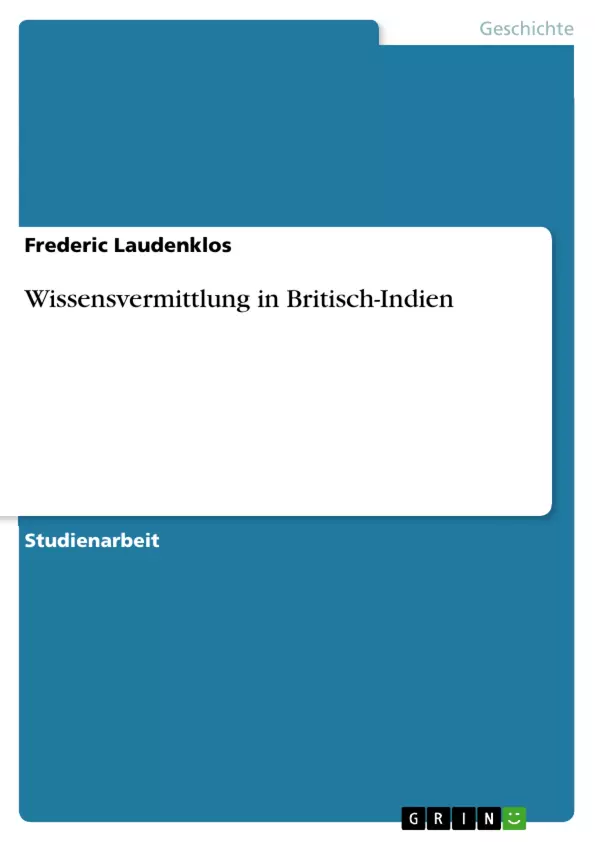Im Fokus dieser Arbeit soll die Wissensvermittlung in Britisch Indien stehen. Hierbei soll weniger chronologisch deskriptiv vorgegangen werden, obgleich sich eine gewisse Chronologie nicht ganz vermeiden lässt, dafür aber durch eine interrogative Annährungsweise an die Thematik anhand von Leitfragen Beweggründe, seien es die der Engländer, seien es die der indigenen Bevölkerung, herausgearbeitet werden. Dieses Thema ist vor allem für Indien selbst hochaktuell, wie man an den zahlreichen Publikationen indischer Historiker und / oder Autoren feststellen kann. Vor allem mit dem heutigen Bildungssystem, das natürlich immer noch stark westlichen Einfluss aufweist, beschäftigen sich einige Werke, die dieser Arbeit, wenn auch nur auszugsweise, zugrunde liegen.
Die Arbeit beschäftigt sich nur in äußerst geringem Maße mit der indischen Bevölkerung, da es vor allem, um nicht zu sagen ‚ausschließlich’, die Elite war, die mit höherer Bildung in Berührung kam. Bis Ende des 19. Jahrhunderts machten Schüler und Studenten weniger als circa einem Prozent aus, wenn man von einem Alphabetisierungsgrad der Gesamtbevölkerung von einem Prozent ausgeht.
Zwecks einer besseren Übersicht werden zwei Hauptgruppen der Wissensvermittlung in separaten Kapiteln behandelt, nämlich diejenige der kolonialen und diejenige der nationalen Bildungsmodelle, wobei es zwischen den Kapiteln durchaus Berührungen gibt, bzw. geben muss.
So wird zunächst anhand des zweiten Kapitels gezeigt, aus welchen Gründen sich der Erstkontakt zwischen Engländern und der indischen Elite so und nicht eben auf andere Weise gestaltete. Dann werden aber auch Veränderungen in diesen Bildungsmodellen thematisiert, sowohl im Hinblick auf deren Auswirkungen, als auch im Hinblick auf deren Gründe. Diesen seien anschließend die nationalen Bildungsmodelle gegenübergestellt und auch hier wird vor allem mit Erklärungen der Prozesse gearbeitet werden.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Koloniale Bildungsmodelle
- Die „parasitäre Symbiose“ der Orientalisten
- Der anglizistische „Bildungsauftrag“
- Macaulays Protokoll
- Das Christianisierungsvorhaben der Evangelikalen
- Der Utilitarismus in Britisch Indien
- Auswirkungen und Wechselwirkungen mit der indigenen Bevölkerung
- Nationale Bildungsmodelle
- Bengali Intelligentsia
- Gurukul Kangri
- Madrassas während und nach der Kolonialzeit
- Der elitäre Anspruch auf Virilität – Erklärungsversuche
- Fazit: Problematik und Konsequenzen der Bildungspolitik in Britisch Indien
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Wissensvermittlung in Britisch Indien, fokussiert auf die Beweggründe der Engländer und der indigenen Bevölkerung. Sie analysiert die kolonialen und nationalen Bildungsmodelle, ohne eine rein chronologische Darstellung zu bevorzugen. Der Fokus liegt auf der Elite, da diese den Hauptanteil der gebildeten Bevölkerung ausmachte.
- Koloniale Bildungsmodelle und ihre Entwicklung
- Der Einfluss der Orientalisten, Evangelikalen und Utilitaristen
- Die Rolle von Macaulays Protokoll und seine Auswirkungen
- Nationale Bildungsmodelle als Reaktion auf die Kolonialpolitik
- Wechselwirkungen zwischen kolonialen und nationalen Modellen
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Arbeit konzentriert sich auf die Wissensvermittlung in Britisch Indien, untersucht die Motive hinter den verschiedenen Ansätzen und beleuchtet die Interaktion zwischen den kolonialen und nationalen Bildungsmodellen. Der Fokus liegt auf der Elite, da die Mehrheit der Bevölkerung bis zum Ende des 19. Jahrhunderts keinen Zugang zu höherer Bildung hatte. Die Arbeit gliedert sich in Kapitel zu kolonialen und nationalen Bildungsmodellen, wobei Überschneidungen zwischen diesen bestehen.
Koloniale Bildungsmodelle: Dieses Kapitel analysiert die britischen Bildungsmodelle in Indien, indem es die unterschiedlichen Ansätze der Kolonialmacht differenziert betrachtet. Es beginnt mit einer Untersuchung der Orientalisten und ihrer „parasitären Symbiose“ mit der indischen Elite, die primär der Kontrolle und Verwaltung diente. Der einseitige Wissensfluss in Richtung der Engländer wird herausgestellt, wobei das Interesse der Orientalisten an der indischen Kultur als mit Eigeninteresse vermischt beschrieben wird. Der Übergang zu anglizistischen Modellen wird als folge der Unzulänglichkeit der vorherigen Symbiose dargestellt.
Der anglizistische „Bildungsauftrag“: Dieses Kapitel befasst sich mit dem Wandel in der britischen Bildungspolitik von der „parasitären Symbiose“ der Orientalisten hin zum anglizistischen Ansatz. Macaulays Protokoll wird als zentraler Wendepunkt identifiziert, der die Überlegenheit des britischen Bildungssystems postuliert und die Anglisierung der indischen Elite als Ziel formuliert. Die Rolle der Evangelikalen mit ihrem „healing principle“ und der Utilitaristen wird diskutiert, die beide die Überzeugung teilen, dass westliche Erziehung zur Verbesserung der indischen Bevölkerung beiträgt. Der Einfluss dieser Gruppen auf die Politikverschiebung wird näher untersucht.
Nationale Bildungsmodelle: Dieser Abschnitt analysiert die Entstehung nationaler Bildungsmodelle in Indien als Reaktion auf die koloniale Bildungspolitik. Verschiedene Ansätze und Institutionen, wie z.B. die Bengali Intelligentsia, Gurukul Kangri und Madrassas, werden vorgestellt und ihre Rolle im Kontext der kolonialen Dominanz erörtert. Die Bedeutung des elitären Anspruchs auf Virilität und dessen Erklärungen werden ebenfalls beleuchtet.
Schlüsselwörter
Koloniale Bildungsmodelle, Nationale Bildungsmodelle, Britisch Indien, Orientalisten, Anglizisten, Macaulay, Evangelikalen, Utilitaristen, Wissensvermittlung, Elite, Herrschaftswissen, Anglisierung, Downward Filtration.
Häufig gestellte Fragen zu: Koloniale und Nationale Bildungsmodelle in Britisch-Indien
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit untersucht die Wissensvermittlung in Britisch-Indien und analysiert die kolonialen und nationalen Bildungsmodelle. Der Fokus liegt auf den Beweggründen der englischen Kolonialmacht und der indigenen Bevölkerung sowie auf der Rolle der Elite im Bildungssystem.
Welche Zeiträume und Akteure werden behandelt?
Die Arbeit befasst sich mit der Kolonialzeit in Britisch-Indien und betrachtet die Entwicklung der Bildungsmodelle von der „parasitären Symbiose“ der Orientalisten bis hin zu den nationalen Reaktionen darauf. Wichtige Akteure sind die Orientalisten, Evangelikalen, Utilitaristen, die Bengali Intelligentsia und die Verantwortlichen von Institutionen wie Gurukul Kangri und Madrassas.
Welche kolonialen Bildungsmodelle werden untersucht?
Die Arbeit analysiert die „parasitäre Symbiose“ der Orientalisten, die als einseitig und der Kontrolle dienend beschrieben wird. Der Fokus liegt dann auf dem anglizistischen „Bildungsauftrag“, der durch Macaulays Protokoll einen zentralen Wendepunkt erfährt. Die Rolle der Evangelikalen mit ihrem „healing principle“ und der Utilitaristen wird ebenfalls eingehend untersucht.
Wie werden die nationalen Bildungsmodelle dargestellt?
Die Entstehung nationaler Bildungsmodelle als Reaktion auf die Kolonialpolitik wird beleuchtet. Verschiedene Ansätze und Institutionen wie die Bengali Intelligentsia, Gurukul Kangri und Madrassas werden vorgestellt und ihre Rolle im Kontext der kolonialen Dominanz diskutiert. Der elitäre Anspruch auf Virilität und seine Erklärungen werden ebenfalls thematisiert.
Welche Schlüsselkonzepte werden in der Arbeit behandelt?
Schlüsselkonzepte sind koloniale und nationale Bildungsmodelle, die Rolle der Orientalisten und Anglizisten, Macaulays Protokoll, der Einfluss der Evangelikalen und Utilitaristen, Wissensvermittlung, Elite, Herrschaftswissen, Anglisierung und Downward Filtration.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit gliedert sich in Kapitel zu kolonialen und nationalen Bildungsmodellen. Sie beinhaltet eine Einleitung, eine Zusammenfassung der Kapitel und eine Erläuterung der Zielsetzung und Themenschwerpunkte. Der Fokus liegt nicht auf einer rein chronologischen Darstellung, sondern auf der Analyse der Motive und Interaktionen zwischen den verschiedenen Modellen.
Welche Schlussfolgerungen zieht die Arbeit?
Die Arbeit untersucht die Problematik und die Konsequenzen der Bildungspolitik in Britisch-Indien, ohne explizit Schlussfolgerungen zu formulieren. Die Zusammenfassung der Kapitel bietet einen Einblick in die Kernaussagen der einzelnen Abschnitte. Der Fokus liegt auf der Analyse der verschiedenen Ansätze und ihrer Interaktionen.
Für wen ist diese Arbeit gedacht?
Diese Arbeit ist für ein akademisches Publikum bestimmt, das sich für die Geschichte der Bildung in Britisch-Indien interessiert. Die Sprache und der Detaillierungsgrad deuten auf eine wissenschaftliche Zielgruppe hin.
- Quote paper
- Frederic Laudenklos (Author), 2008, Wissensvermittlung in Britisch-Indien, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/127635