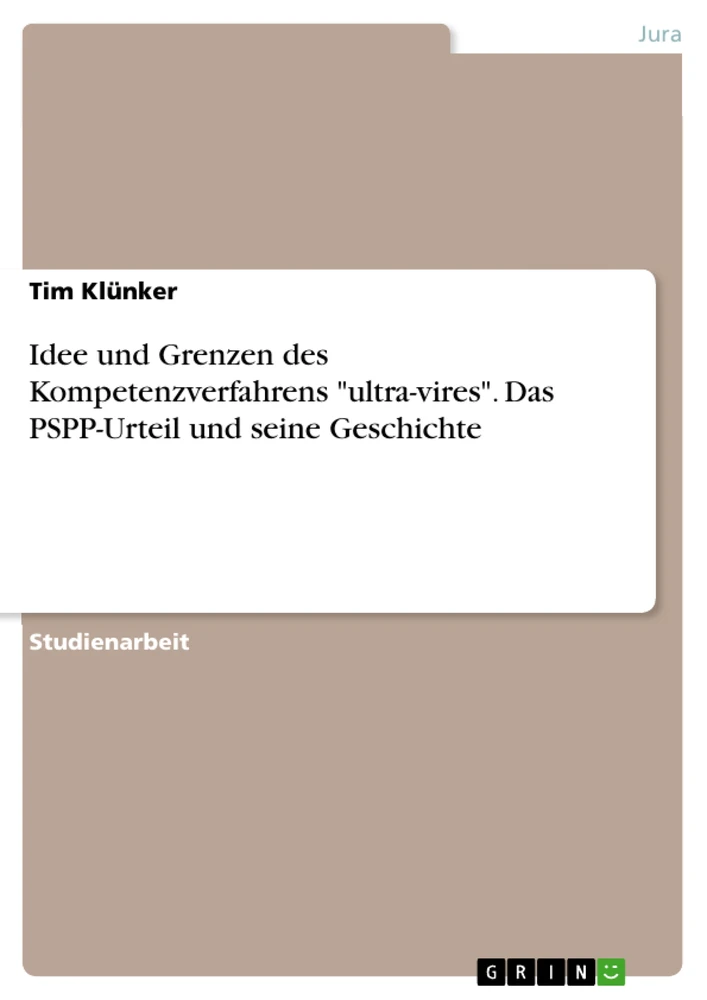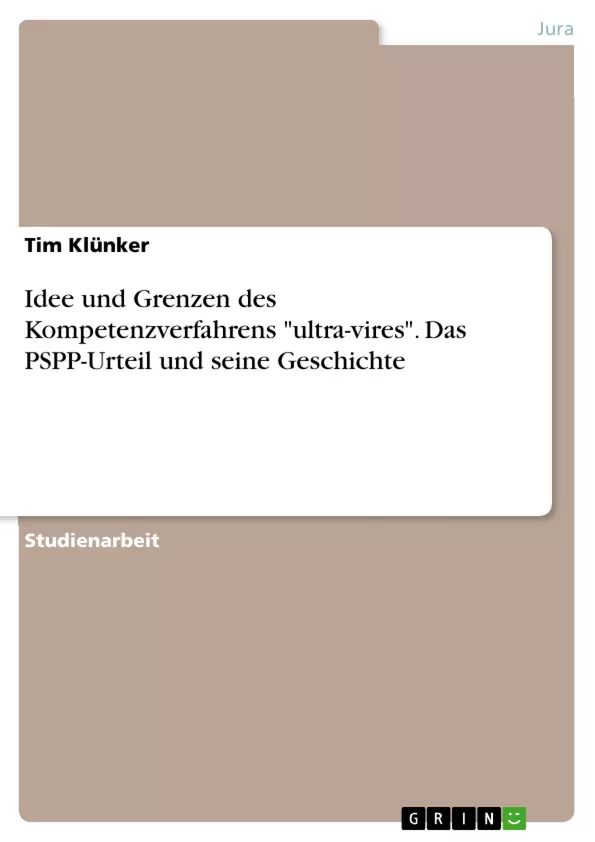Die vorliegende Seminararbeit stellt das Verhältnis von BVerfG und EuGH unter Berücksichtigung verschiedener Standpunkte dar, beschreibt, was das Kompetenzverfahren "ultra vires" ist und ordnet besondere Rechtsakte in
den Kontext des Kompetenzverfahrens ein. Der Schwerpunkt der Arbeit liegt darin, die PSPP-Entscheidung als Anwendungsbeispiel für das "ultra vires"- Verfahren zu untersuchen und mögliche Folgen der Entscheidung für die
Beziehung zwischen BVerfG und EuGH zu beleuchten.
Das erste Kapitel wird sich explizit mit dem Verhältnis und etwaigen Spannungen zwischen BVerfG und EuGH beschäftigen. Hierbei wird auf die "ultra-vires" -Kontrolle eingegangen. Die Idee des Verfahrens, Ursprung und
mögliche Beispiele sollen angesprochen werden und im Rahmen der Letztentscheidungskompetenz soll das Prinzip der begrenzten Einzelermächtigung aus Sichtweise des BVerfG und auch der Anwendungsvorrang des Unionsrecht aus Sicht des EuGHs erklärt werden. Abschließend soll eine Darstellung der Situation zwischen BVerfG und EuGH vor der PSPP-Entscheidung und nach der PSPP-Entscheidung erfolgen.
Das zweite Kapitel ordnet relevante Entscheidungen in den Kontext des Kompetenzverfahrens ein. Dazu soll eine kurze Sachverhaltsdarstellung des Maastricht-Urteils, des Lissabon-Urteils und der Honeywell-Entscheidung
erfolgen. Anschließend erfolgt eine Einordnung, sowie mögliche Auswirkungen und Folgen der Urteile für das Verhältnis von BVerfG und EuGH.
Das dritte Kapitel befasst sich mit dem wohl aufsehenerregendsten Urteil der letzten Jahre. Die PSPP-Entscheidung soll samt Sachverhalt dargestellt werden, die Reaktion des EuGHs beleuchtet und hinsichtlich der Entscheidung die Entwicklung des Selbstbewusstseins des BVerfG gedeutet werden. Dabei soll auf unterschiedlichste Faktoren eingegangen werden. Es folgt abschließend eine Spekulation zu den Kräfteverhältnissen im europäischen Gerichtswesen.
Im Fazit soll dann auf die Frage eingegangen werden, warum die PSPP-Entscheidung nach ca. 27 Jahren die erste Entscheidung ist, die sich der Bindungswirkung des EuGHs entzieht. Dabei werden mögliche Gründe
skizziert und aus Ergebnissen vergangener Jahre Schlussfolgerungen gezogen.
Inhaltsverzeichnis
- A. Einleitung
- B. Verhältnis und Spannung zwischen BVerfG und EuGH
- I. Ultra-Vires-Kontrolle
- II. Das Prinzip der begrenzten Einzelermächtigung
- III. Der Anwendungsvorrang des Unionsrechts
- IV. Situation vor der PSPP-Entscheidung
- V. Situation nach der PSPP-Entscheidung
- C. Bedeutsame Rechtsakte im Kontext des Kompetenzverfahrens
- I. Maastricht-Urteil
- 1. Sachverhaltsdarstellung
- 2. Einordnung und Auswirkungen
- II. Lissabon-Urteil
- 1. Sachverhaltsdarstellung
- 2. Einordnung und Auswirkungen
- D. Ein Meilenstein - die PSPP-Entscheidung des BVerfG
- I. Darstellung des Sachverhalts
- II. Situation und Ablauf des Entscheidungsprozesses
- III. Auswirkungen auf die Position des BVerfG?
- III. Honeywell-Entscheidung
- 1. Sachverhaltsdarstellung
- 2. Einordnung und Auswirkungen
- E. Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Seminararbeit befasst sich mit der Frage der Kompetenzüberschreitung des Europäischen Gerichtshofs (EuGH) im Kontext des Kompetenzverfahrens „ultra vires“. Insbesondere wird die PSPP-Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts (BVerfG) aus dem Jahr 2020 analysiert, in der erstmals dem EuGH eine Kompetenzüberschreitung unterstellt wurde.
- Spannungsverhältnis zwischen BVerfG und EuGH
- Das Prinzip der begrenzten Einzelermächtigung und der Anwendungsvorrang des Unionsrechts
- Entwicklung des Kompetenzverfahrens „ultra vires“ in der europäischen Integration
- Auswirkungen der PSPP-Entscheidung auf die Position des BVerfG und das Verhältnis zwischen den beiden Gerichtshöfen
- Relevanz des Kompetenzverfahrens „ultra vires“ für die Rechtssicherheit und Einheit der Unionsrechtordnung
Zusammenfassung der Kapitel
- A. Einleitung: Die Einleitung skizziert die Problematik der europäischen Integration und die sich daraus ergebenden Spannungen zwischen nationalen Verfassungsgerichten und dem EuGH. Sie stellt den Wandel der Stellung nationaler Verfassungsgerichte dar und hebt die Bedeutung des Kompetenzverfahrens „ultra vires“ für die Beziehungen zwischen BVerfG und EuGH hervor.
- B. Verhältnis und Spannung zwischen BVerfG und EuGH: Dieses Kapitel untersucht die komplexen Beziehungen zwischen dem BVerfG und dem EuGH. Es beleuchtet die Entwicklung des „ultra vires“-Prinzips, die Bedeutung des Anwendungsvorrangs des Unionsrechts sowie die Situation vor und nach der PSPP-Entscheidung.
- C. Bedeutsame Rechtsakte im Kontext des Kompetenzverfahrens: Dieses Kapitel beleuchtet zwei wichtige Urteile des EuGH, das Maastricht-Urteil und das Lissabon-Urteil, die maßgeblich zur Entwicklung des Kompetenzverfahrens „ultra vires“ beigetragen haben.
- D. Ein Meilenstein - die PSPP-Entscheidung des BVerfG: Dieses Kapitel widmet sich der bahnbrechenden PSPP-Entscheidung des BVerfG, in der erstmals dem EuGH eine Kompetenzüberschreitung vorgeworfen wurde. Es beleuchtet den Sachverhalt, den Entscheidungsprozess und die Auswirkungen der Entscheidung auf die Position des BVerfG.
Schlüsselwörter
Die Schlüsselwörter dieser Seminararbeit sind: Kompetenzverfahrens „ultra vires“, PSPP-Entscheidung, Bundesverfassungsgericht (BVerfG), Europäischer Gerichtshof (EuGH), Europäische Union, Unionsrecht, Rechtssicherheit, Einheit der Unionsrechtordnung, Letztentscheidungskompetenz, Anwendungsvorrang.
- Quote paper
- Tim Klünker (Author), 2022, Idee und Grenzen des Kompetenzverfahrens "ultra-vires". Das PSPP-Urteil und seine Geschichte, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/1276185