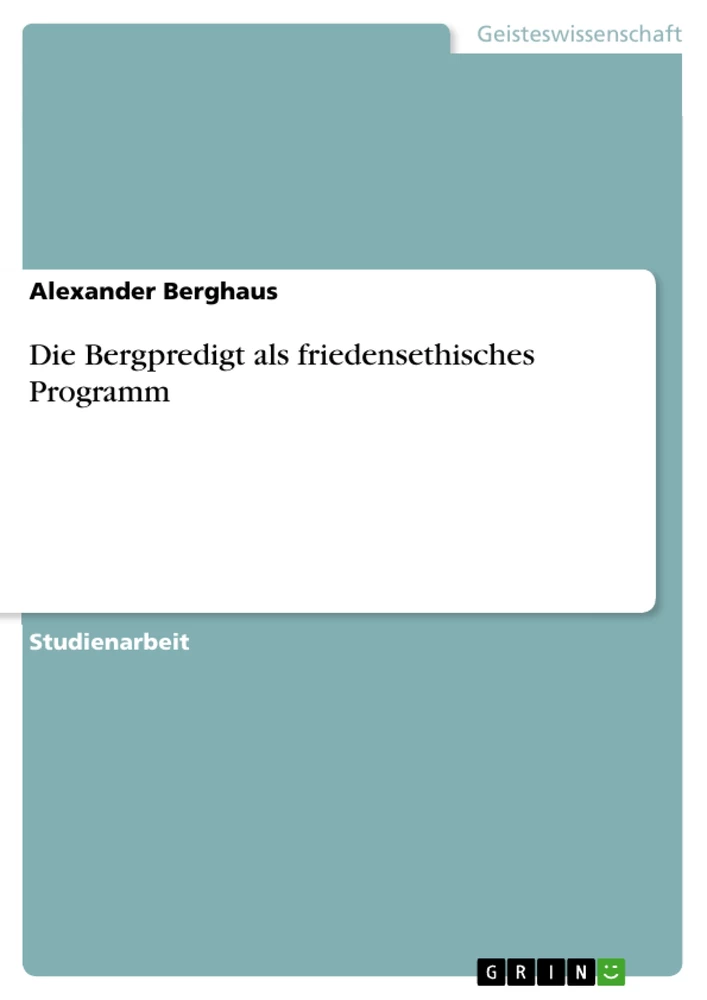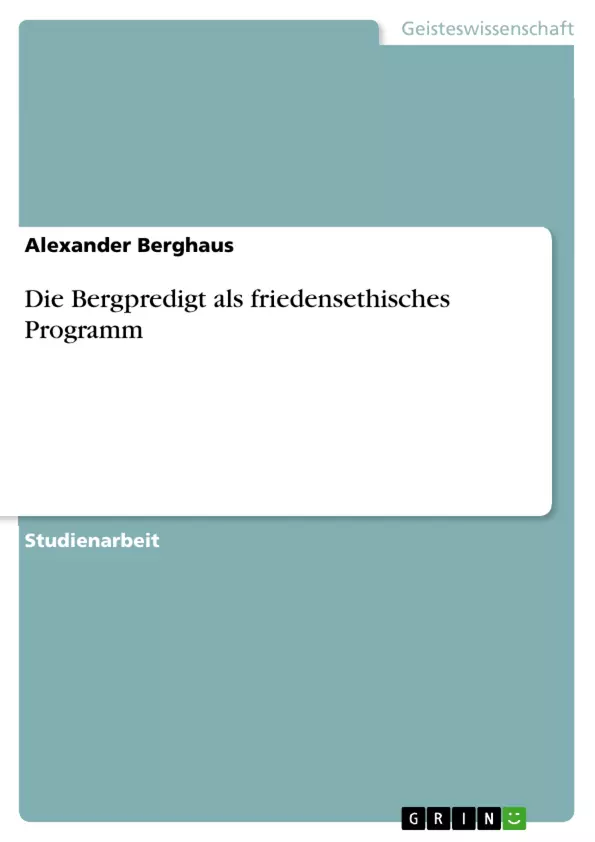Die Bergpredigt Jesu (Mt 5,1-7,29) stellt, trotz ihrer häufigen und intensiven Rezeption und der Beschäftigung mit ihren Kernaussagen, nach wie vor zentrale Fragen an die Christenheit und darüber hinaus an die Menschheit als solche. Insbesondere in Kriegs- und Krisenzeiten stellen sich friedensethische Fragen an die Bergpredigt mit größerem Druck und besonderem Interesse. Dabei stellt sich immer wieder die Frage nach der tatsächlichen Realisierbarkeit der Lehren Jesu in der Bergpredigt.
Im Jahr 2022 wurde die Menschheit mit dem Überfall Russlands auf die Ukraine erneut mit einer Lage konfrontiert, in der die Bergpredigt als Ratgeber oder sogar als politisches Programm herhalten soll, wobei sich stets die Frage eröffnet, ob die Bergpredigt überhaupt Regierungsprogramm in einer solchen Lage sein kann. An diese Frage soll auch die Leitfrage dieser Arbeit anschließen. So steht die Frage im Mittelpunkt, ob und unter welchen Umständen die Bergpredigt als friedensethische Perspektive gelten kann. Dabei wird vornehmlich das Friedensverständnis der Bergpredigt auf die Kompatibilität mit friedensethischen Konzepten hin überprüft. Dies geschieht nach dem ethischen Dreischritt des Sehens, Urteilens und Handelns.
Diese Arbeit kann explizit einen Beitrag zum Verständnis des Umfangs der Bergpredigt aus friedensethischer Perspektive liefern, wobei auf vergleichbare ethische Konzepte zurückgegriffen wird und diese schlussendlich auch empirisch in aktuellen friedenspolitischen Diskursen dargestellt werden. In Abgrenzung dieser Funktion, kann diese Arbeit hingegen keinen theologisch-exegetischen Beitrag leisten, da dies im Rahmen des religionswissenschaftlichen und speziell im theologischen Diskurs zu verorten wäre und die ethischen Fragen nach dem rechten Handeln entsprechend verdrängen würde.
Inhaltsverzeichnis
- Bergpredigt als realisierbares Programm?
- Verantwortung und friedensethische Bestandteile
- Bergpredigt als allumfassendes Verhaltenskonzept
- Handlungsaufrufe auf Basis der Bergpredigt
- Handlungsleitende Funktion und friedensethische Kontextualisierung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit analysiert die Bergpredigt Jesu im Lichte der Friedensethik. Sie untersucht die Frage, ob und unter welchen Umständen die Bergpredigt als friedensethische Perspektive gelten kann und überprüft das Friedensverständnis der Bergpredigt auf seine Kompatibilität mit friedensethischen Konzepten.
- Definition von Frieden im Rahmen der Friedensethik
- Verantwortlichkeit in Bezug auf Frieden
- Ethische Perspektive der Bergpredigt: Intention, Realisierbarkeit und Programmatik
- Anwendbarkeit der Bergpredigt im aktuellen friedensethischen Diskurs
- Friedensverständnis Jesu im Vergleich zu aktuellen ethischen Konzepten
Zusammenfassung der Kapitel
- Kapitel 1: Bergpredigt als realisierbares Programm? Dieses Kapitel befasst sich mit der Frage der Realisierbarkeit der Bergpredigt in der heutigen Zeit, insbesondere im Kontext von Kriegen und Krisen. Es untersucht das Friedensverständnis der Bergpredigt und seine Relevanz für den gegenwärtigen friedensethischen Diskurs.
- Kapitel 2: Verantwortung und friedensethische Bestandteile Dieses Kapitel beleuchtet die Frage der Verantwortlichkeit für den Frieden und definiert den Begriff des Friedens im Kontext der Friedensethik. Es erörtert verschiedene Konzepte des Friedens, darunter das prozedurale Friedenskonzept von Ernst-Otto Czempiel, und zeigt deren Relevanz für die Analyse der Bergpredigt auf.
Schlüsselwörter
Friedensethik, Bergpredigt, Friedensverständnis, Verantwortlichkeit, Konfliktlösung, Humanisierung, prozedurales Friedenskonzept, Gewaltlosigkeit, Utopie, Gesinnungs- und Strukturethik.
- Arbeit zitieren
- Alexander Berghaus (Autor:in), 2022, Die Bergpredigt als friedensethisches Programm, München, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/1276109