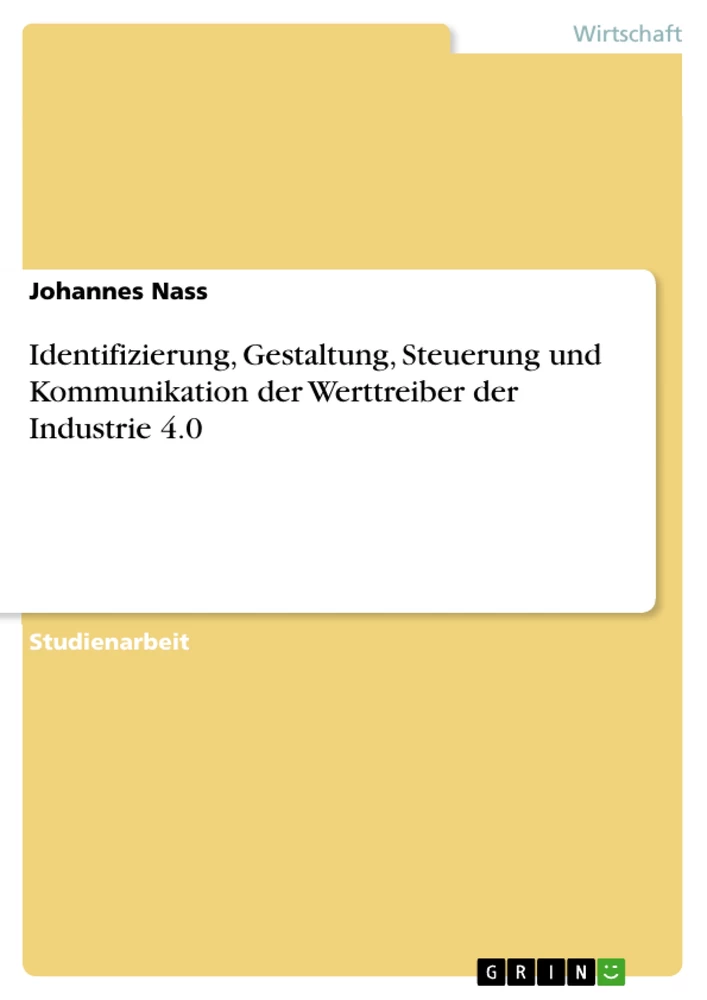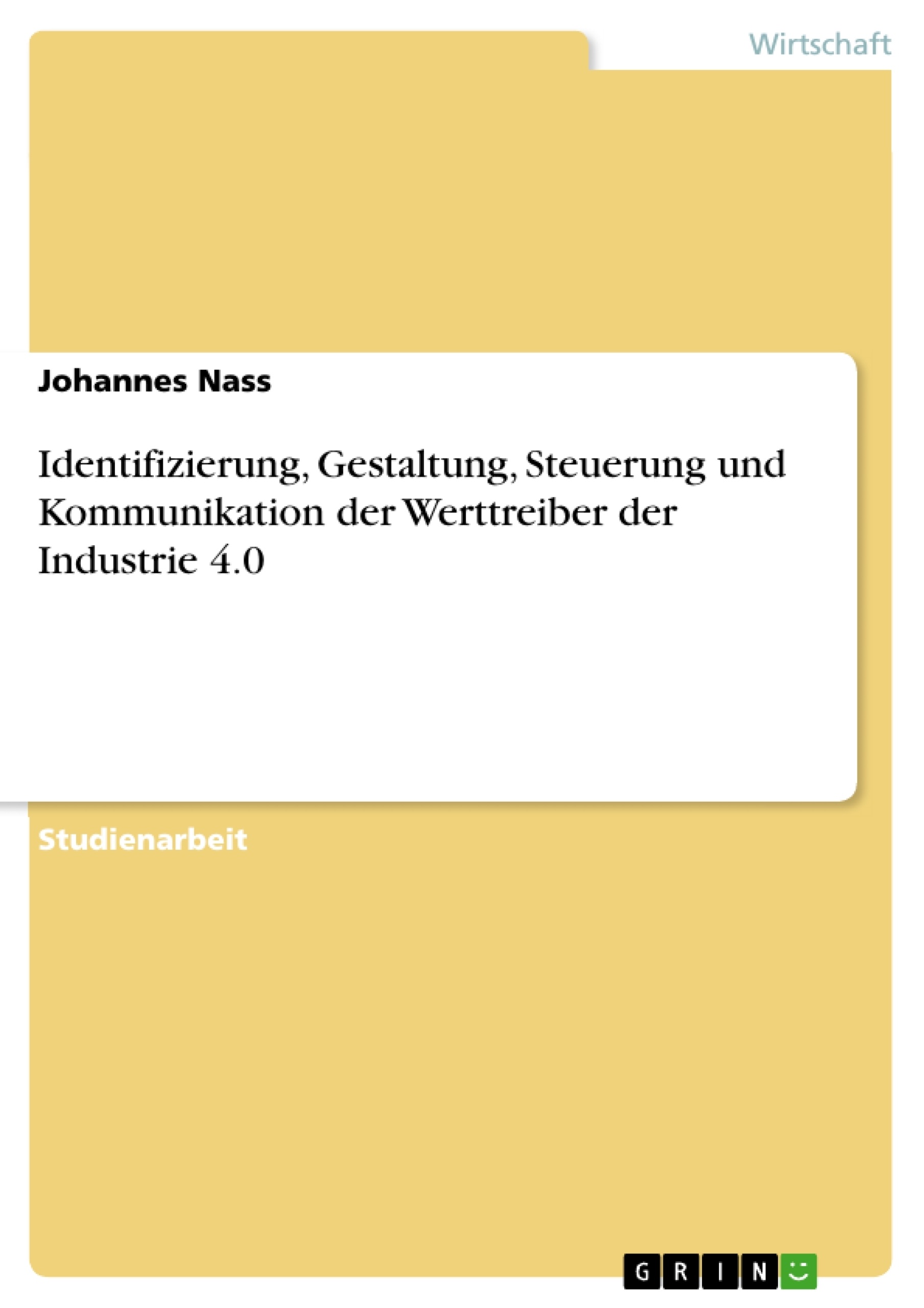Im Kapitel der begrifflich konzeptionellen Grundlegung wird zunächst der Begriff Industrie 4.0 definiert und erläutert. In diesem Zusammenhang wird anschließend das Referenzarchitekturmodell RAMI 4.0 beschrieben. Danach werden die Werttreiber der Industrie 4.0 beschrieben, erläutert und diskutiert. Dabei werden wie bereits erwähnt die strategischen Werttreiber, die Werttreiber
der betrieblichen Abläufe und die Werttreiber aus der Sicht von Mensch und Umwelt beschrieben. Im darauffolgenden Kapitel folgt eine kritische Würdigung der wissenschaftlichen Ausarbeitung und ein kurzer Ausblick. Im Glossar werden die wichtigsten Begriffe nochmals kurz anhand von Daten des Bundesministeriums für Bildung und Forschung definiert.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 1.1 Hinführung zum Thema
- 1.2 Aufbau der Arbeit
- 2. Begrifflich konzeptionelle Grundlegung
- 2.1 Industrie 4.0
- 2.2 Referenzarchitekturmodell RAMI 4.0
- 3. Werttreiber Industrie 4.0
- 3.1 Werttreiber Strategie
- 3.2 Werttreiber betriebliche Abläufe / Operations
- 3.2.1 Cyber-Physische Systeme
- 3.2.2 Internet der Dinge
- 3.2.3 Smart Factory
- 3.2.4 Smart Logistic
- 3.3 Werttreiber Menschen und Umwelt
- 4. Kritische Würdigung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Seminararbeit befasst sich mit der Identifizierung, Gestaltung, Steuerung und Kommunikation der Werttreiber der Industrie 4.0. Sie untersucht die Bedeutung dieser Treiber für den Erfolg von Unternehmen in der digitalen Transformation und analysiert die Auswirkungen auf betriebliche Abläufe, Prozesse und die Rolle des Menschen.
- Bedeutung von Industrie 4.0 und ihren Werttreibern für Unternehmen
- Analyse der wichtigsten Werttreiber der Industrie 4.0
- Bewertung der Auswirkungen von Industrie 4.0 auf die betrieblichen Prozesse
- Die Rolle des Menschen in der digitalen Transformation
- Kritische Würdigung der Herausforderungen und Chancen von Industrie 4.0
Zusammenfassung der Kapitel
Die Arbeit beginnt mit einer Einleitung, die den Hintergrund und die Relevanz des Themas Industrie 4.0 beleuchtet. In Kapitel 2 werden die grundlegenden Konzepte und Definitionen der Industrie 4.0 sowie das Referenzarchitekturmodell RAMI 4.0 vorgestellt.
Kapitel 3 behandelt die wichtigsten Werttreiber der Industrie 4.0, die in drei Kategorien unterteilt werden: Strategie, betriebliche Abläufe / Operations und Menschen und Umwelt. Dieses Kapitel analysiert die Auswirkungen dieser Treiber auf verschiedene Bereiche des Unternehmens und die Rolle der Technologie.
Abschließend wird in Kapitel 4 eine kritische Würdigung der Industrie 4.0 vorgenommen, die sowohl die Herausforderungen als auch die Chancen dieser digitalen Transformation beleuchtet.
Schlüsselwörter
Industrie 4.0, Werttreiber, digitale Transformation, Referenzarchitekturmodell RAMI 4.0, Cyber-Physische Systeme, Internet der Dinge, Smart Factory, Smart Logistic, Mensch-Maschine-Interaktion, Nachhaltigkeit, kritische Würdigung.
- Arbeit zitieren
- Johannes Nass (Autor:in), 2019, Identifizierung, Gestaltung, Steuerung und Kommunikation der Werttreiber der Industrie 4.0, München, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/1274272