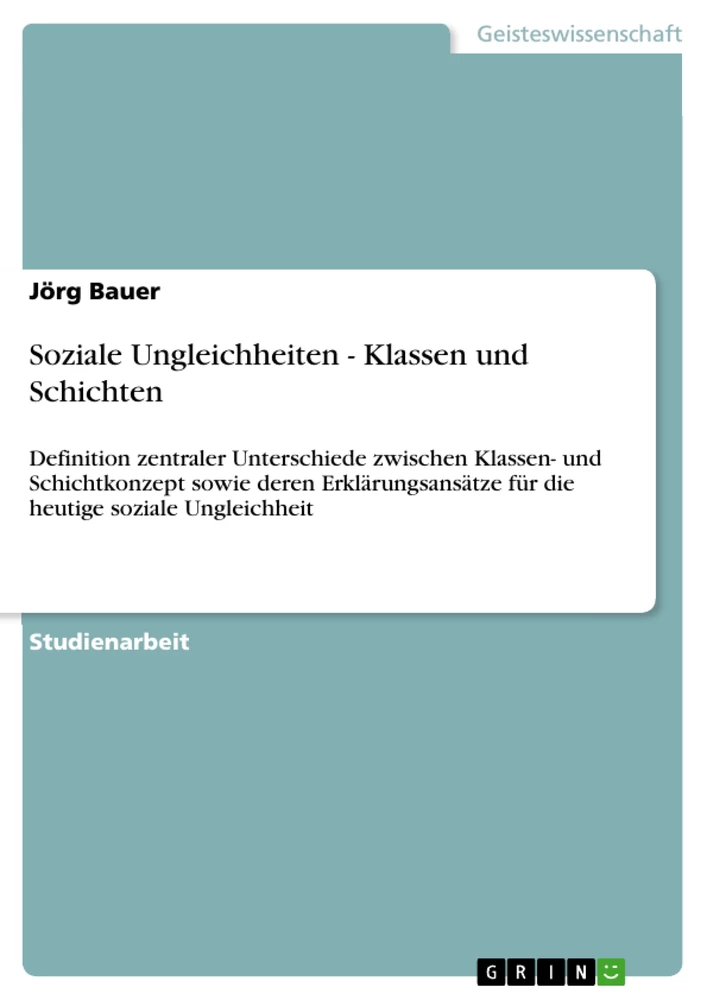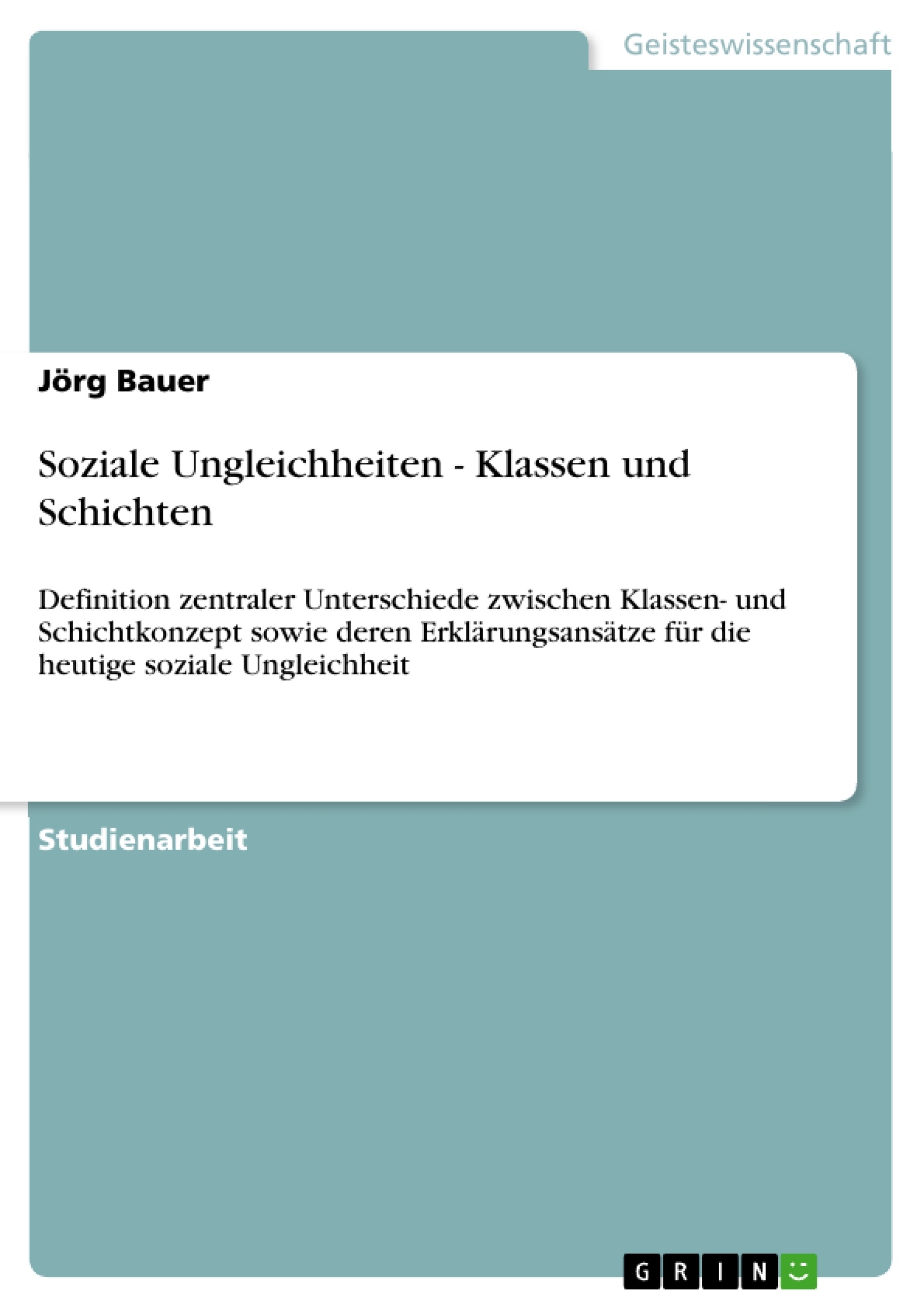Die vorliegende Hausarbeit ist im Rahmen der Lehrveranstaltung
Sozialwissenschaftliche Grundlagen verfasst worden. Sie behandelt den Themenkomplex der Sozialen Ungleichheiten und hat die Intention darzustellen, welches Konzept, Klassen oder Schicht, besser geeignet ist, um heutige Ursachen der sozialen Ungleichheit zu beschreiben. Hierfür ist zu allererst nötig, die
zentralen Unterschiede der beiden Konzepte darzustellen.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Die Unterschiede zwischen Klassen- und Schichtkonzept
- Die Unterschiede zwischen beiden Konzepten
- Klassen- oder Schichtkonzept? Welches ist besser geeignet um soziale Ungleichheit darzustellen?
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit untersucht die Konzepte von Klasse und Schicht zur Erklärung sozialer Ungleichheit. Ziel ist es, die zentralen Unterschiede beider Konzepte herauszuarbeiten und zu beurteilen, welches Konzept besser geeignet ist, die heutigen Ursachen sozialer Ungleichheit zu beschreiben.
- Unterschiede zwischen Klassen- und Schichtkonzept
- Klassenkonzept nach Marx und dessen Weiterentwicklungen
- Schichtkonzept und dessen visuelle Darstellungen (Bolte-Zwiebel, Dahrendorfsches Haus)
- Vergleich der erklärenden und beschreibenden Intentionen beider Konzepte
- Anwendbarkeit der Konzepte auf die heutige soziale Ungleichheit
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Arbeit analysiert die Eignung von Klassen- und Schichtkonzept zur Beschreibung heutiger sozialer Ungleichheiten. Sie beginnt mit der Darstellung der zentralen Unterschiede beider Konzepte als Grundlage für die spätere Bewertung.
Die Unterschiede zwischen Klassen- und Schichtkonzept: Dieses Kapitel beschreibt das Marxsche Klassenkonzept, welches die Gesellschaft in Bourgeoisie und Proletariat unterteilt, basierend auf der Stellung im Produktionsprozess. Es beleuchtet die Weiterentwicklungen des Konzepts durch andere Sozialwissenschaftler, die Zwischenklassen einführten. Im Gegensatz dazu wird das Schichtkonzept nach Geiger vorgestellt, welches die Gesellschaft in verschiedene Schichten mit ähnlichen Lebensbedingungen und psychischen Merkmalen einteilt. Visuelle Darstellungen wie die Bolte-Zwiebel und das Dahrendorfsche Haus werden als Beispiele für Schichtmodelle genannt.
Die Unterschiede zwischen beiden Konzepten: Dieser Abschnitt vergleicht die beiden Konzepte. Das Marxsche Klassenkonzept wird als erklärendes Konzept mit Fokus auf ökonomischer Orientierung und Konfliktpotential zwischen Klassen beschrieben. Das Schichtkonzept hingegen wird als beschreibendes Konzept betrachtet, das die soziale Struktur ohne explizite Konfliktanalyse darstellt. Der Unterschied in der Berücksichtigung sozialer Mobilität und der geschichtlichen Perspektive wird ebenfalls hervorgehoben. Das Klassenkonzept sieht keine sozialen Aufstiege vor, während das Schichtkonzept einen flüssigeren Übergang zwischen Schichten zulässt. Zusätzlich werden unterschiedliche Kriterien zur Schichteinteilung diskutiert.
Klassen- oder Schichtkonzept? Welches ist besser geeignet um soziale Ungleichheit darzustellen?: Dieses Kapitel führt in die Thematik der Ursachen der sozialen Ungleichheit in der heutigen BRD ein und erwähnt Faktoren wie Einkommen als bestimmend für die Schicht- bzw. Klassenzugehörigkeit. Eine detaillierte Auseinandersetzung mit der Eignung der jeweiligen Konzepte zur Beschreibung der heutigen sozialen Ungleichheit folgt im weiteren Verlauf des Textes (der hier nicht wiedergegeben wird um Spoiler zu vermeiden).
Schlüsselwörter
Soziale Ungleichheit, Klassenkonzept, Schichtkonzept, Karl Marx, Theodor Geiger, Bourgeoisie, Proletariat, soziale Mobilität, ökonomische Kriterien, Machtstrukturen, Sozialstruktur Deutschlands.
Häufig gestellte Fragen zur Hausarbeit: Klassen- und Schichtkonzept
Was ist der Gegenstand dieser Hausarbeit?
Die Hausarbeit untersucht und vergleicht die Konzepte von Klasse und Schicht zur Erklärung sozialer Ungleichheit. Sie analysiert die Unterschiede beider Konzepte und bewertet ihre Eignung zur Beschreibung der Ursachen sozialer Ungleichheit in der heutigen Gesellschaft.
Welche Konzepte werden verglichen?
Die Arbeit vergleicht das Klassenkonzept (vor allem nach Marx und dessen Weiterentwicklungen) mit dem Schichtkonzept (z.B. nach Geiger). Dabei werden die jeweiligen Definitionen, die zugrundeliegenden Kriterien und die methodischen Ansätze untersucht.
Welche Unterschiede zwischen Klassen- und Schichtkonzept werden herausgearbeitet?
Die Hausarbeit beschreibt zentrale Unterschiede hinsichtlich der ökonomischen Orientierung (Klassenkonzept als erklärend, Schichtkonzept als beschreibend), der Berücksichtigung sozialer Mobilität (starrer vs. fluider Übergang zwischen den Kategorien), der Konfliktanalyse (explizit im Klassenkonzept, implizit im Schichtkonzept) und der geschichtlichen Perspektive. Visuelle Darstellungen von Schichtmodellen (Bolte-Zwiebel, Dahrendorfsches Haus) werden ebenfalls beleuchtet.
Welches Konzept eignet sich besser zur Darstellung sozialer Ungleichheit?
Die Hausarbeit geht dieser Frage nach, indem sie die Anwendbarkeit beider Konzepte auf die heutige soziale Ungleichheit in Deutschland untersucht und Faktoren wie Einkommen als bestimmend für die Klassen- bzw. Schichtzugehörigkeit erwähnt. Die detaillierte Bewertung der Eignung der jeweiligen Konzepte wird im Hauptteil der Arbeit behandelt (um Spoiler zu vermeiden, ist diese Bewertung hier nicht enthalten).
Welche Schlüsselbegriffe sind relevant für die Hausarbeit?
Wichtige Schlüsselbegriffe sind: Soziale Ungleichheit, Klassenkonzept, Schichtkonzept, Karl Marx, Theodor Geiger, Bourgeoisie, Proletariat, soziale Mobilität, ökonomische Kriterien, Machtstrukturen, Sozialstruktur Deutschlands.
Welche Kapitel enthält die Hausarbeit?
Die Hausarbeit umfasst eine Einleitung, ein Kapitel zu den Unterschieden zwischen Klassen- und Schichtkonzept, ein Kapitel zum Vergleich beider Konzepte und ein Kapitel zur Bewertung der Eignung beider Konzepte zur Darstellung sozialer Ungleichheit. Die Einleitung stellt die Zielsetzung und die Thematik vor, während der Schluss die Ergebnisse zusammenfasst und bewertet.
Welche Zielsetzung verfolgt die Hausarbeit?
Die Zielsetzung der Hausarbeit ist es, die zentralen Unterschiede zwischen dem Klassen- und dem Schichtkonzept herauszuarbeiten und zu beurteilen, welches Konzept besser geeignet ist, die heutigen Ursachen sozialer Ungleichheit zu beschreiben. Es geht also um einen Vergleich der beiden Konzepte unter Berücksichtigung ihrer jeweiligen Stärken und Schwächen.
- Quote paper
- Jörg Bauer (Author), 2007, Soziale Ungleichheiten - Klassen und Schichten, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/127408