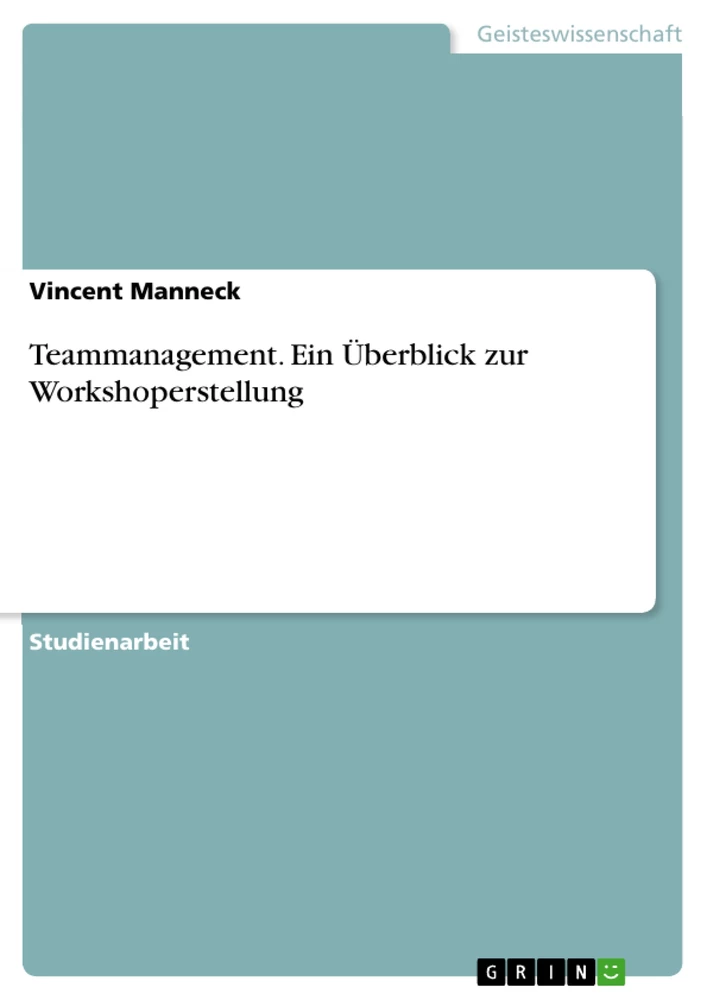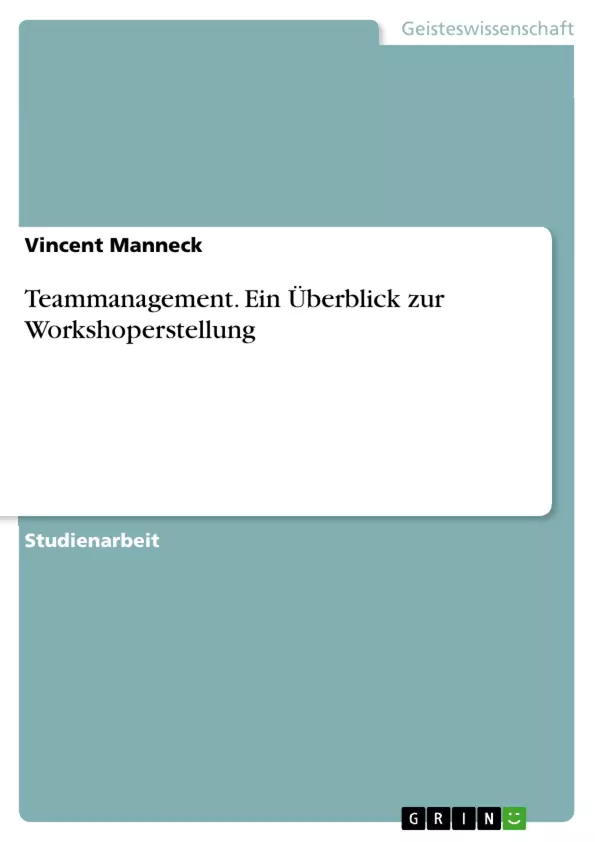In dieser Hausarbeit wird das Thema Teammanagement behandelt. Es wird zunächst ein Einblick in die Theorie geben. Diese Theorie wurde als Basis in einem Workshop verwendet, um den Teilnehmern das Thema nahezulegen. Im Anschluss an die Theorie wird auf den Workshop eingegangen. Es wird auf den Ablauf und die praktischen Übungen eingegangen und erklärt, wie der Workshop aufgebaut war. Als Nächstes wird noch ein möglichst qualitatives Feedback dargelegt, welches den Workshop einer Person des Moduls bewertet.
Inhaltsverzeichnis
- Teams
- Einleitung
- Grundlagen der Teamarbeit
- Interdependenz
- Handlungsautonomie
- Workshop Design
- Inhalt
- Übungen
- Zeitansatz
- Instruktion für Teilnehmer
- Begründung für die Auswahl
- Feedback
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit im Modul Arbeits- und Organisationspsychologie 2 befasst sich mit dem Thema Teammanagement. Sie bietet zunächst einen Einblick in die theoretischen Grundlagen der Teamarbeit, die als Basis für einen dargestellten Workshop dienen. Die Arbeit beleuchtet den Aufbau und die praktischen Übungen des Workshops und präsentiert ein Feedback zur Qualität des Workshops.
- Grundlagen der Teamarbeit
- Merkmale von Teams
- Interdependenz und Handlungsautonomie in Teams
- Workshop-Design und -Umsetzung
- Feedback und Bewertung des Workshops
Zusammenfassung der Kapitel
- Das Kapitel "Teams" führt in die grundlegende Bedeutung und Definition von Teams ein, wobei die historische Entwicklung und moderne Interpretationen des Begriffs "Team" beleuchtet werden.
- Das Kapitel "Grundlagen der Teamarbeit" erläutert die Schlüsselmerkmale von Teams, darunter gemeinsames Ziel, Aufgabeninterdependenzen, Kommunikationsmöglichkeiten, Rollenverteilung und Teamführung. Es definiert die Interdependenz und Handlungsautonomie als wesentliche Elemente der Teamarbeit und beleuchtet ihre Bedeutung für den Erfolg von Teams.
- Das Kapitel "Workshop Design" beschreibt den Aufbau und die Inhalte des Workshops, einschließlich der gewählten Übungen und des zeitlichen Ablaufplans. Es stellt die Instruktion für die Teilnehmer und die rationale Auswahl der Inhalte und Übungen dar.
- Das Kapitel "Begründung für die Auswahl" erläutert die Gründe für die Auswahl der Inhalte und Übungen des Workshops, wobei die Relevanz für die Teilnehmer und die wissenschaftliche Fundierung des Designs hervorgehoben werden.
- Das Kapitel "Feedback" präsentiert eine qualitative Bewertung des Workshops, die von einer Person des Moduls Arbeits- und Organisationspsychologie 2 durchgeführt wurde.
Schlüsselwörter
Teamarbeit, Teammanagement, Interdependenz, Handlungsautonomie, Workshop-Design, Feedback, Arbeits- und Organisationspsychologie, Gruppenarbeit, Zusammenarbeit.
- Quote paper
- Vincent Manneck (Author), 2022, Teammanagement. Ein Überblick zur Workshoperstellung, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/1274032