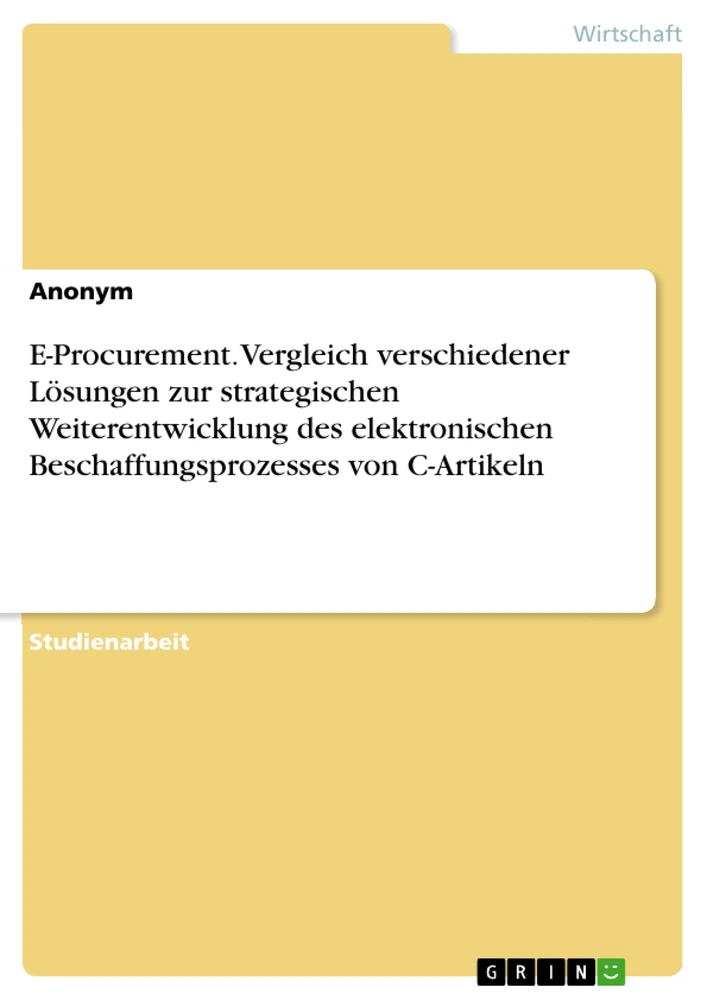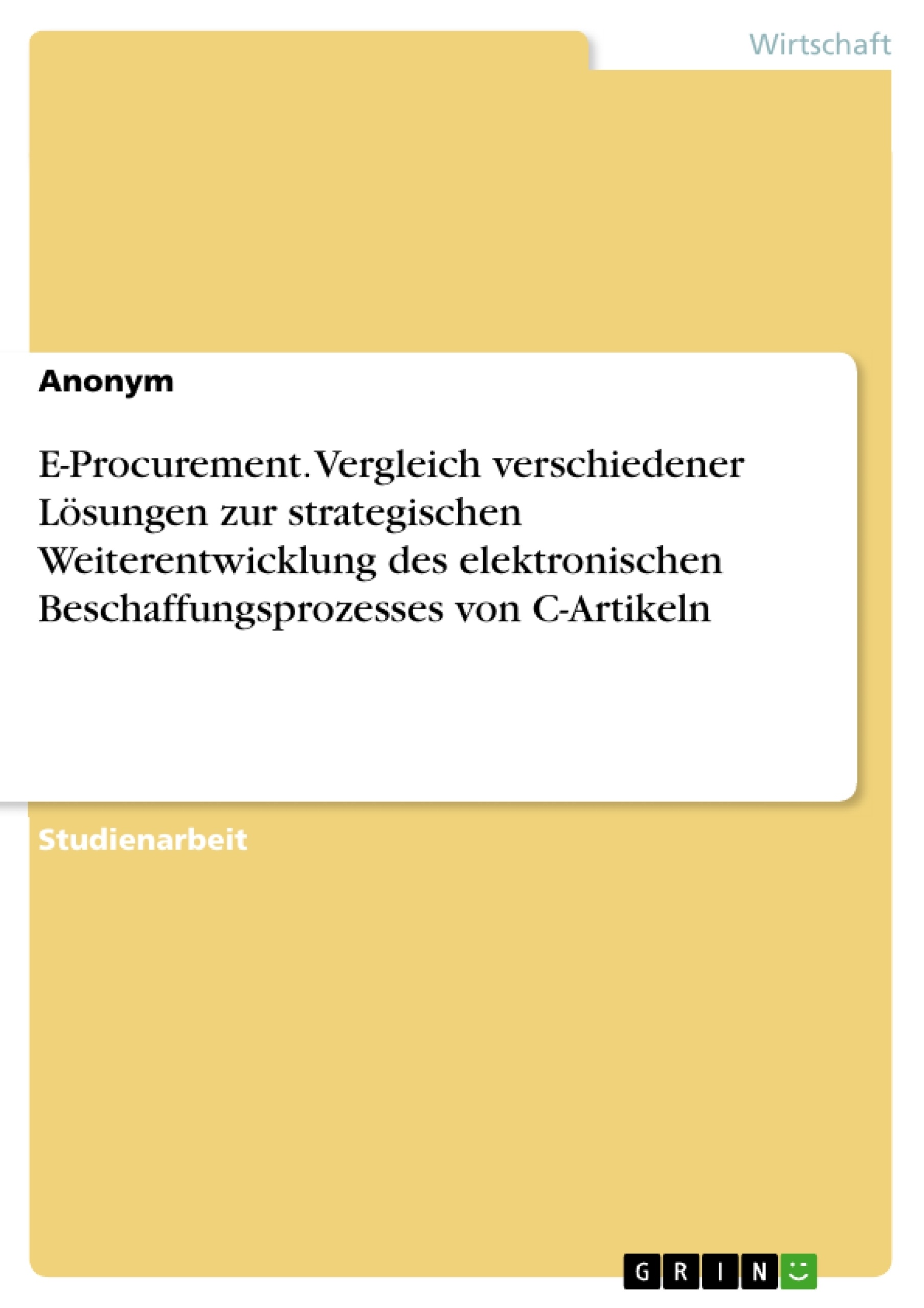Ziel dieser Seminararbeit ist es, die Struktur des bisherigen Beschaffungsprozesses von C-Artikeln bezüglich Optimierungspotenzialen und Prozessverbesserungen für die Firma XXX weiterzuentwickeln. Die Arbeit soll als Entscheidungsstütze bei der Auswahl einer neuen E-Procurement-Lösung dienen.
Unterbrochene Lieferketten, ein zu geringer Vorrat an Produktionsmitteln oder geschlossene Produktionshallen: Wenn indirekte oder direkte Bedarfe fehlen, steht am Ende womöglich die Produktion still. Dies stößt vor allem unternehmensintern auf Unverständnis und sorgt für Reibungspunkte. Der Lockdown in den letzten Monaten hatte insbesondere für den Einkauf von Unternehmen gravierende Auswirkungen und führte bei vielen zu einem Hinterfragen der bisherigen Beschaffungsstrategie.
Dabei wird besonders deutlich, dass die Digitalisierung im Einkauf in vielen Unternehmen noch immer nicht umgesetzt wurde und noch viel zu wenig verbreitet ist. Gut ausgebildete Einkäufer mit entsprechenden fachlichen Qualifikationen sind oft Mangelware und am Arbeitsmarkt sehr gefragt. Der operative Einkauf soll dabei immer mehr automatisiert werden, um die Beschaffungsprozesse effizienter gestalten zu können.
Eine Erkenntnis aus der Krise könnte sein, dass die Digitalisierung im Mittelstand einen extremen Schub bekommen hat und die Bereitschaft hin zu digitalen Prozessen gestiegen ist. So wird aus der Studie des World Economic Forum deutlich, dass rund 86 Prozent der befragten Unternehmen die Digitalisierung von Arbeitsprozessen beschleunigen wollen. Wenn man zusätzlich beachtet, dass durch E-Procurement-Lösungen die Prozesskosten durchschnittlich um 50 Prozent gesenkt werden können, ergibt es durchaus Sinn, sich mit einer konkreten Umsetzungsstrategie zu beschäftigen.
Gerade im indirekten Einkauf werden in vielen Unternehmen die Prozesse noch manuell abgebildet und nicht digital unterstützt. Dies liegt oft an der mangelnden Veränderungsbereitschaft und daran, dass Unternehmen die verfügbaren Systeme als zu kostspielig empfinden. Zudem wird die Umsetzung als zu komplex eingeschätzt, obwohl der Aufwand für die am Markt befindlichen Systeme überschaubar ist, beziehungsweise oft ohne eigene Software möglich ist.
Inhaltsverzeichnis
- 1 Einleitung
- 1.1 Ausgangssituation und Problemstellung
- 1.2 Zielsetzung und Aufbau der Arbeit
- 2 Theoretische Grundlagen des elektronischen Beschaffungsprozesses
- 2.1 E-Procurement
- 2.1.1 Begriffsdefinitionen
- 2.1.2 E-Sourcing
- 2.1.3 E-Business
- 2.2 Entwicklung zum E-Procurement
- 2.2.1 Traditioneller Beschaffungsprozess
- 2.2.2 Beschaffungsprozess mit Hilfe einer E-Procurement-Lösung
- 2.2.3 Geeignete Artikel für E-Procurement-Anwendungen
- 2.3 Gegenüberstellung von E-Procurement-Lösungen
- 2.3.1 Sell-Side-Lösung
- 2.3.2 Buy-Side-Lösung
- 2.3.3 Elektronische Marktplätze
- 2.4 Ziele und Herausforderungen einer E-Procurement-Lösung
- 2.4.1 Quantitative Vorteile
- 2.4.2 Qualitative Vorteile
- 2.4.3 Mögliche Herausforderung bei einer Umstellung des Beschaffungsvorgangs
- 3 E-Procurement im ausgewählten Unternehmen
- 3.1 Struktur des aktuellen Beschaffungsprozesses
- 3.2 Probleme und Schwachstellen
- 3.3 Anforderungen an eine E-Procurement-Lösung
- 3.4 Auswahlkriterien für das Lastenheft
- 4 Möglichkeiten der strategischen Weiterentwicklung des elektronischen Beschaffungsprozesses im ausgewählten Unternehmen
- 4.1 Betrachtung und Vergleich ausgewählter Anbieter
- 4.1.1 E-Ordering Anbieter mit Marktplatzmodell
- 4.1.2 E-Sourcing Anbieter mit ERP-integriertem-Katalogsystem
- 4.1.3 Klassifizierung der verschiedenen Anbieter
- 4.2 Mögliche Zukunftslösung eines E-Procurement-Systems der XXX
- 5 Fazit und Ausblick
- Analyse der aktuellen Beschaffungspraxis bei der XXX
- Bewertung verschiedener E-Procurement-Lösungen
- Identifizierung der Herausforderungen und Chancen der digitalen Transformation im Beschaffungsprozess
- Entwicklung eines Konzeptes für die optimale E-Procurement-Lösung für die XXX
- Kapitel 1: Die Einleitung führt in die Problemstellung ein und erläutert die Zielsetzung der Seminararbeit.
- Kapitel 2: In diesem Kapitel werden die theoretischen Grundlagen des elektronischen Beschaffungsprozesses beleuchtet. Dabei werden verschiedene Begriffsdefinitionen, die Entwicklung zum E-Procurement und die verschiedenen Arten von E-Procurement-Lösungen vorgestellt.
- Kapitel 3: Dieses Kapitel widmet sich der Analyse des aktuellen Beschaffungsprozesses im Unternehmen XXX. Dabei werden die bestehenden Probleme und Schwachstellen aufgezeigt sowie Anforderungen an eine neue E-Procurement-Lösung formuliert.
- Kapitel 4: Im vierten Kapitel werden verschiedene E-Procurement-Anbieter und deren Lösungen vorgestellt und miteinander verglichen. Dabei wird die Eignung der verschiedenen Lösungen für die Anforderungen der XXX bewertet.
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Seminararbeit beschäftigt sich mit der strategischen Weiterentwicklung des elektronischen Beschaffungsprozesses von C-Artikeln im Unternehmen XXX. Dabei steht die Analyse verschiedener E-Procurement-Lösungen und deren Vergleich im Fokus. Die Arbeit verfolgt das Ziel, eine geeignete Lösung für die XXX zu identifizieren, welche die Effizienz und Transparenz des Beschaffungsprozesses steigert.
Zusammenfassung der Kapitel
Schlüsselwörter
Die Seminararbeit befasst sich mit zentralen Aspekten des E-Procurement, darunter elektronische Beschaffung, E-Sourcing, E-Ordering, Marktplatzmodelle, ERP-Integration, digitale Transformation, Effizienzsteigerung und Transparenz im Beschaffungsprozess.
- Arbeit zitieren
- Anonym (Autor:in), 2021, E-Procurement. Vergleich verschiedener Lösungen zur strategischen Weiterentwicklung des elektronischen Beschaffungsprozesses von C-Artikeln, München, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/1273979