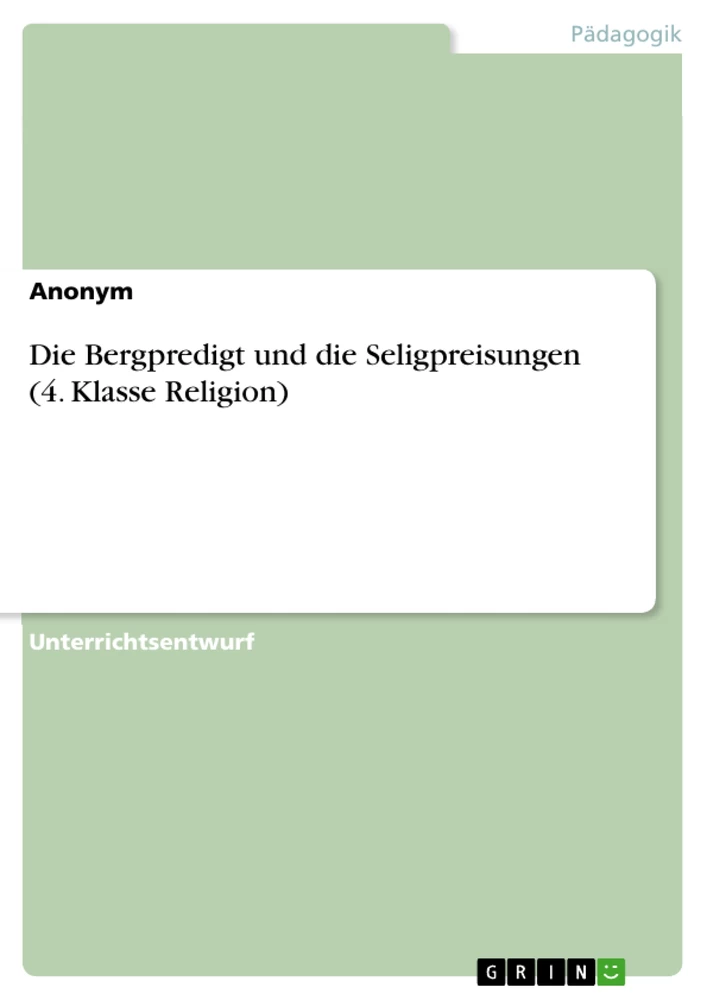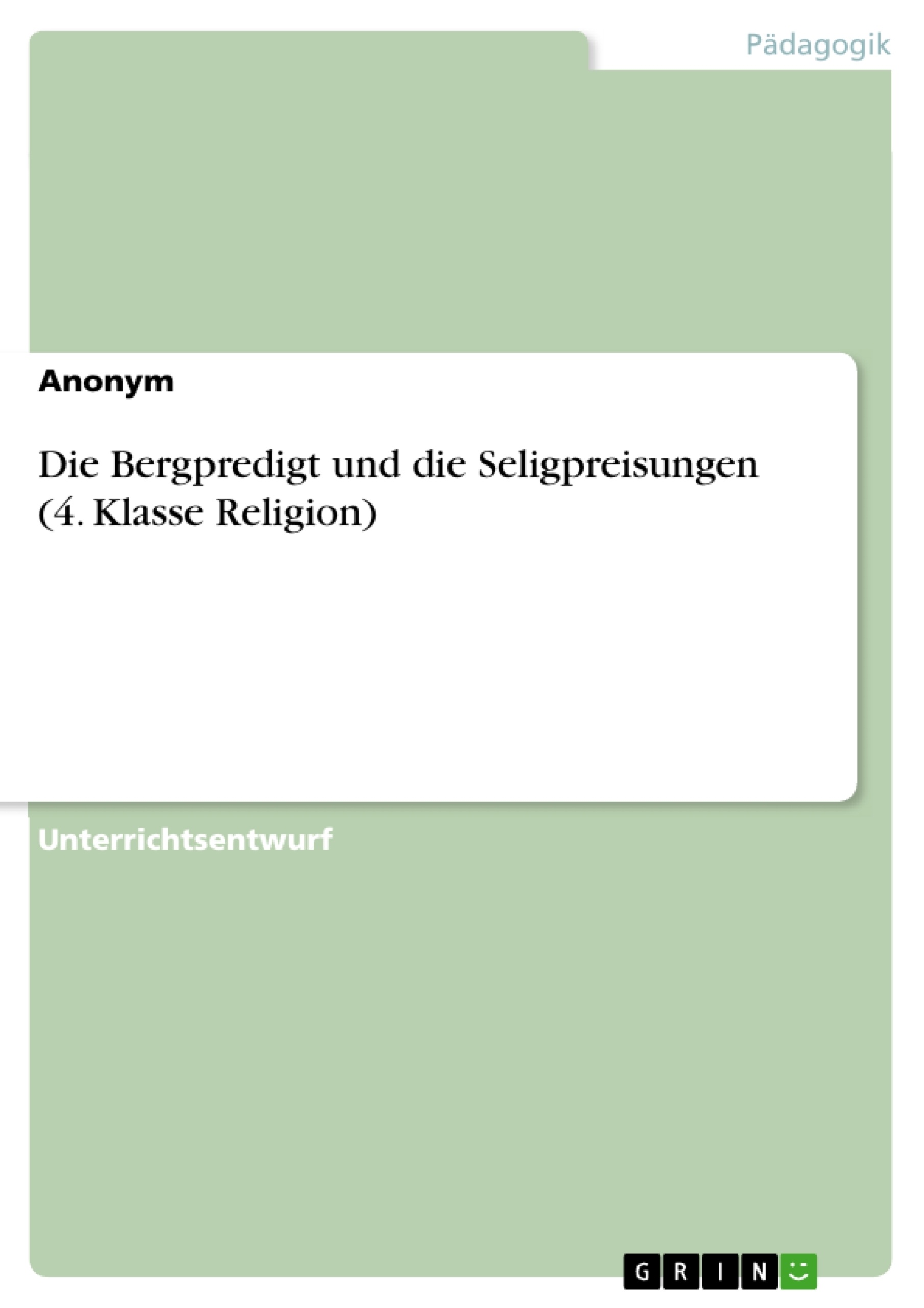Bei der vorliegenden schriftlichen Ausarbeitung handelt es sich um einen Unterrichtsentwurf des Fachbereiches Evangelische Religion. Der Unterrichtsentwurf enthält die Konzeption einer vollständigen Unterrichtreihe zum Thema „Die Bergpredigt“ mit der Darstellung einer ausführlich dargestellten Unterrichtssequenz zu den Seligpreisungen mit dem Thema „Die Seligpreisungen – heute“. Einführend werden die Rahmenbedingungen des geplanten Unterrichts definiert. Anschließend werden die Vorkenntnisse der Schülerinnen und Schüler (SuS) dargelegt.
Im Folgenden wird ein Bezug zu der curricularen Anbindung der Unterrichtsreihe „Die Bergpredigt“ geschaffen. Danach werden die didaktischen Entscheidungen der ausführlichen Unterrichtssequenz dargelegt. Unter anderem wird sich hierfür auf die zuvor herausgearbeiteten Erkenntnisse sowie auf den Lehrplan bezogen. Das abschließende Kapitel umfasst die Beschreibung der gesamten Unterrichtsreihe, wie auch der ausführlich dargestellten Unterrichtseinheit.
Inhaltsverzeichnis
- Thema und Inhalt der Unterrichtsreihe/ der ausführlichen Unterrichtssequenz
- Lernvoraussetzungen mit Hinblick auf die Unterrichtsreihe/ Unterrichtssequenz
- Rahmenbedingungen
- Lernausgangslage
- Fachlich-inhaltliche Schwerpunkte
- Exegetische Hinführung
- Ausführliche Didaktische Analyse
- Lern- und Kompetenzzuwächse
- Angestrebte Kompetenzerweiterung
- Kompetenzerweiterung der Unterrichtsreihe
- Evaluation des Gelernten
- Didaktische Entscheidungen der Unterrichtssequenz
- Curriculare Anbindung
- Methodische Schwerpunkte
- Beschreibung der Unterrichtsreihe und der ausführlichen Unterrichtssequenz
- Skizze des Lernprozesses der Unterrichtsreihe
- Beschreibung der ausführlichen Unterrichtssequenz
- Skizze der Unterrichtssequenzen – Einheit 2 bis 5
- Synoptische Darstellung der ausführlichen Doppelstunde
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende schriftliche Ausarbeitung stellt einen Unterrichtsentwurf für den Fachbereich Evangelische Religion dar. Der Entwurf umfasst die Konzeption einer vollständigen Unterrichtsreihe zum Thema „Die Bergpredigt“ und die Darstellung einer ausführlichen Unterrichtssequenz zu den Seligpreisungen mit dem Thema „Die Seligpreisungen – heute“.
- Definition der Rahmenbedingungen des Unterrichts
- Darlegung der Vorkenntnisse der Schülerinnen und Schüler
- Exegetische Hinführung zur Bergpredigt
- Didaktische Analyse der Seligpreisungen
- Entwicklung von Lern- und Kompetenzzielen
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel stellt die Lernvoraussetzungen und Rahmenbedingungen des Unterrichts vor, wobei die fiktive Lerngruppe und ihre Ausgangssituation detailliert beschrieben werden. Das zweite Kapitel widmet sich den fachlich-inhaltlichen Schwerpunkten, insbesondere der exegetischen Hinführung zur Bergpredigt und deren Bedeutung im Kontext des Neuen Testaments. Im dritten Kapitel werden die Lern- und Kompetenzzuwächse der Unterrichtsreihe und der ausführlichen Unterrichtssequenz erörtert, einschließlich der angestrebten Kompetenzerweiterung und der Evaluation des Gelernten. Kapitel 4 behandelt die didaktischen Entscheidungen der Unterrichtssequenz, darunter die curriculare Anbindung und methodische Schwerpunkte. In Kapitel 5 wird die Unterrichtsreihe selbst beschrieben, wobei die Skizze des Lernprozesses, die Darstellung der ausführlichen Unterrichtssequenz und ein Überblick über weitere Einheiten sowie die synoptische Darstellung der Doppelstunde vorgestellt werden.
Schlüsselwörter
Bergpredigt, Seligpreisungen, Evangelische Religion, Unterrichtsentwurf, Exegese, Didaktische Analyse, Kompetenzerweiterung, Curriculare Anbindung, Methodische Schwerpunkte, Unterrichtssequenz
- Quote paper
- Anonym (Author), 2022, Die Bergpredigt und die Seligpreisungen (4. Klasse Religion), Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/1273766