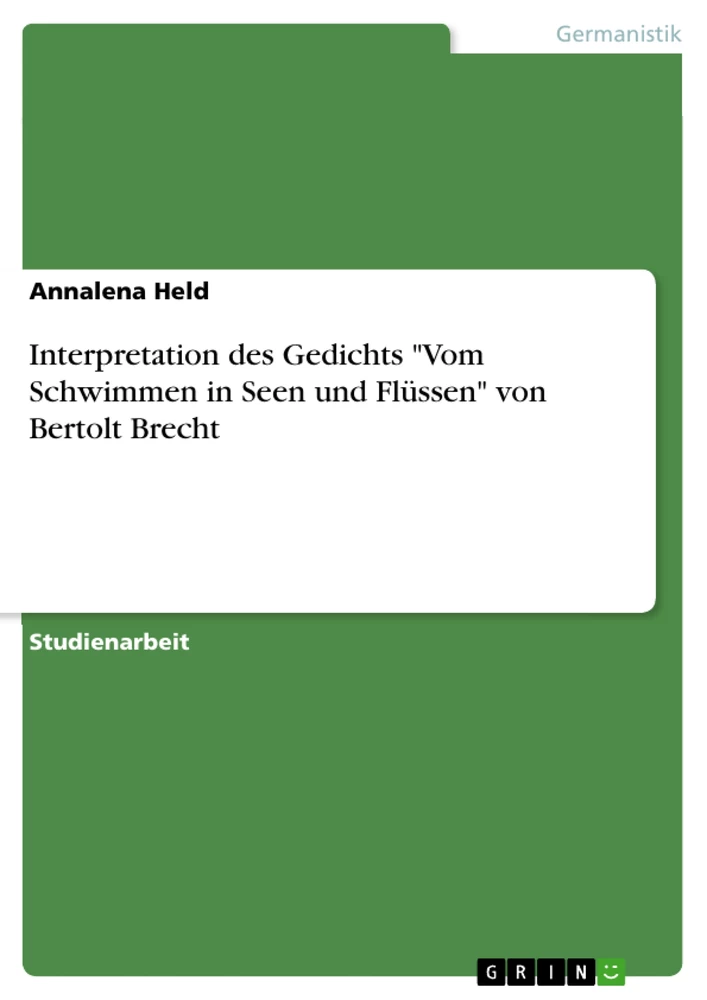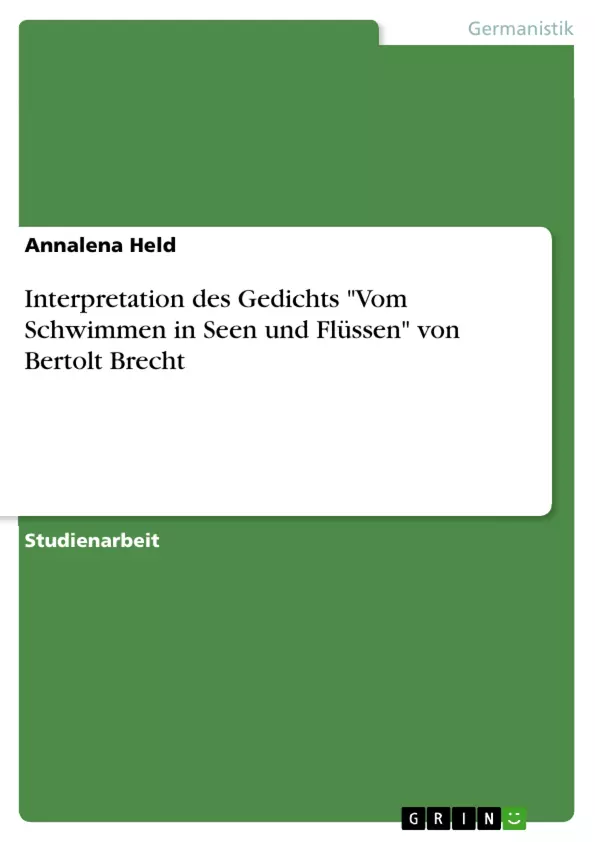Die Arbeit analysiert und interpretiert das Gedicht "Vom Schwimmen in Seen und Flüssen" von Bertolt Brecht. Dabei geht sie auf folgende Aspekte ein: Autorbezug und Erlebnisbericht, Auflösung der Sprechinstanz, Naturgedicht?, Einordnung und Begründung der Polysemie, Religiöses im Text: Schöpfung und Tod.
Roman Jakobson untersuchte die Sprache anhand von sechs Funktionen. Die jeweils dominierende Funktion bestimmt die Struktur der Mitteilung. Literatur ist gekennzeichnet durch ein Überwiegen der poetischen Funktion. Diese ist die Ausrichtung auf die Botschaft, wobei es nicht um den Inhalt geht, sondern darum, wie die Sprache verfährt und welche Struktur sie hat.
Indem sie das Augenmerk auf die Spürbarkeit der Zeichen richtet, vertieft diese Funktion die fundamentale Dichotomie der Zeichen und Objekte. Einerseits tritt die poetische Funktion nicht nur in der Dichtung auf, andererseits sind auch die poetischen Genres nicht allein durch die poetische Funktion gekennzeichnet, sondern auch durch andere sprachliche Funktionen. So ist die Lyrik eng mit der emotiven Funktion verbunden. Diese bringt die Haltung des Sprechers zum Gesprochenen unmittelbar zum Ausdruck.
In dem Gedicht "Vom Schwimmen in Seen und Flüssen" von Bertolt Brecht wird die poetische Funktion schnell anhand der Reime sichtbar. Selektion ist die Auswahl aus bedeutungsähnlichen Wörtern und Kombination die Bildung einer Sequenz. Durch die Auswahl von ähnlichen Wörtern, die sich reimen und deren Kombination ergeben sich Parallelismen im Gedicht.
Im Gedicht finden sich noch einige weitere Äquivalenzen wie Alliterationen, auf die in der Analyse näher eingegangen werden soll. Jakobson schreibt, dass es durch eine Wiederkehr gewisser Folgen von Silben und Rhythmen auch zu einer Wiederholung von Worten und Gedanken kommt. Das wird bei Brecht besonders deutlich, da Bilder im Gedicht immer wieder in leicht veränderter Form auftreten.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Analyse
- Interpretation
- Jakobson und die poetische Funktion
- Das lyrische Ich
- Vom Schwimmen im Fluss der Sprache
- Schluss
- Literaturverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Hausarbeit analysiert und interpretiert Bertolt Brechts Gedicht „Vom Schwimmen in Seen und Flüssen“. Im Fokus steht die Analyse der poetischen Funktion der Sprache, die durch das Gedicht hervorgehoben wird. Besonderes Augenmerk gilt dabei der Verbindung von poetischer Funktion und referentieller Funktion.
- Analyse der poetischen Funktion in Brechts Gedicht
- Untersuchung der sprachlichen Gestaltungsmittel
- Interpretation der Beziehung zwischen Sprache und Realität
- Erörterung der Rolle des lyrischen Ichs
- Rezeption und Bedeutung des Gedichts
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung
Die Einleitung stellt die theoretische Grundlage der Analyse dar. Sie bezieht sich auf Roman Jakobson und seine sechs Sprachfunktionen, wobei die poetische Funktion im Mittelpunkt steht. Die Einleitung erläutert die Bedeutung der poetischen Funktion für Literatur und führt in das Gedicht „Vom Schwimmen in Seen und Flüssen“ ein.
Analyse
Die Analyse untersucht die formale Gestaltung des Gedichts. Es werden die Metrik, das Reimschema, der Satzbau und die sprachlichen Mittel wie Alliteration, Assonanz und Binnenreime analysiert. Die Analyse unterstreicht die Besonderheiten der Sprache, die durch die poetische Funktion entstehen. Die Strophen werden hinsichtlich ihrer thematischen Schwerpunkte untersucht.
Interpretation
Die Interpretation befasst sich mit der Bedeutung des Gedichts. Sie interpretiert die sprachlichen Bilder und die Rolle des lyrischen Ichs. Es wird die Frage nach der Beziehung von Sprache und Wirklichkeit gestellt und die Bedeutung des Gedichts für die Rezeption Brechts gewürdigt.
Schlüsselwörter
Die Arbeit befasst sich mit den Themen Gedichtanalyse, poetische Funktion, referentielle Funktion, Bertolt Brecht, Lyrik, Sprache, Bildsprache, Metrik, Reim, Satzbau, Alliteration, Assonanz, Binnenreim, lyrisches Ich.
- Arbeit zitieren
- Annalena Held (Autor:in), 2015, Interpretation des Gedichts "Vom Schwimmen in Seen und Flüssen" von Bertolt Brecht, München, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/1273682