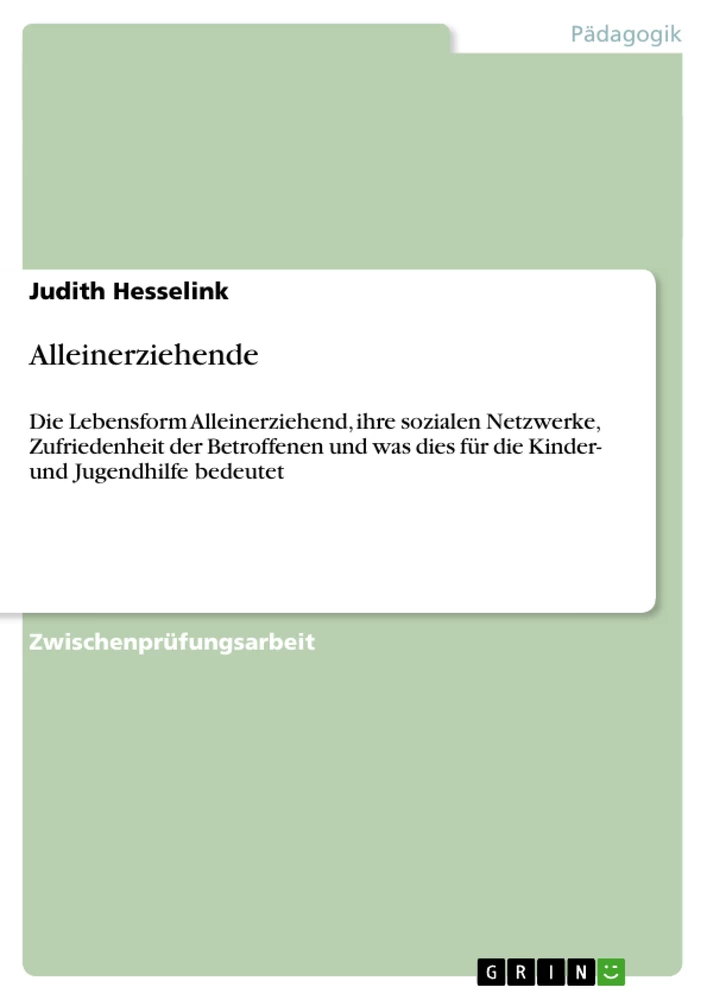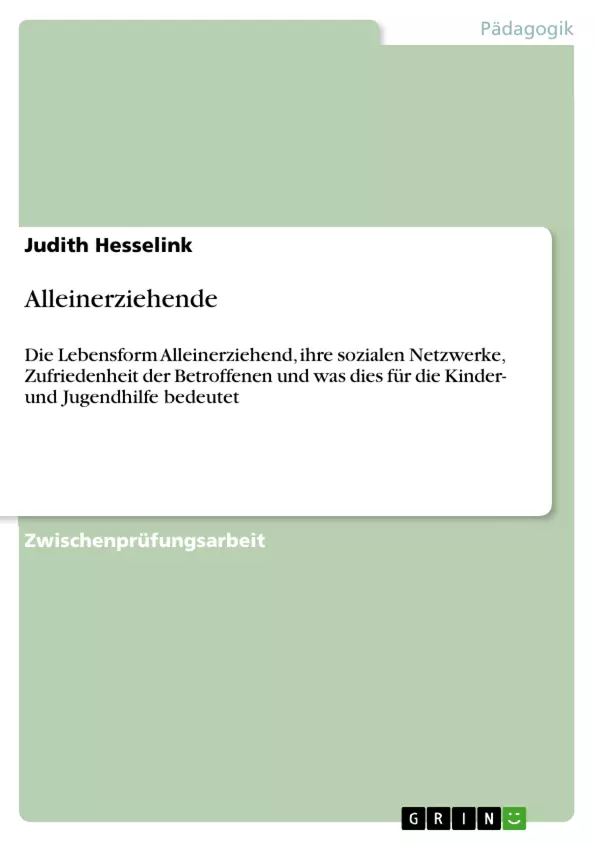„Familie hat heute viele Formen. Im April 2002 lebten in Deutschland fast 81% der Bevölkerung
in Familien, einschließlich Ehepaaren, die keine Kinder (mehr) im Haushalt haben. Rund
54 % der Bevölkerung bildeten Eltern-Kind-Gemeinschaften mit gemeinsamer Haushaltsführung.
Zur selben Zeit gab es 2,4 Mio. Alleinerziehende, darunter 87 % allein erziehende Frauen
mit minderjährigen Kindern.“ (BMFSFJ 2004: 74)
Obgleich nicht von einem allgemeinem Trend zum Single-Dasein ausgegangen werden kann
und Untersuchungen belegen, dass Familie und Partnerschaft nach wie vor einen hohen Stellenwert
einnehmen, verdeutlichen derlei statistische Werte doch deutlich, dass die Lebensform „Familie“ heute viele Gesichter hat und sowohl „von einer ´Normalisierung` nicht ehelicher
Lebensformen gesprochen werden [kann]“ (BMFSFJ 2004: 98), als auch von einer
„Entnormalisierung“ von Familienformen und Lebensverläufen (vgl. Brand & Hammer 2002:
13) ausgegangen werden kann.
Die vorliegende Arbeit fokussiert die Lebensform „Alleinerziehend“. Sie wird sich nicht nur
damit auseinandersetzen, in wie fern sich diese Lebensform etabliert hat und wie weit sie verbreitet
ist, sondern will vor Allem die Zufriedenheit der Betroffenen mit ihrer Lebenssituation
thematisieren, um so eine Aussage darüber treffen zu könne, in wie fern die Lebenssituation
Alleinerziehender ein Themen- und Aufgabenbereich ist, der auch für die Sozialpolitik von
Interesse ist. Diese Zufriedenheit soll sich allerdings nicht auf die bereits mehrfach untersuchte
Lebenszufriedenheit in Bezug auf die ökonomische und/oder berufliche Situation beziehen,
sondern vielmehr hinterfragen, ob sich Aussagen darüber treffen lassen, in wie fern der Entstehungszusammenhang
der Lebensform „Alleinerziehend“ und die Unterstützung durch soziale
und familiale Netzwerke einhergeht mit einem gewissen Grad an Zufriedenheit. Dazu muss in einem ersten Schritt geklärt werden, was die Lebensform „Alleinerziehend“
ausmacht, also auch, wie sich ihre gesellschaftliche Entwicklung und Anerkennung darstellt.
Im weiteren Verlauf der Arbeit werden zwei Studien über die Lebensform „Alleinerziehend“
dargestellt. [...]
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Die Lebensform „Alleinerziehend“
- Gesellschaftliche Entwicklung und Akzeptanz
- Die Niepel-Studie
- Zur Studie: Aufbau, Durchführung, Untersuchungsziele
- Begriffsbestimmungen
- „Soziales Netzwerk“
- „Soziale Unterstützung“
- Untersuchungsergebnisse
- Veränderungen der Netzwerke durch die Einelternschaft
- Netzwerktypen alleinerziehender Frauen
- Zufriedenheit der Alleinerziehenden mit ihren Netzwerken
- Zufriedenheit der Alleinerziehenden mit der erhaltenen sozialen Unterstützung
- Die Schneider-Studie
- Der Aufbau der Studie
- Entstehungszusammenhänge
- Der Selbstbestimmtheitsgrad der Lebensform Alleinerziehend
- Berücksichtigung der Ergebnisse von Seiten der Bundesregierung
- Die Lebensform „Alleinerziehend“ im Achten Kinder- und Jugendbericht
- Die Lebensform „Alleinerziehend“ im Elften Kinder- und Jugendbericht
- Resümee
- Anlage 1: Darstellung der Netzwerktypen Alleinerziehender
- Freundschaftsnetzwerk (Typ 1)
- Loseres Familien- und Freundschaftsnetzwerk (Typ 2a)
- Dichtes Familien- und Freundschaftsnetzwerk (Typ 2b)
- Familiennetzwerk (Typ 3)
- Anlage 2: Die Darstellung der einzelnen Gruppen der Lebensform „Alleinerziehend“
- Freiwillig Alleinerziehende
- Bedingt freiwillig Alleinerziehende
- Zwangsläufig Alleinerziehende
- Ungewollt Alleinerziehende
- Bilanz der Zuordnungen
- Literaturverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit befasst sich mit der Lebensform „Alleinerziehend“ und untersucht deren gesellschaftliche Entwicklung, Akzeptanz und die Zufriedenheit der Betroffenen mit ihrer Lebenssituation. Sie analysiert zwei Studien, die sich mit den sozialen Netzwerken, der Unterstützung durch familiale und soziale Gefüge sowie dem Entstehungszusammenhang und dem Selbstbestimmtheitsgrad der Lebensform „Alleinerziehend“ auseinandersetzen. Darüber hinaus wird untersucht, ob sich die Bundesregierung in ihren Sozialberichten an den aktuellen empirischen Studienergebnissen orientiert. Die Arbeit zielt darauf ab, die Relevanz der Lebenssituation Alleinerziehender in der Sozialpolitik zu beleuchten und Handlungsempfehlungen für die Praxis abzuleiten.
- Gesellschaftliche Entwicklung und Akzeptanz der Lebensform „Alleinerziehend“
- Zufriedenheit Alleinerziehender mit ihrer Lebenssituation
- Soziale Netzwerke und Unterstützung durch familiale und soziale Gefüge
- Entstehungszusammenhang und Selbstbestimmtheitsgrad der Lebensform „Alleinerziehend“
- Relevanz der Lebenssituation Alleinerziehender in der Sozialpolitik
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in die Thematik der Lebensform „Alleinerziehend“ ein und stellt die Relevanz der Untersuchung dar. Sie beleuchtet die gesellschaftliche Entwicklung und Akzeptanz der Lebensform „Alleinerziehend“ im Kontext der Pluralisierung von Familienformen und Lebensverläufen. Die Arbeit fokussiert die Zufriedenheit der Alleinerziehenden mit ihrer Lebenssituation und untersucht, inwiefern der Entstehungshintergrund der Lebensform und die Unterstützung durch soziale und familiale Netzwerke mit einem gewissen Grad an Zufriedenheit einhergehen.
Das zweite Kapitel befasst sich mit der gesellschaftlichen Entwicklung und Akzeptanz der Lebensform „Alleinerziehend“. Es wird die historische Entwicklung der Familie als Institution und die Veränderung des Familienbildes im Laufe der Zeit beleuchtet. Die Arbeit zeigt auf, dass die Lebensform „Alleinerziehend“ sich von einer abweichenden, pathogenen Lebensform zu einer akzeptierten Option im Lebensverlauf entwickelt hat. Die Pluralisierung von Familienformen und Lebensverläufen wird als wichtiger Kontext für die Etablierung der Lebensform „Alleinerziehend“ dargestellt.
Das dritte Kapitel präsentiert die Niepel-Studie, die sich mit der Zufriedenheit Alleinerziehender im Kontext ihrer sozialen Netzwerke und Unterstützung durch familiale und soziale Gefüge auseinandersetzt. Die Studie untersucht die Veränderungen der Netzwerke durch die Einelternschaft, die verschiedenen Netzwerktypen alleinerziehender Frauen und die Zufriedenheit der Alleinerziehenden mit ihren Netzwerken und der erhaltenen sozialen Unterstützung. Die Ergebnisse der Studie liefern wichtige Erkenntnisse über die Bedeutung sozialer Netzwerke für die Lebenszufriedenheit Alleinerziehender.
Das vierte Kapitel stellt die Schneider-Studie vor, die sich mit dem Entstehungszusammenhang und dem Selbstbestimmtheitsgrad der Lebensform „Alleinerziehend“ auseinandersetzt. Die Studie untersucht die verschiedenen Entstehungszusammenhänge der Lebensform und analysiert, inwiefern die Alleinerziehenden ihre Lebenssituation als selbstbestimmt erleben. Die Ergebnisse der Studie liefern wichtige Erkenntnisse über die subjektive Wahrnehmung der Lebensform „Alleinerziehend“ und die Herausforderungen, die mit ihr verbunden sind.
Das fünfte Kapitel untersucht, ob sich die Bundesregierung in ihren Sozialberichten an den aktuellen empirischen Studienergebnissen orientiert. Es werden zwei Kinder- und Jugendberichte im Hinblick auf das ihnen zugrunde liegende Bild der Lebensform „Alleinerziehend“ analysiert. Die Arbeit beleuchtet die Sichtweise der Bundesregierung auf die Lebenssituation Alleinerziehender und stellt die Frage, inwiefern diese Sichtweise angebracht ist oder verändert werden muss.
Schlüsselwörter
Die Schlüsselwörter und Schwerpunktthemen des Textes umfassen die Lebensform „Alleinerziehend“, gesellschaftliche Entwicklung, Akzeptanz, Zufriedenheit, soziale Netzwerke, familiale Unterstützung, Entstehungszusammenhang, Selbstbestimmtheitsgrad, Sozialpolitik, Kinder- und Jugendberichte, empirische Forschung, Familienformen, Lebensverläufe, Pluralisierung, Individualisierung.
- Arbeit zitieren
- Judith Hesselink (Autor:in), 2007, Alleinerziehende, München, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/127163