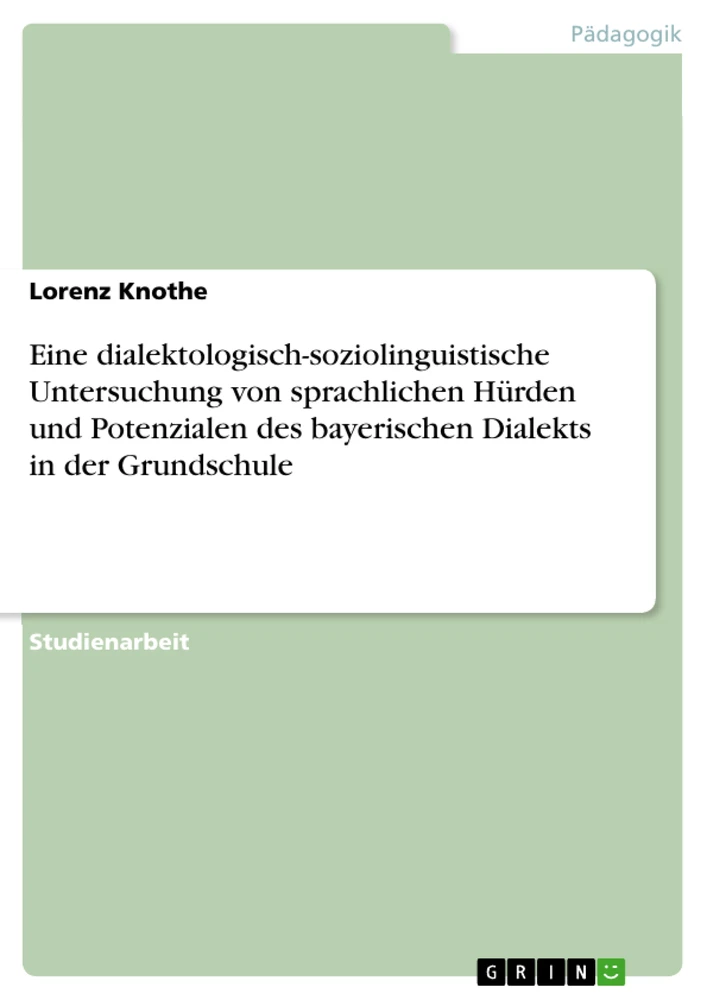Anfangs wird ein historisches, soziolinguistisches Bild des bayerischen Dialekts und der Standard - bzw. Hochsprache gezeichnet, wobei sich in diesem Zusammenhang der Schwerpunkt auf das historisch gewachsene Spannungsverhältnis der beiden linguistischen Strömungen richtet. Den zentralen Gegenstand dieser Arbeit bilden kognitionspsychologische und pädagogisch-linguistische Forschungsergebnisse zum Thema Mehrsprachigkeit und dialektale Präsenz in der Grundschule.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Bayerische Dialektgeschichte: Zwischen Hochdeutsch und bayerisch
- Frühes Mittelalter: Althochdeutsche Sprachbereich
- Luthers Erbe und das Maul des Volkes
- Die Zeit der Regeln und Normen: Sprachliche Normierung durch Normierungsbücher.
- Der Bayerische Dialekt
- Regionale Eingrenzung
- Binnengliederung
- Sprachdimensionen des Dialekts:
- Sprachverhältnis: Dialekt-Standardsprache und Aspekte der Mehrsprachigkeit.
- Verhältnis Standardsprache und Dialekt
- Rationales Modell und romantisches Modell von Sprache.
- Anwendungsbereich Dialekt und Standardsprache
- Schriftspracherwerb in der Grundschule als Erwerb der Standardsprache.
- Innere/dialektale Mehrsprachigkeit
- Potenziale der inneren bzw. dialektalen Mehrsprachigkeit
- Wissenschaftlicher Wegbereiter: Die PISA Studien 2012/13
- Interkomprehensionsfähigkeit als Potenzial für interlinguales Verstehen
- Code Switching Fähigkeit als Potenzial für abstraktes Denken und Erweiterung des Sprachbewusstseins.
- Sprachbarriere im dialektalen Sprachgebrauch
- Der Terminus Sprachbarriere
- Ergebnisse dialektaler Fehlerforschung im Bereich der Sprachbarriere
- Analyse der Fehlerquellen
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit untersucht die sprachlichen Hürden und Potenziale des bayerischen Dialekts im Kontext des Schriftspracherwerbs in der Grundschule. Ziel ist es, die Auswirkungen der dialektalen Prägung auf den Erwerb der Standardsprache zu analysieren und die Rolle von Mehrsprachigkeit in diesem Zusammenhang zu beleuchten.
- Historische Entwicklung des bayerischen Dialekts und seine Beziehung zur Standardsprache
- Sprachbarrieren, die durch den dialektalen Sprachgebrauch im schulischen Kontext entstehen können
- Potenziale der inneren/dialektalen Mehrsprachigkeit für den Sprach- und Denkentwicklung
- Kognitionspsychologische und pädagogisch-linguistische Forschungsergebnisse zum Thema Mehrsprachigkeit und dialektale Präsenz in der Grundschule
- Analyse der Fehlerquellen, die im Zusammenhang mit der dialektalen Prägung im Schriftspracherwerb auftreten
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung beleuchtet die aktuelle Debatte um den Dialekt in Bayern und die Bedeutung des Themas im Kontext der Bildungspolitik. Das erste Kapitel zeichnet ein historisches Bild des bayerischen Dialekts und der Standardsprache, wobei das Spannungsverhältnis zwischen den beiden Sprachen im Fokus steht. Das zweite Kapitel beschäftigt sich mit dem Sprachverhältnis zwischen Dialekt und Standardsprache und beleuchtet die verschiedenen Aspekte der Mehrsprachigkeit in diesem Zusammenhang. Im dritten Kapitel werden die Potenziale der inneren/dialektalen Mehrsprachigkeit für den Sprach- und Denkentwicklung aufgezeigt. Das vierte Kapitel widmet sich den sprachlichen Hürden, die durch den dialektalen Sprachgebrauch im schulischen Kontext entstehen können. Es werden Ergebnisse der Fehlerforschung im Bereich der Sprachbarriere sowie die Analyse der Fehlerquellen vorgestellt.
Schlüsselwörter
Bayerischer Dialekt, Standardsprache, Mehrsprachigkeit, Sprachbarrieren, Schriftspracherwerb, Grundschule, Kognitionspsychologie, Sprachdidaktik, PISA-Studien, Code Switching, Interkomprehensionsfähigkeit
- Arbeit zitieren
- Lorenz Knothe (Autor:in), 2020, Eine dialektologisch-soziolinguistische Untersuchung von sprachlichen Hürden und Potenzialen des bayerischen Dialekts in der Grundschule, München, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/1271605