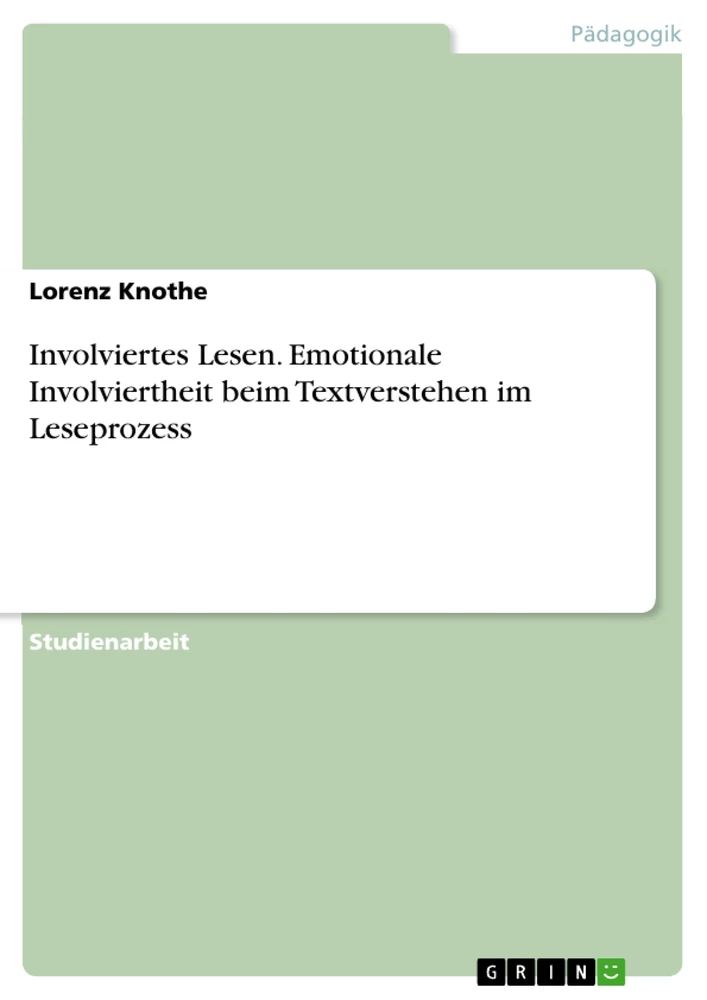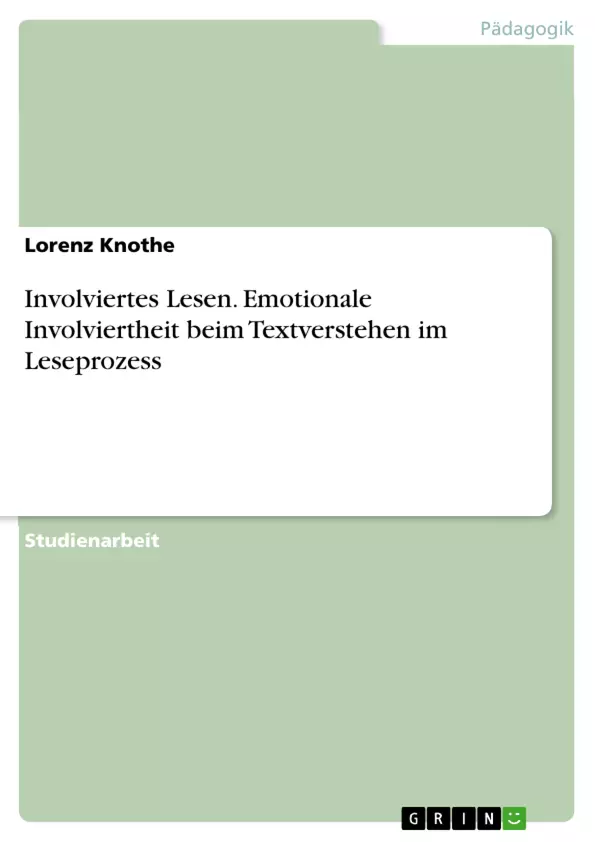Diese Hausarbeit geht der Frage nach, welchen Einfluss die emotionale Involviertheit auf den kognitiven Vorgang des Textverstehens beim Lesevorgang hat. Speziell soll also in dieser Arbeit betrachtet werden, wie sich Stimmungseinflüsse auf Sprachrezeptionsprozesse im Bereich des Textverstehens verhalten.
Anfangs werde ich mit begrifflichen Definitionen in den Problembereich Emotion und Kognition einführen. Im Anschluss folgt ein kurzer Exkurs in die Grundlagenforschung des Textverstehens und der Lesekompetenzforschung, Dies soll ein zentrales Bindeglied der vorangegangenen Elemente darstellen und Lesen als emotionalen und kognitiven Verarbeitungsprozess verdeutlichen. Darauf aufbauend möchte ich den wegweisenden Begriff der Involviertheit vorstellen, um ihn im Anschluss in den Lesekompetenzdiskurs einzugliedern. Mit Hilfe des Stimmungskongruenzeffekts (nach Hielscher 1996) möchte ich abschließend die Effekte emotionaler Involviertheit auf das kognitive Textverstehen aufzeigen.
Inhaltsverzeichnis
- Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Emotionen und Kognition: Einführung in den Problembereich
- Emotion und Stimmung: Definition und Abgrenzung von Begriffen
- Emotionen
- Grundemotionen des Menschen
- Stimmung und Gefühl
- Kognition
- Verhältnis Emotion und Kognition
- Emotion und Stimmung: Definition und Abgrenzung von Begriffen
- Lesen als kognitiver Konstruktionsprozess:
- Grundlagen der Textverstehensprozesse
- Der Begriff der Lesekompetenz am Ebenmodell nach Rosebrock und Nix (2008)
- Emotionale Involviertheit im Leseprozess
- Involviertes Lesen als Teil der Lesekompetenz nach Artelt (2007)
- Leseinteresse und Lesemotivation als Ausgangsvoraussetzung für involviertes Lesen
- Stimmungskongruenzeffekt als Messgegenstand der kognitiven Verarbeitung emotionaler Zustände und Teilbereich involvierten Lesens
- Zusammenfassung
- Literaturverzeichnis
- Beitrag
- Buch (Monographie)
- Buch (Sammelwerk)
- Hochschulschrift
- Zeitschriftenaufsatz
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit untersucht den Einfluss emotionaler Involviertheit auf das kognitive Textverstehen während des Leseprozesses. Es wird analysiert, wie sich Stimmungseinflüsse auf die Sprachrezeption und das Textverständnis auswirken. Die Arbeit verbindet begriffliche Definitionen von Emotion und Kognition mit Grundlagen der Textverstehensprozesse und der Lesekompetenzforschung.
- Definition und Abgrenzung von Emotionen und Stimmung
- Grundlagen des Textverstehens und der Lesekompetenz
- Der Begriff des involvierten Lesens und seine Einbettung in den Lesekompetenzdiskurs
- Der Stimmungskongruenzeffekt und seine Auswirkungen auf das Textverständnis
- Zusammenhang zwischen emotionaler Involviertheit und kognitivem Textverstehen
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik des involvierten Lesens ein und veranschaulicht die Bedeutung emotionaler Beteiligung am Textverständnis anhand eines Kafka-Zitats. Sie hebt die Notwendigkeit der Berücksichtigung emotionaler Faktoren in der Leseforschung hervor und skizziert den Aufbau der Arbeit, der von begrifflichen Definitionen über die Grundlagen des Textverstehens bis hin zur Analyse des Stimmungskongruenzeffekts reicht.
Emotionen und Kognition: Einführung in den Problembereich: Dieses Kapitel befasst sich mit der Definition und Abgrenzung von Emotionen und Stimmung. Es beleuchtet die Komplexität des Begriffs „Emotion“ und greift auf die Definition von Kleinginna und Kleinginna (1981) zurück, die Emotionen als komplexe Interaktion zwischen subjektiven und objektiven Faktoren beschreibt, vermittelt durch neuronale und hormonelle Systeme. Weiterhin werden die Grundemotionen des Menschen nach Ekman (1980) und Izard (1999) vorgestellt und deren Bedeutung für die Verarbeitung von Informationen und die Entscheidungsfindung diskutiert.
Lesen als kognitiver Konstruktionsprozess: Dieses Kapitel legt die Grundlagen für das Verständnis von Textverstehensprozessen und definiert den Begriff der Lesekompetenz anhand des Ebenmodells von Rosebrock und Nix (2008). Es wird dargelegt, wie kognitive Prozesse beim Lesen ablaufen und welche Faktoren das Textverständnis beeinflussen. Der Fokus liegt auf der kognitiven Seite des Lesens als Grundlage für das spätere Verständnis der emotionalen Komponente.
Emotionale Involviertheit im Leseprozess: Dieses Kapitel erörtert den Begriff des involvierten Lesens nach Artelt (2007) als Teil der Lesekompetenz. Es wird der Zusammenhang zwischen Leseinteresse, Lesemotivation und involviertem Lesen beleuchtet und der Stimmungskongruenzeffekt als Messinstrument für die kognitive Verarbeitung emotionaler Zustände im Leseprozess eingeführt. Der Schwerpunkt liegt auf der Verknüpfung von emotionalen und kognitiven Aspekten des Lesens und deren Wechselwirkung.
Schlüsselwörter
Involviertes Lesen, Lesekompetenz, Emotion, Stimmung, Kognition, Textverstehen, Sprachrezeption, Stimmungskongruenzeffekt, Lesemotivation, Leseinteresse.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu: Einfluss emotionaler Involviertheit auf das kognitive Textverstehen
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Hausarbeit untersucht den Einfluss emotionaler Involviertheit auf das kognitive Textverstehen während des Leseprozesses. Es wird analysiert, wie sich Stimmungseinflüsse auf die Sprachrezeption und das Textverständnis auswirken. Die Arbeit verbindet begriffliche Definitionen von Emotion und Kognition mit Grundlagen der Textverstehensprozesse und der Lesekompetenzforschung.
Welche Themen werden behandelt?
Die Arbeit behandelt folgende Themen: Definition und Abgrenzung von Emotionen und Stimmung; Grundlagen des Textverstehens und der Lesekompetenz; Der Begriff des involvierten Lesens und seine Einbettung in den Lesekompetenzdiskurs; Der Stimmungskongruenzeffekt und seine Auswirkungen auf das Textverständnis; Zusammenhang zwischen emotionaler Involviertheit und kognitivem Textverstehen.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit gliedert sich in eine Einleitung, Kapitel zu Emotionen und Kognition, Lesen als kognitiven Konstruktionsprozess und emotionale Involviertheit im Leseprozess, sowie eine Zusammenfassung und ein Literaturverzeichnis. Die Einleitung führt in die Thematik ein und skizziert den Aufbau. Die Kapitel befassen sich mit der Definition der zentralen Begriffe, Grundlagen des Textverstehens und der Analyse des Stimmungskongruenzeffekts.
Was wird unter "involviertem Lesen" verstanden?
Involviertes Lesen wird als Teil der Lesekompetenz nach Artelt (2007) verstanden. Es beschreibt den Zusammenhang zwischen Leseinteresse, Lesemotivation und der emotionalen Beteiligung am Leseprozess. Die Arbeit beleuchtet den Einfluss der emotionalen Involviertheit auf die kognitive Verarbeitung des Textes.
Welche Rolle spielt der Stimmungskongruenzeffekt?
Der Stimmungskongruenzeffekt wird als Messinstrument für die kognitive Verarbeitung emotionaler Zustände im Leseprozess eingeführt. Er zeigt die Wechselwirkung zwischen der emotionalen Verfassung des Lesers und seinem Verständnis des gelesenen Textes auf.
Welche Konzepte der Lesekompetenz werden verwendet?
Die Arbeit bezieht sich auf das Ebenmodell der Lesekompetenz nach Rosebrock und Nix (2008), um das Textverstehen im kognitiven Kontext zu erklären. Involviertes Lesen wird als Erweiterung dieses Modells betrachtet.
Welche Theorien zu Emotionen werden herangezogen?
Die Arbeit verwendet Definitionen von Emotionen von Kleinginna und Kleinginna (1981) sowie die Beschreibung der Grundemotionen nach Ekman (1980) und Izard (1999), um die Komplexität emotionaler Einflüsse auf den Leseprozess zu beleuchten.
Welche Schlüsselwörter charakterisieren die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Involviertes Lesen, Lesekompetenz, Emotion, Stimmung, Kognition, Textverstehen, Sprachrezeption, Stimmungskongruenzeffekt, Lesemotivation, Leseinteresse.
- Quote paper
- Lorenz Knothe (Author), 2021, Involviertes Lesen. Emotionale Involviertheit beim Textverstehen im Leseprozess, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/1271586