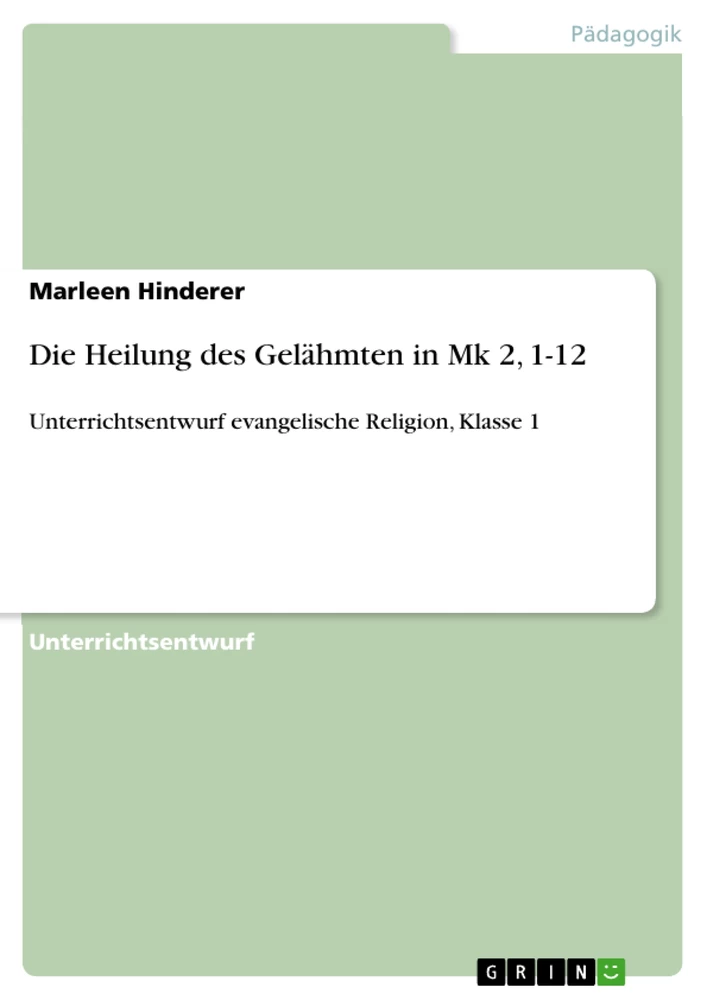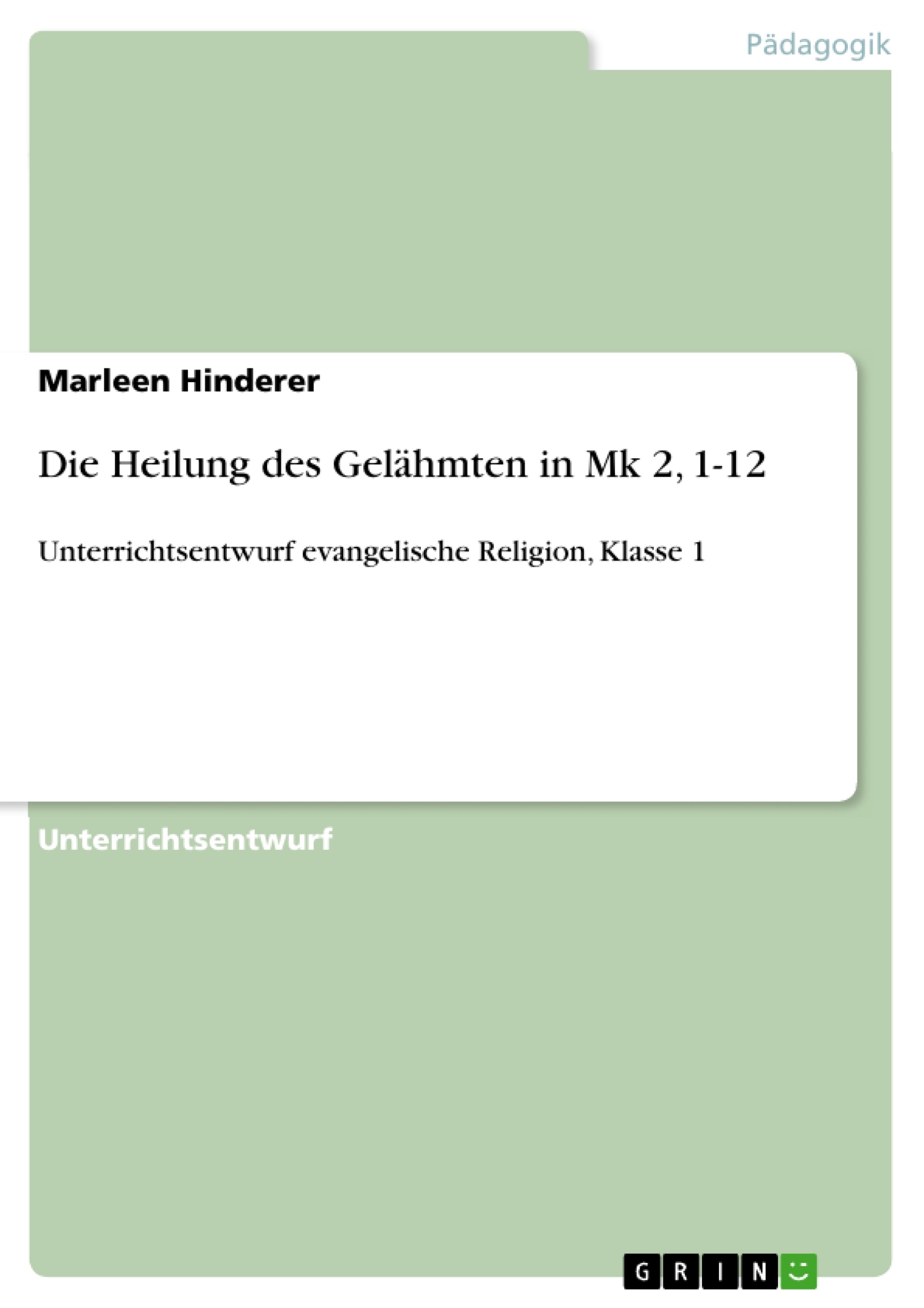Der vorliegende Unterrichtsentwurf behandelt das Thema "Die Heilung des Gelähmten" in einer ersten Klasse. Er beinhaltet eine Bedingungsanalyse, eine Sachanalyse (Exegese), eine didaktische Analyse, eine methodisch-mediale Analyse, eine Verlaufsplanung und die dazugehörigen Materialien.
Inhaltsverzeichnis
- Bedingungsanalyse
- Schule und Raumsituation
- Klasse und Lernstandbeschreibung
- Sachanalyse
- Didaktische Analyse
- Bezug zum Bildungsplan
- Lebensweltbezug der Kinder
- Didaktische Reduktion
- Einbettung in die Unterrichtseinheit
- Methodisch-mediale Analyse
- Begrüßung und Anfangsritual
- Einstieg
- Erarbeitung
- Vertiefung I
- Vertiefung II
- Puffer
- Abschluss
- Ausblick
- Angestrebte Kompetenzen und Ziele
- Verlaufsplan
- Literatur
- Anhang
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Der vorliegende Unterrichtsentwurf für die evangelische Religionsstunde in der Klasse 1 beschäftigt sich mit der Heilung des Gelähmten im Markus-Evangelium (Mk 2, 1-12). Ziel ist es, den Schülerinnen und Schülern die Geschichte näherzubringen und sie so in die Welt der Bibel einzuführen.
- Wundergeschichten in der Bibel
- Heilungsgeschichten als Hoffnungsstiftende Erzählungen
- Die Bedeutung des Markusevangeliums für das Christentum
- Die Bedeutung von Wunder im Kontext des Gottesreiches
- Verschiedene Verstehenstypen von Wundern
Zusammenfassung der Kapitel
- Bedingungsanalyse: Das Kapitel beschreibt die Schule und den Klassenraum, in dem der Unterricht stattfinden soll. Zudem wird die Lerngruppe und der Lernstand der Schülerinnen und Schüler beschrieben.
- Sachanalyse: Dieses Kapitel beschäftigt sich mit dem Thema Wundergeschichten im Allgemeinen, insbesondere mit Heilungsgeschichten und der Bedeutung von Wundern in der Bibel. Der Fokus liegt auf der Heilung des Gelähmten im Markusevangelium.
- Didaktische Analyse: Hier wird der Bezug zum Bildungsplan erläutert, der Lebensweltbezug der Kinder betrachtet und die didaktische Reduktion des Themas dargestellt. Es wird außerdem die Einbettung in die Unterrichtseinheit beschrieben.
- Methodisch-mediale Analyse: Dieser Abschnitt behandelt die einzelnen Phasen der Unterrichtsstunde, angefangen von der Begrüßung bis zum Ausblick.
Schlüsselwörter
Die zentralen Themen des Unterrichtsentwurfs sind Wundergeschichten, Heilungsgeschichten, das Markusevangelium, das Gottesreich, die Bedeutung von Wundern im christlichen Kontext und verschiedene Verstehenstypen von Wundern. Diese Schlüsselwörter ermöglichen einen tieferen Einblick in die Welt der Bibel und die religiöse Bedeutung von Wunder.
- Arbeit zitieren
- Marleen Hinderer (Autor:in), 2022, Die Heilung des Gelähmten in Mk 2, 1-12, München, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/1271346