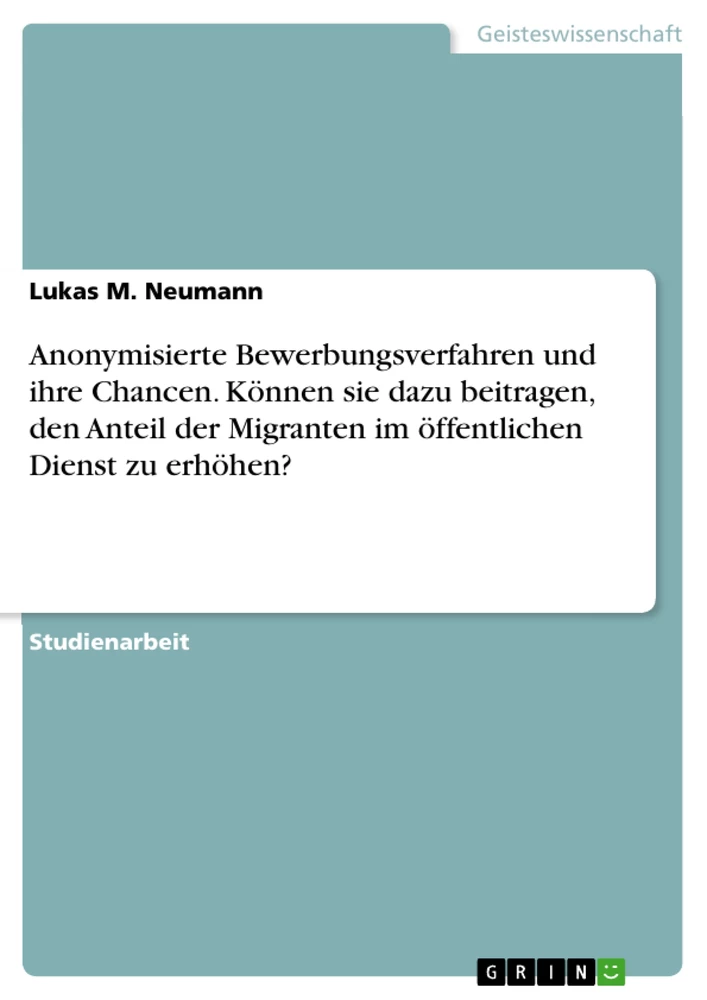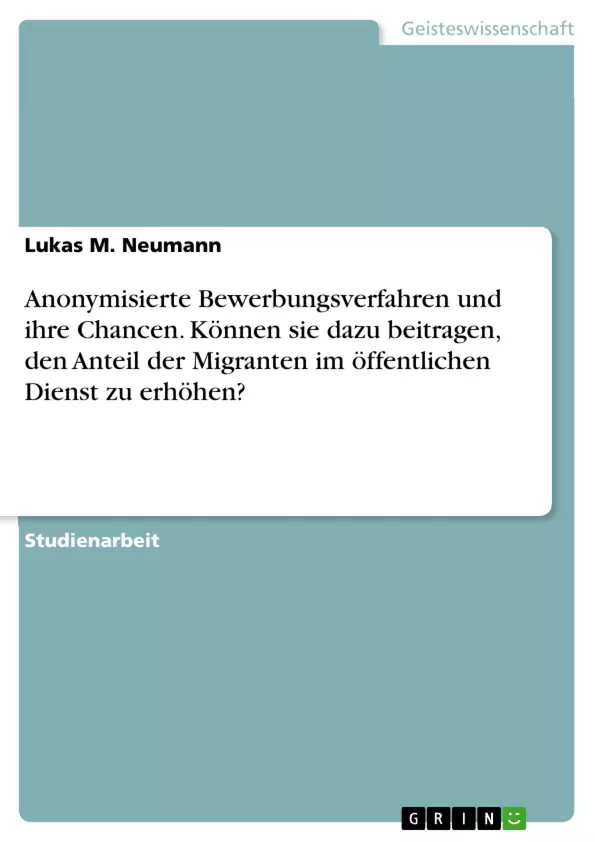Die Hausarbeit aus dem Jahr 2015 versucht die Frage zu beantworten, ob anonymisierte Bewerbungsverfahren dazu beitragen können, den Anteil der Migranten im öffentlichen Dienst zu erhöhen. Dazu soll näher darauf eingegangen werden, wie Stereotype, Vorurteile, Rassismus und soziale Diskriminierung entstehen und inwieweit anonyme Bewerbungen als Intervention dienen und damit einen Beitrag zur Chancengleichheit leisten können. Um diese Frage zu klären, wird mithilfe von Studien zu Pilotprojekten mit anonymisierten Bewerbungsverfahren die Umsetzung dieser Verfahren näher erläutert und auf die empirischen Ergebnisse und Erfahrungen der Teilnehmer der Studien eingegangen.
Wie kann man besser einen Teil zur Gesellschaft beitragen, eine neue Sprache erlernen, neue Bekanntschaften knüpfen und Ressentiments entgegenwirken als durch gemeinsame Arbeit mit jenen, die seit ihrer Geburt in Deutschland leben? Doch was geschieht, wenn das Arbeiten nicht möglich ist? Was geschieht, wenn aufgrund von bestehenden Stereotypen und Vorurteilen innerhalb der Gesellschaft das Einstellungsverfahren zur unüberwindlichen Hürde wird? Natürlich ist das nicht der Regelfall, aber Studien belegen, dass schon ein ausländisch klingender Name die Chancen beim Einstellungsverfahren erheblich vermindern kann.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Stereotype
- Soziale Kategorisierung und Stereotypisierung
- Funktion von Kategorien
- Informationsverarbeitung von Stereotypen
- Automatische und kontrollierte Informationsverarbeitung
- Verhaltensbeeinflussung durch automatische Aktivierung von Stereotypen
- Vorurteile und Rassismus
- Was ist ein Vorurteil?
- Definition und Formen von Rassismus
- Funktionen von Rassismus
- Soziale Diskriminierung
- Anonymisierte Bewerbungsverfahren
- Ausgangslage und Zielsetzung
- Konzeption
- Umfang und Durchführung der Anonymisierung
- Beantwortung der Problemfrage
- Zusammenfassung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit untersucht die potenziellen Auswirkungen anonymisierter Bewerbungsverfahren auf den Anteil von Migranten im öffentlichen Dienst. Sie analysiert, wie Stereotype, Vorurteile und Rassismus die Integration von Migranten beeinflussen können, insbesondere im Kontext von Einstellungsprozessen. Die Arbeit betrachtet anonyme Bewerbungsverfahren als mögliche Intervention, die zur Chancengleichheit beitragen könnte.
- Die Entstehung und Funktion von Stereotypen und Vorurteilen
- Der Einfluss von Rassismus auf die Integration von Migranten
- Die Funktionsweise anonymisierter Bewerbungsverfahren und ihre Auswirkungen
- Die Relevanz von Chancengleichheit und die Rolle anonymer Bewerbungen in diesem Zusammenhang
- Die Analyse von Studien und Pilotprojekten, die sich mit anonymisierten Bewerbungsverfahren befassen
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt das Thema der anonymisierten Bewerbungsverfahren und die Problemfrage vor, ob diese den Anteil von Migranten im öffentlichen Dienst erhöhen können. Kapitel 2 behandelt die Entstehung von Stereotypen und Vorurteilen, erklärt ihre Funktion und untersucht die automatische und kontrollierte Verarbeitung von Stereotypen im Kontext von Verhalten. Kapitel 3 widmet sich dem Phänomen des Rassismus und seinen Funktionen. Kapitel 4 beleuchtet die Thematik der sozialen Diskriminierung.
Kapitel 5 beschäftigt sich mit anonymisierten Bewerbungsverfahren und untersucht deren Ausgangslage, Zielsetzung, Konzeption und Umfang sowie die Durchführung der Anonymisierung. Es geht auch auf die Beantwortung der Problemfrage ein, indem es auf empirische Ergebnisse und Erfahrungen aus Studien zu Pilotprojekten eingeht.
Schlüsselwörter
Die Hausarbeit befasst sich mit den Schlüsselbegriffen Stereotype, Vorurteile, Rassismus, soziale Diskriminierung und anonymisierte Bewerbungsverfahren. Sie analysiert die Auswirkungen dieser Konzepte auf den Anteil von Migranten im öffentlichen Dienst und untersucht die Potenziale von anonymen Bewerbungen als Intervention zur Förderung der Chancengleichheit.
Häufig gestellte Fragen
Was ist ein anonymisiertes Bewerbungsverfahren?
Bei diesem Verfahren werden persönliche Daten wie Name, Herkunft, Alter oder Foto aus den Bewerbungsunterlagen entfernt, sodass die Auswahl rein auf Basis der Qualifikation erfolgt.
Können anonyme Bewerbungen den Anteil von Migranten im öffentlichen Dienst erhöhen?
Studien belegen, dass schon ein ausländisch klingender Name die Chancen auf ein Vorstellungsgespräch senken kann. Anonymisierung dient hier als Intervention, um unbewusste Vorurteile auszuschalten.
Wie entstehen Stereotype und Vorurteile?
Stereotype entstehen durch soziale Kategorisierung. Sie dienen der schnellen Informationsverarbeitung, führen aber oft zur automatischen Aktivierung von Vorurteilen und Diskriminierung.
Was ist der Unterschied zwischen automatischer und kontrollierter Informationsverarbeitung?
Automatische Verarbeitung geschieht unbewusst und schnell durch Stereotype, während kontrollierte Verarbeitung bewusste Anstrengung erfordert, um Vorurteile zu hinterfragen.
Welche Rolle spielt Rassismus bei der Jobsuche?
Rassismus und soziale Diskriminierung können dazu führen, dass qualifizierte Migranten trotz passender Profile bereits in der ersten Auswahlphase aufgrund ihrer ethnischen Identität ausscheiden.
Gibt es praktische Erfahrungen mit anonymisierten Verfahren?
Ja, die Hausarbeit analysiert Pilotprojekte und Studien, die zeigen, dass anonymisierte Verfahren die Einladungschancen für benachteiligte Gruppen tatsächlich verbessern können.
- Quote paper
- Lukas M. Neumann (Author), 2015, Anonymisierte Bewerbungsverfahren und ihre Chancen. Können sie dazu beitragen, den Anteil der Migranten im öffentlichen Dienst zu erhöhen?, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/1271020