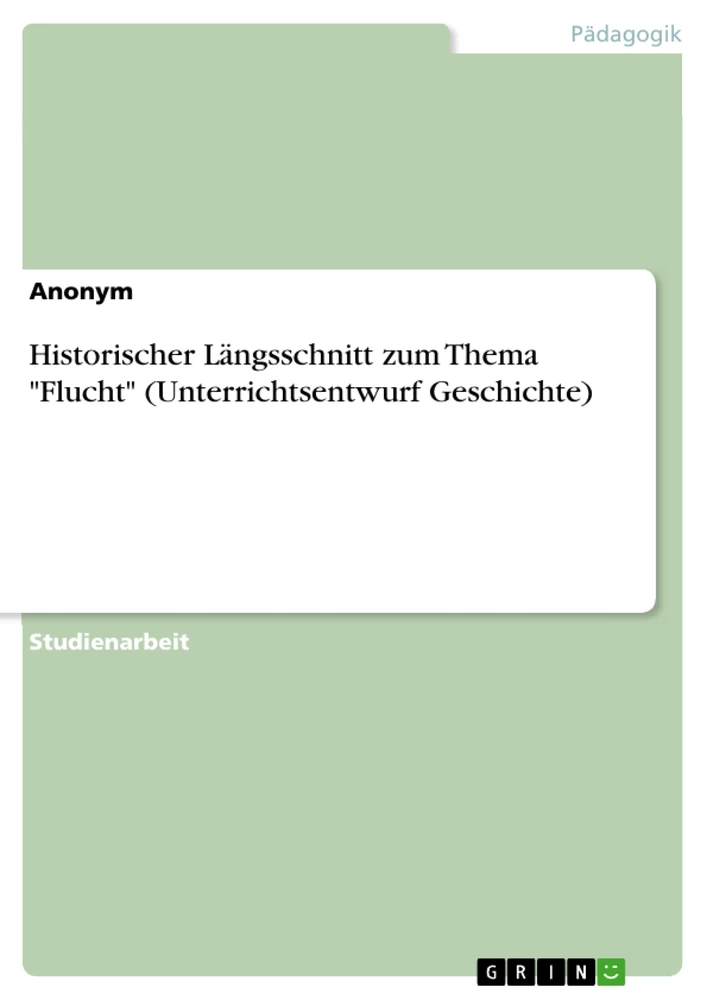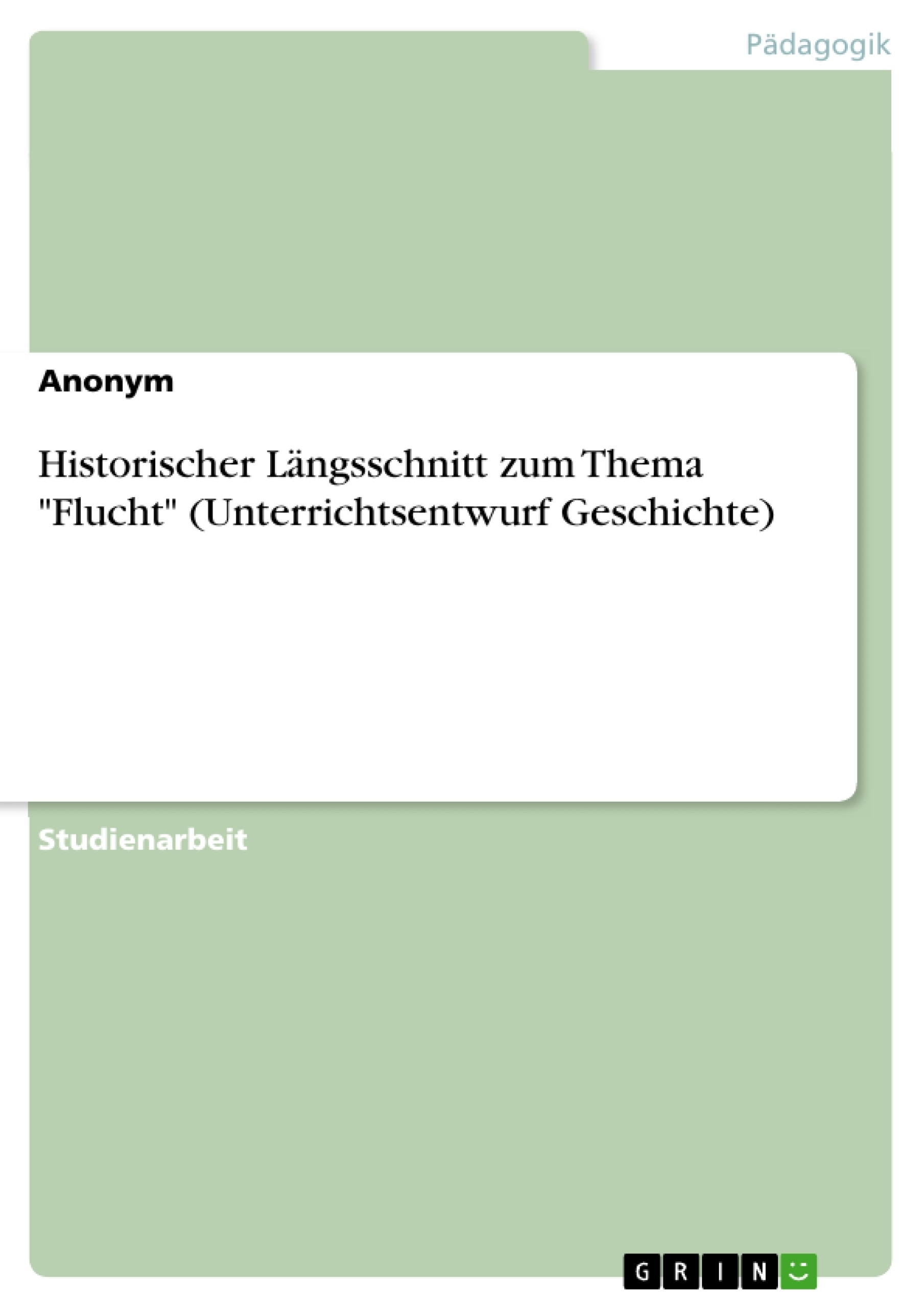In der Geschichtswissenschaft definiert man den Längsschnitt als ein darstellerisches Konzept. In der Regel wird der Längsschnitt epochenübergreifend angewendet, damit das zeitliche Nacheinander betont wird und man die historische Zeit beschleunigt betrachten kann. Mit einem Längsschnitt ist es also möglich, einen erhellenden Blick auf historische Zustände zu bestimmten Zeitpunkten zu erlangen. Der Schwerpunkt der Hausarbeit liegt in der Konzeption solch eines Längsschnitts. Als Grundlage dient das Thema "Flucht".
Es werden vergangene Ereignisse auf andere vergangene Ereignisse bezogen. Damit die Arbeitsmethode gewinnbringend angewendet werden kann, sollte das Arbeiten aus einer bestimmten Gegenwartserfahrung heraus geschehen. Der Ausgangspunkt dafür sind Dimensionen, wie beispielsweise Alltagskulturen, Eigenes und Fremdes, Raumnutzung, Reisen oder Herrschaft, die bis heute immer noch Aktualität vorweisen und als historische Themen behandelt werden können.
Die Stärken und der didaktische Wert von Längsschnitten liegen unter anderem darin, dass die Tiefendimension der Geschichte schon in frühen Jahrgangsstufen erfahren und erlebbar gemacht werden kann. Epochen werden überbrückt und historische Erfahrungen mit der Gegenwart verknüpft. Vor allem werden durch die Gegenwartsbezüge Problemsituationen erkennbar gemacht, aber auch Problemlösungen offengelegt.
Neben diesen Vorteilen bringt diese Methode im Geschichtsunterricht aber auch Nachteile mit sich: Einzelne historische Probleme wirken losgelöst und isoliert aus dem Strukturzusammenhang ihrer Epoche. Somit kann die Komplexität der Geschichte missverstanden werden und es kann schnell zu gedankenlosen Aufreihungen von Fakten und Ereignissen seitens der Lernenden kommen. Dadurch, dass gewisse Merkmale einer Epoche nicht behandelt werden, sondern geschichtliche Zusammenhänge isoliert voneinander betrachtet werden, kann es passieren, dass zu abstrakt unterrichtet wird und wenige bis keine Kenntnisse des chronologischen Zusammenhangs weitergegeben werden.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Das Thema Flucht und seine Bedeutung
- Vorstellung des Lernarrangements
- Flucht heute: Fluchtbewegungen in der Gegenwart
- Flucht in der frühen Neuzeit: Die Hugenotten
- Flucht und Vertreibung durch den zweiten Weltkrieg
- Flucht durch die Jugoslawienkriege der 1990er Jahre
- Erwartungshorizont der Arbeitsaufträge
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Hausarbeit zielt darauf ab, ein Lernarrangement für einen thematischen Längsschnitt zum Thema „Flucht“ im Geschichtsunterricht zu konzipieren. Der Längsschnitt soll den Lernenden einen Einblick in die historische Dimension von Fluchtbewegungen in verschiedenen Epochen vermitteln und die Relevanz des Themas für die heutige Gesellschaft aufzeigen.
- Die Bedeutung des Themas „Flucht“ in der Geschichte und Gegenwart
- Die unterschiedlichen Formen und Ursachen von Flucht
- Die Auswirkungen von Flucht auf die Betroffenen und die Gesellschaft
- Die Bedeutung von Flucht für das interkulturelle Geschichtsbewusstsein
- Die Möglichkeiten und Herausforderungen, das Thema „Flucht“ im Geschichtsunterricht zu behandeln
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung befasst sich mit der Bedeutung von Darstellungskonzepten im Geschichtsunterricht und erläutert die Besonderheiten des Längsschnitts als thematisches Strukturierungskonzept. Das zweite Kapitel beleuchtet die Relevanz des Themas „Flucht“ für den historischen Lernprozess der Schüler und zeigt die Bedeutung von Fluchtbewegungen in der Geschichte auf. Der dritte Teil präsentiert das entwickelte Lernarrangement, das verschiedene Epochen und Fluchtkontexte beleuchtet, von Fluchtbewegungen in der Gegenwart bis hin zur Flucht der Hugenotten in der frühen Neuzeit.
Schlüsselwörter
Flucht, Migration, Geschichtsunterricht, Längsschnitt, Lernarrangement, historische Dimension, Fluchtbewegungen, interkulturelles Geschichtsbewusstsein, Gegenwart, Vergangenheit, Epochen, Hugenotten, Jugoslawienkriege, Vertreibung.
- Quote paper
- Anonym (Author), 2018, Historischer Längsschnitt zum Thema "Flucht" (Unterrichtsentwurf Geschichte), Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/1270492