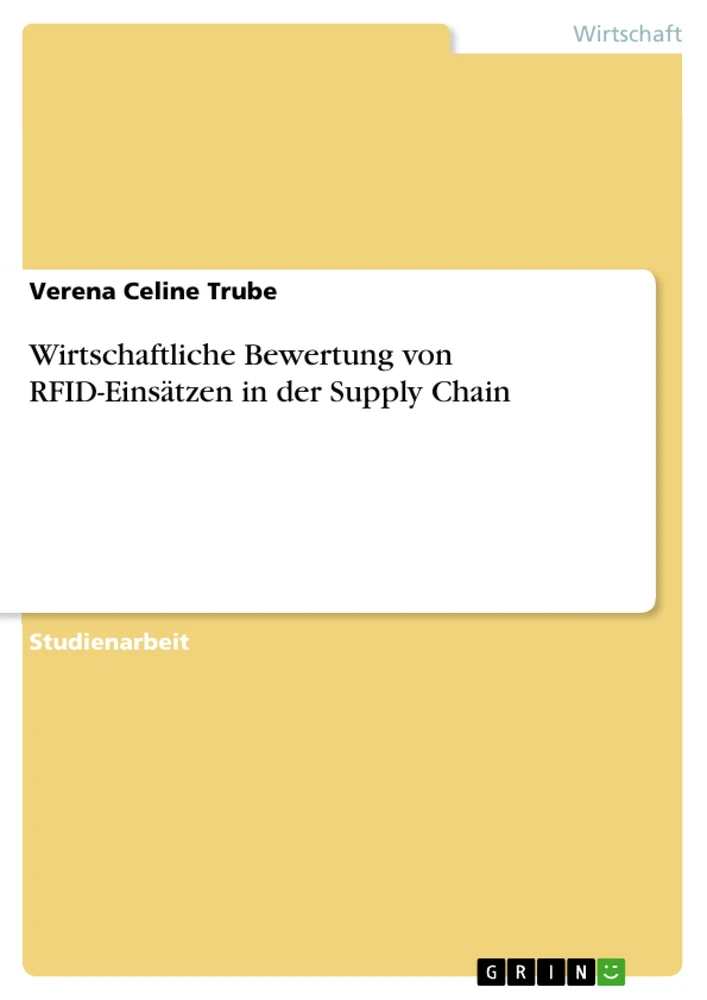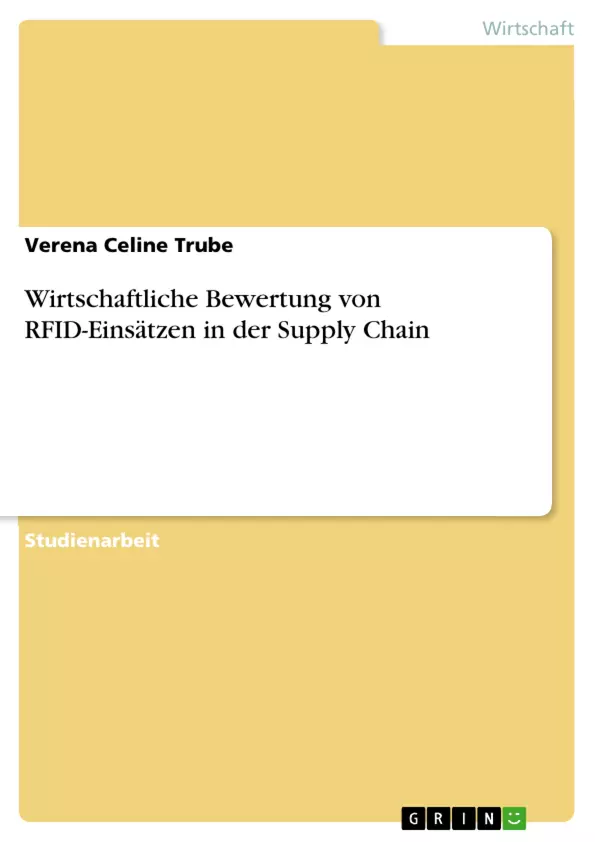Die Ausarbeitung wird sich zuerst mit RFID-Systemen in Hinblick auf den geschichtlichen sowie technischen Hintergrund auseinandersetzen. Darüber hinaus werden die Einsatzmöglichkeiten entlang der Wertschöpfungskette beleuchtet. Folgend wird sich genauer mit der Problemstellung der Wirtschaftlichkeit auseinandergesetzt. Dadurch ist es im nächsten Schritt der Ausarbeitung möglich, eine mögliche Vorgehensweise beziehungsweise die Phasen der Einführung auszuarbeiten und zusätzlich die Chancen und Risiken der RFID-Technologie darzustellen. Ein Ausblick in die Zukunft folgt, bevor ein Fazit die Arbeit abrundet.
Durch die zunehmende Globalisierung, den Wandel von Kundenanforderungen und Märkten, einem höheren Umweltbewusstsein und insbesondere durch den technischen Fortschritt sowie der Digitalisierung haben sich die Kernfunktionen der Logistik verändert. Die vermehrte Auslagerung von Wertschöpfungsprozessen an externe Partner führt zu weltweit vernetzten Lieferketten, was mit einem unübersichtlichen Geflecht an Beschaffungs-, Lager-, Liefer- und Produktionsabläufen einhergeht. Heute stellt dessen Koordination eine zentrale Rolle für Unternehmen dar. Die transparente Lieferkette gehört in erster Linie durch die Globalisierung zu den komplexesten Themen, die Unternehmen bewegen. Mittels der globalen Wertschöpfungskette ist zu erkennen, dass viele Stakeholder beteiligt sind, die physisch und digital für einen funktionierenden Betriebsablauf sorgen müssen. Komplex ist dies aus dem Grund, da es viele Schnittstellen zu überbrücken gibt und Systeme oft nicht zusammenpassen und kooperieren, aber auch die Beteiligten nicht immer alle Informationen miteinander austauschen.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung und Motivation
- Heranführung an RFID
- Geschichtlicher Hintergrund
- Technischer Hintergrund
- Einsatzmöglichkeiten in der Supply Chain
- Wirtschaftlichkeit
- Elemente Wirtschaftlichkeitsanalyse
- Monetäre Elemente
- Nicht-monetäre Elemente
- Phasen bei der Einführung von RFID-Technologien
- Elemente Wirtschaftlichkeitsanalyse
- Chancen und Risiken der RFID-Technologie
- Chancen
- Risiken
- Zukunft von RFID
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit befasst sich mit der wirtschaftlichen Bewertung von RFID-Einsätzen in der Supply Chain. Sie untersucht den Einsatz der RFID-Technologie im Kontext der Globalisierung, der veränderten Kundenanforderungen und des technischen Fortschritts. Ziel ist es, die Wirtschaftlichkeit von RFID-Implementierungen zu beleuchten und Entscheidungsgrundlagen für Unternehmen zu schaffen.
- Der geschichtliche und technische Hintergrund der RFID-Technologie
- Die Einsatzmöglichkeiten von RFID in der Supply Chain
- Die relevanten Elemente der Wirtschaftlichkeitsanalyse bei RFID-Implementierungen
- Die Phasen der Einführung von RFID-Technologien
- Die Chancen und Risiken der RFID-Technologie
Zusammenfassung der Kapitel
- Kapitel 1: Die Einleitung stellt die Motivation für die Arbeit dar und beleuchtet die Relevanz von RFID-Technologien im Kontext der heutigen Supply Chain.
- Kapitel 2: Dieses Kapitel bietet eine Heranführung an RFID, indem es den geschichtlichen und technischen Hintergrund der Technologie erläutert.
- Kapitel 3: Dieses Kapitel befasst sich mit den Einsatzmöglichkeiten von RFID in der Supply Chain und geht detailliert auf die Wirtschaftlichkeit von RFID-Implementierungen ein.
- Kapitel 4: Hier werden die Chancen und Risiken der RFID-Technologie untersucht.
Schlüsselwörter
RFID, Supply Chain, Wirtschaftlichkeit, Globalisierung, Digitalisierung, Kosten, Chancen, Risiken, Implementierung, Prozesse, Innovation.
Häufig gestellte Fragen
Wie wird die Wirtschaftlichkeit von RFID in der Supply Chain bewertet?
Die Bewertung erfolgt durch eine Analyse monetärer Elemente (Kostenersparnis, Investitionen) und nicht-monetärer Elemente (Prozessqualität, Transparenz, Zeitersparnis).
Welche Vorteile bietet RFID für die globale Lieferkette?
RFID ermöglicht eine transparente Lieferkette ("Track and Trace"), verbessert die Koordination zwischen Stakeholdern und hilft, Schnittstellenprobleme in komplexen Logistiknetzwerken zu überwinden.
Was sind die größten Risiken bei der Einführung von RFID-Systemen?
Zu den Risiken zählen hohe Initialkosten, technische Herausforderungen bei der Systemintegration, Datenschutzbedenken und mangelnde Standardisierung zwischen verschiedenen Partnern.
In welchen Phasen erfolgt die Einführung der RFID-Technologie?
Der Prozess unterteilt sich typischerweise in Planung, Konzeption, Pilotierung und den anschließenden Roll-out im gesamten Unternehmen.
Welchen Einfluss hat die Digitalisierung auf die Logistik-Kernfunktionen?
Durch den technischen Fortschritt wandeln sich Lager-, Liefer- und Produktionsabläufe hin zu vernetzten, selbststeuernden Systemen, in denen RFID als Schlüsseltechnologie fungiert.
- Arbeit zitieren
- Verena Celine Trube (Autor:in), 2022, Wirtschaftliche Bewertung von RFID-Einsätzen in der Supply Chain, München, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/1270421