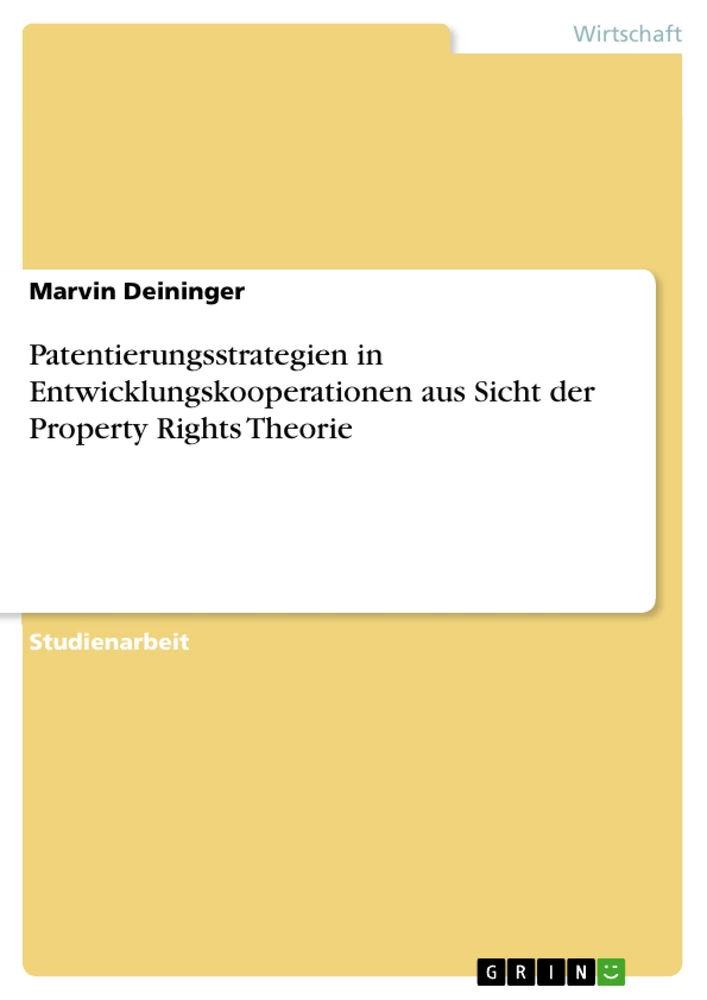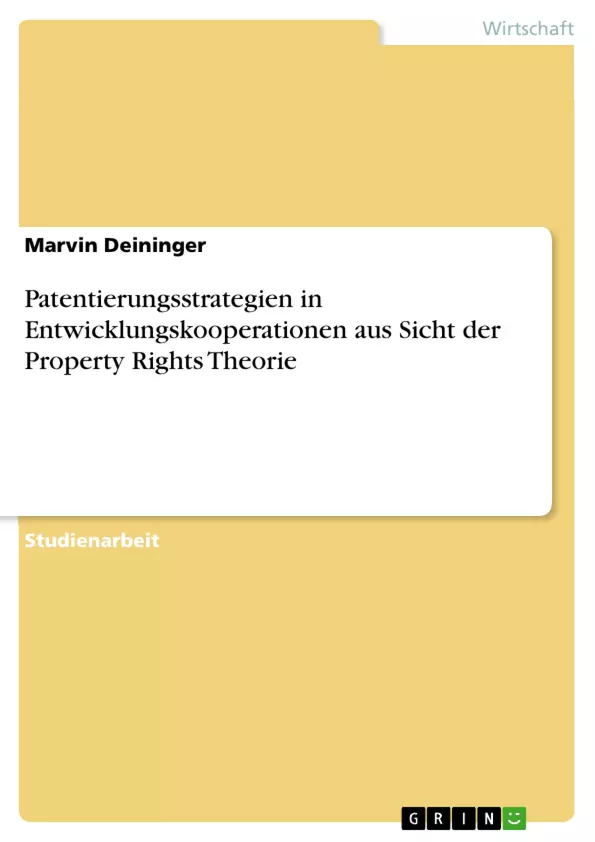Diese Seminararbeit befasst sich mit der folgenden Forschungsfrage: "Welchen Erklärungsbeitrag nimmt die Property Rights Theory bei Patentierungsstrategien in Entwicklungskooperationen ein?" Damit soll festgestellt werden, ob ausgeprägte Property Rights (PRs) das Innovationspotential eines Unternehmens fördern oder ob sie dieses verhindern. Ein besonderes Augenmerk kommt dabei dem Intellectual Property (IP) eines Unternehmens zu. Dabei handelt es sich um explizites Wissen, das in Form von
geistigen Eigentumsrechten (Patent), Rechtsgeschäften (Leasingrecht, Mietrecht, Nutzungsrecht), oder vertraglichen Geheimhaltungsvereinbarungen (Rezeptur, technische Formel) vorliegt.
Für die Beantwortung der Forschungsfrage unterteilt sich diese Arbeit in vier übergeordnete Kapitel. Neben der bereits aufgeführten Problemstellung werden im zweiten Kapitel die für die Beantwortung der Forschungsfrage notwendigen
Begriffe definiert. Anschließend werden diese Begriffe verwendet um die Forschungsfrage zu beantworten. Im letzten Kapitel wird in einer thesenförmigen Zusammenfassung ein abschließendes Fazit auf die gewonnenen Erkenntnisse gewährt.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Ausgangssituation und Problemstellung
- Forschungsfrage
- Aufbau der Arbeit
- Grundlagen
- Definitionen
- Patent und Patentierungsstrategie
- Entwicklungskooperationen
- Bewegungsgründe für eine F&E Kooperation
- Property Rights Theory
- Untersuchung
- Kritische Würdigung der Untersuchung
- Schluss
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit befasst sich mit der Bedeutung von Patentierungsstrategien in Entwicklungskooperationen aus der Perspektive der Property Rights Theory. Sie analysiert die Herausforderungen des Innovationsmanagements im 21. Jahrhundert und beleuchtet, wie Entwicklungskooperationen Unternehmen dabei helfen können, ihre Wettbewerbsfähigkeit zu sichern.
- Patentierungsstrategien in Entwicklungskooperationen
- Property Rights Theory
- Herausforderungen des Innovationsmanagements im 21. Jahrhundert
- Wettbewerbsfähigkeit von Unternehmen
- Qualitative Faktoren in Forschungs- und Entwicklungskooperationen
Zusammenfassung der Kapitel
- Einleitung: Diese Einleitung stellt die Ausgangssituation und die Problemstellung der Arbeit dar. Sie führt die Forschungsfrage ein und gibt einen Überblick über den Aufbau der Arbeit.
- Grundlagen: Dieses Kapitel definiert die zentralen Begriffe der Arbeit, wie Patent, Patentierungsstrategie, Entwicklungskooperationen und die Property Rights Theory. Es beleuchtet auch die Gründe für die Entstehung von F&E-Kooperationen.
- Untersuchung: Dieses Kapitel analysiert die Untersuchungsergebnisse und würdigt diese kritisch.
Schlüsselwörter
Die Arbeit konzentriert sich auf die Themen Patentierungsstrategien, Entwicklungskooperationen, Property Rights Theory, Innovationsmanagement, Wettbewerbsfähigkeit und Forschungs- und Entwicklungskooperationen.
- Arbeit zitieren
- Marvin Deininger (Autor:in), 2022, Patentierungsstrategien in Entwicklungskooperationen aus Sicht der Property Rights Theorie, München, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/1268952