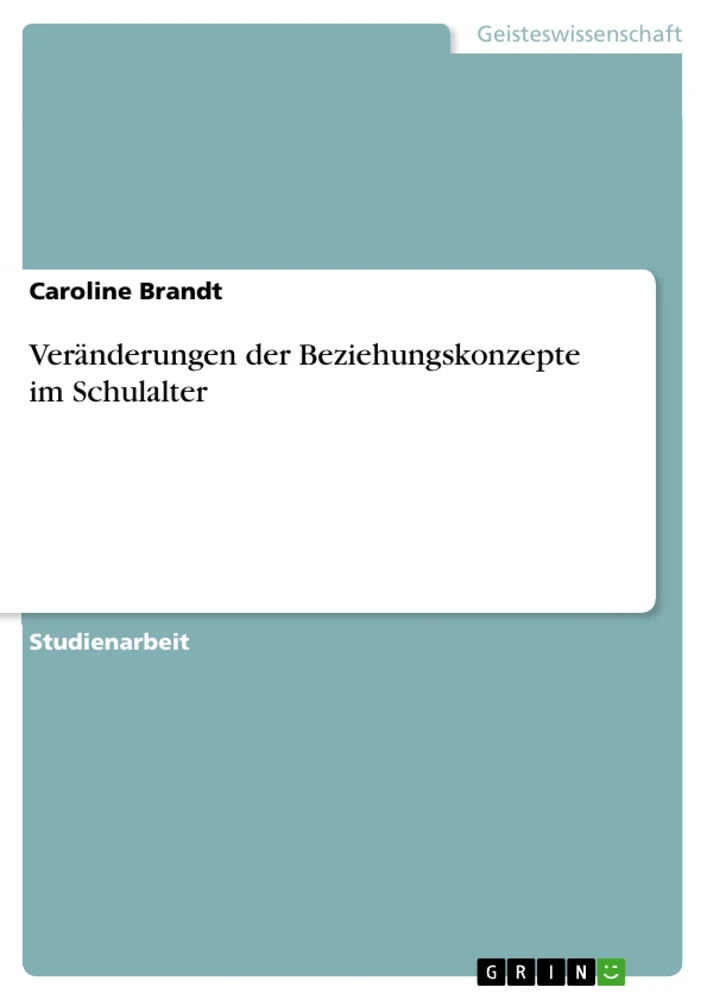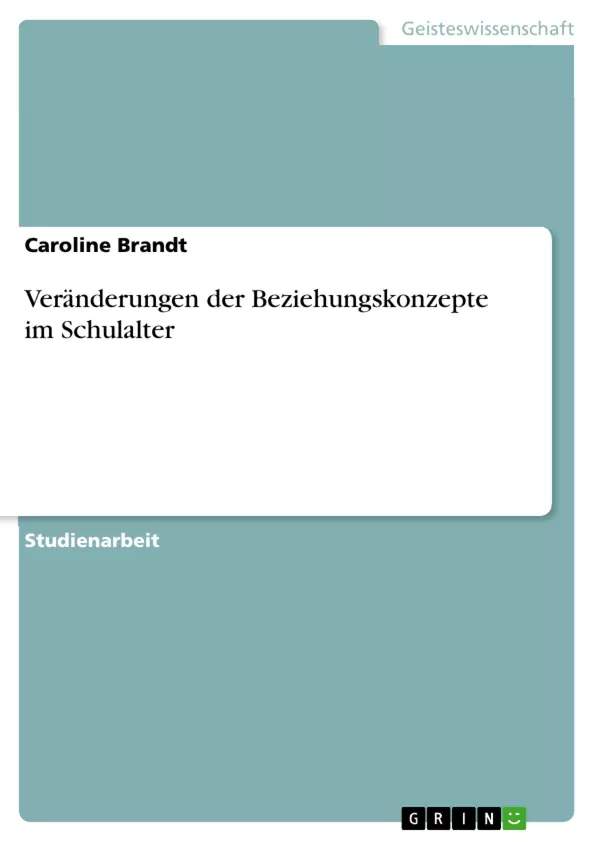Familie, Freundschaft, Liebe, Peer Groups - die Beziehungskonzepte von Jugendlichen im Schulalter sind facettenreich und vielschichtig. Neben der Bedeutung aus psychologischer Sicht bietet diese Arbeit auch Bezugspunkte für das Unterrichtsfach LER (Lebensgestaltung-Ethik-Religionskunde).
Beziehungskonzepte unterliegen der psychischen Entwicklung, welche das ganze Leben andauert. Dabei sollte nicht das Alter selbst als Ursache bestimmter Entwicklungsrichtungen angesehen werden, sondern nur als zeitliche Dimension, in
welcher Veränderungen stattfinden. In dieser Arbeit wird ebendiese zeitliche Dimension das Schulalter sein, welches sich von ca. 6 Jahren bis ca. 19 Jahren erstreckt. Mit dieser Zeitspanne gehen viele biologische und soziale Veränderungen
einher, welche permanent zusammen wirken und gegenseitig Einfluss aufeinander nehmen. Kinder werden immer selbstständiger, wenn sie zu Jugendlichen werden. Dabei findet nicht nur eine Reorganisation der Persönlichkeit, sondern auch der Bindungen statt.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung - Was sind Beziehungskonzepte? Was zeichnet Beziehungen aus?
- Formen der Beziehungskonzepte
- Eltern und Familie
- Freundschaften und Peer-Groups
- Liebe
- Weitere Beziehungen
- Bedeutung von Beziehungen aus psychologischer Sicht.
- Bezugspunkte für LER
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit beleuchtet die Bedeutung von Beziehungskonzepten im Schulalter und analysiert deren Entwicklung und Auswirkungen auf die psychische Entwicklung des Individuums.
- Die Entwicklung von Beziehungskonzepten im Schulalter
- Die Rolle der Familie und der Eltern-Kind-Beziehung
- Die Bedeutung von Freundschaften und Peer-Groups
- Die Auswirkungen verschiedener Bindungsmuster auf die Entwicklung von Kindern und Jugendlichen
- Die Bedeutung von Beziehungskonzepten für die Lernerfahrungen (LER)
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung - Was sind Beziehungskonzepte? Was zeichnet Beziehungen aus?
Die Einleitung stellt die Bedeutung von Beziehungskonzepten im Schulalter dar und beleuchtet deren Entwicklung im Laufe der Zeit. Sie fokussiert auf die Veränderungen, die Kinder und Jugendliche in dieser Lebensphase durchlaufen und wie diese sich auf ihre Beziehungen auswirken.
Formen der Beziehungskonzepte
Eltern und Familie
Dieser Abschnitt untersucht die langfristige Bedeutung der Eltern-Kind-Beziehung und deren Einfluss auf die Entwicklung des Kindes. Es werden die Auswirkungen verschiedener Bindungsmuster auf das Sozialverhalten und die Persönlichkeitsentwicklung analysiert.
Freundschaften und Peer-Groups
Dieser Teil behandelt die Rolle von Freundschaften und Peer-Groups in der Entwicklung von Kindern und Jugendlichen. Es werden die verschiedenen Funktionen von Peer-Gruppen, ihre Bedeutung für die soziale Integration und die Auswirkungen auf die Entwicklung von sozialer Kompetenz beleuchtet.
Bedeutung von Beziehungen aus psychologischer Sicht.
Dieser Abschnitt untersucht die psychologische Bedeutung von Beziehungen und deren Einfluss auf die Entwicklung von Kindern und Jugendlichen. Es werden verschiedene psychologische Theorien und Modelle zur Erklärung von Beziehungskonzepten und ihrer Auswirkungen vorgestellt.
Bezugspunkte für LER
Dieser Teil betrachtet die Bedeutung von Beziehungskonzepten für den Lernprozess. Es wird untersucht, wie die Qualität von Beziehungen sich auf die Lernerfahrungen von Kindern und Jugendlichen auswirkt und welche pädagogischen Konsequenzen sich daraus ergeben.
Schlüsselwörter
Die Arbeit beschäftigt sich mit den Themen Beziehungskonzepte, Entwicklung im Schulalter, Eltern-Kind-Beziehung, Freundschaften, Peer-Groups, Bindungsmuster, soziale Kompetenz, psychologische Entwicklung, Lernerfahrungen (LER).
- Quote paper
- Caroline Brandt (Author), 2020, Veränderungen der Beziehungskonzepte im Schulalter, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/1268943