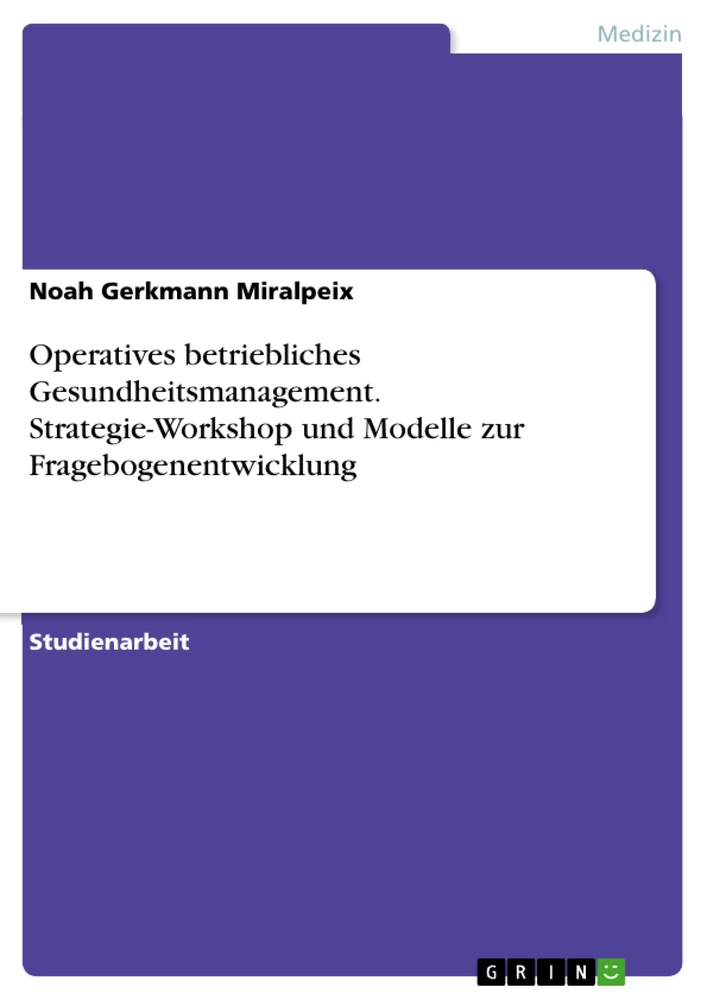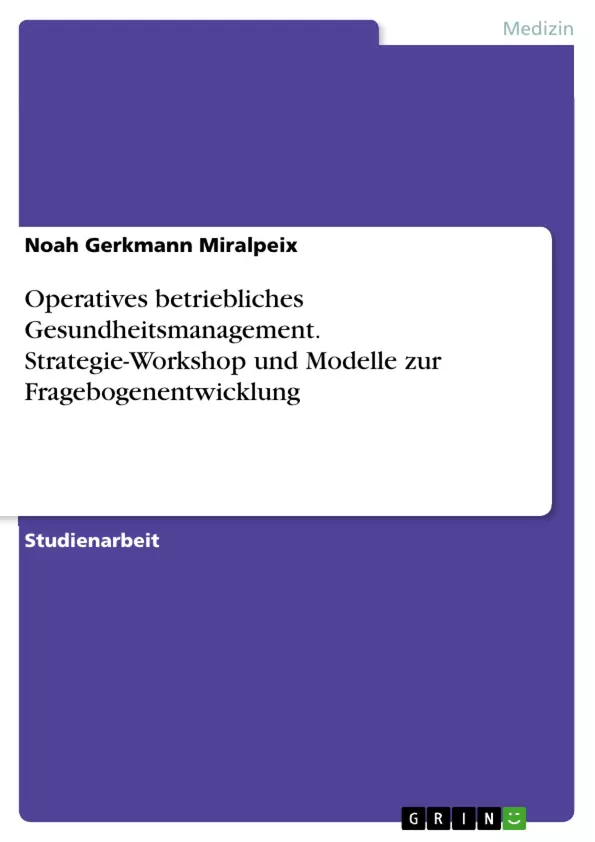Oberste Ziele im betrieblichen Gesundheitsmanagement (BGM) sind die Reduzierung von Arbeitsbelastungen, die Stärkung des Humankapitals, die Verbesserung des Wohlbefindens und die Wettbewerbsfähigkeit. Daraus resultierend ist BGM sowohl eine Gewinnsituation für Arbeitgeber und Arbeitnehmer.
Damit die Maßnahmen im Sinne des BGM erfolgreich umgesetzt und vom Management gesteuert werden können, braucht es klare Ziele. Die Ziele betreffen meistens rechtliche, wirtschaftliche, demografische und soziale Handlungsansätze. Ziele dieser Bereiche können anhand der SMART-Formel konkretisiert werden.
Inhaltsverzeichnis
- ZIELE UND NUTZEN EINES BGM...
- Ziele.............
- Nutzen.
- BELASTUNGEN IN DER ARBEITSWELT.
- Belastungen..............
- Belastung und Beanspruchung.......
- STRATEGIE-WORKSHOP............
- Organisation.........
- Vorbereitung....
- MODELLE ZUR FRAGEBOGENENTWICKLUNG………………………………….
- LITERATURVERZEICHNIS……………………………....
- ABBILDUNGS- UND TABELLENVERZEICHNIS..\li>
- Abbildungsverzeichnis.....
- Tabellenverzeichnis...
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit befasst sich mit dem betrieblichen Gesundheitsmanagement (BGM). Der Fokus liegt dabei auf der Analyse von Belastungen und Beanspruchungen in der Arbeitswelt, insbesondere in Bezug auf physische und psychische Faktoren. Das Ziel der Arbeit ist es, die Bedeutung des BGMs für Unternehmen und Mitarbeiter zu beleuchten, indem es die Vorteile und Nutzen aufzeigt, die durch die Implementierung eines erfolgreichen BGM-Programms entstehen.
- Analyse von Belastungen und Beanspruchungen in der Arbeitswelt
- Das Belastungs-Beanspruchungs-Konzept nach Rohmert und Rutenfranz
- Die Bedeutung von BGM für Unternehmen und Mitarbeiter
- Beispiele für konkrete BGM-Maßnahmen
- Die Rolle von Führungskräften im BGM
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel beschäftigt sich mit den Zielen und dem Nutzen eines BGM. Hierbei werden die wichtigsten Vorteile für Unternehmen und Mitarbeiter herausgestellt. Das zweite Kapitel befasst sich mit Belastungen in der Arbeitswelt. Dabei werden die verschiedenen Arten von Belastungen, insbesondere physische und psychische, genauer betrachtet. Das dritte Kapitel behandelt das Thema des Belastungs-Beanspruchungs-Konzepts nach Rohmert und Rutenfranz. Hier wird der Unterschied zwischen Belastungen und Beanspruchungen erklärt und die Bedeutung des Konzepts für die Analyse von Arbeitsbedingungen dargestellt.
Schlüsselwörter
Betriebliches Gesundheitsmanagement, Belastung, Beanspruchung, Arbeitsschutz, Stress, Motivation, Arbeitsbedingungen, Führungskräfte, Unternehmenskultur, Mitarbeiterzufriedenheit, Wohlbefinden.
- Quote paper
- Noah Gerkmann Miralpeix (Author), 2021, Operatives betriebliches Gesundheitsmanagement. Strategie-Workshop und Modelle zur Fragebogenentwicklung, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/1268826