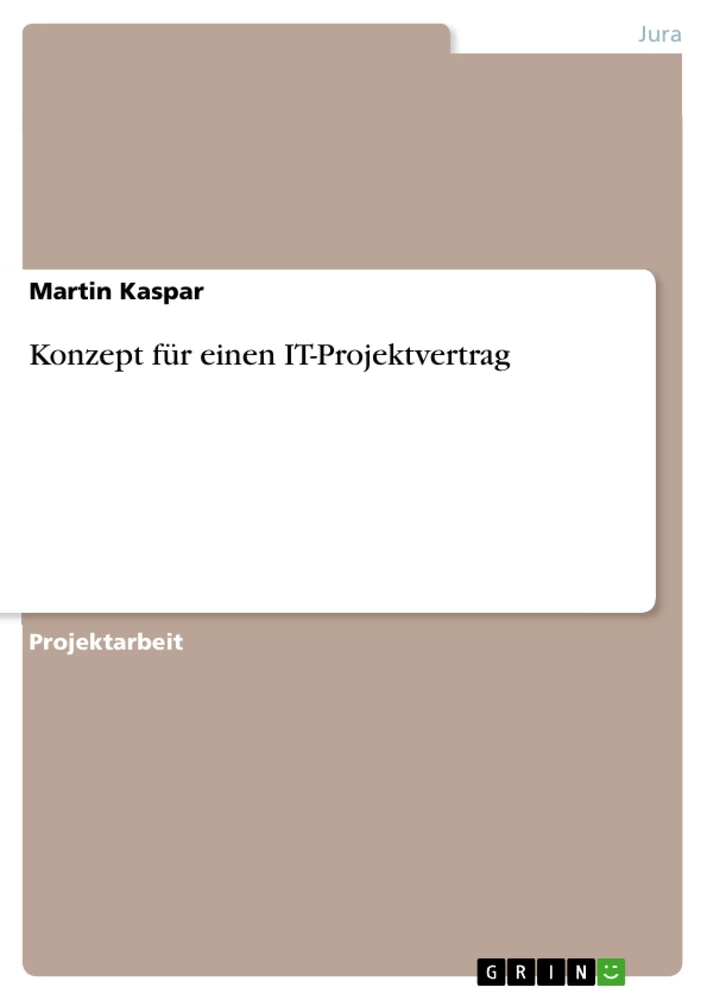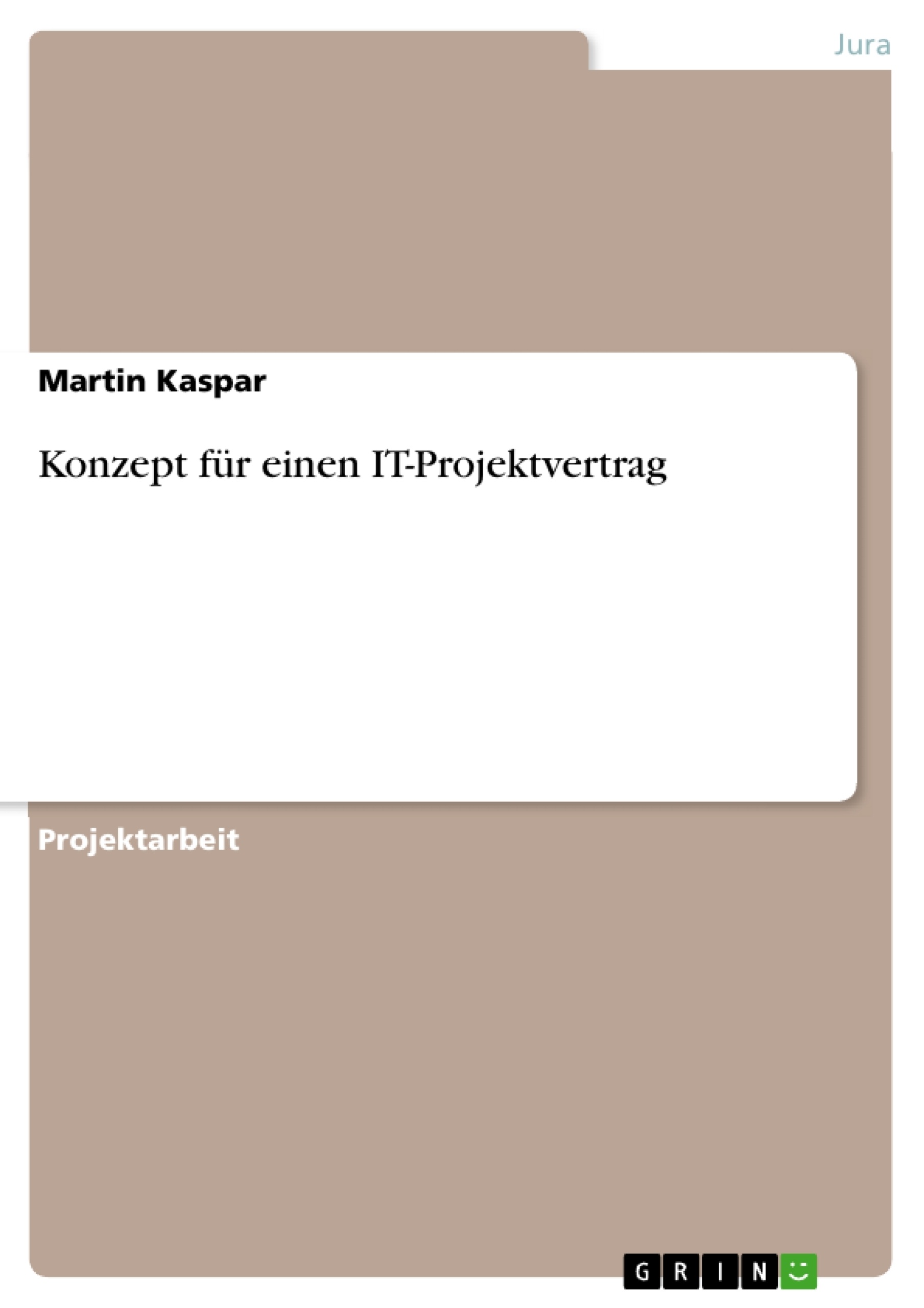Als private Krankenversicherung hat es sich die Cure AG zur Aufgabe gemacht, der Digitalisierung von Prozessen und der Kundenkommunikation zu folgen. Hierzu soll ein Projekt zur Erstellung einer App für mobile Endgeräte erfolgen, welche die Ziele (i) Organisieren und Versenden von Rechnungen und Belegen digital; (ii) Vereinbaren von Wunschterminen bei verfügbaren Ärzten online mit Erinnerungsfunktion; (iii) Anlegen einer ganz persönlichen digitalen Gesundheitsakte; (iv) jederzeitiges Einsehen von Daten, die durch behandelnden Ärzten hochgeladen wurden; (v) Bereitstellen von aktuellen Gesundheitstipps und -themen; (vi) Abruf von Ärzten und Kliniken mit Kontaktdaten und Öffnungszeiten aufweisen soll.
Da diese App durch einen externen Anbieter erstellt werden soll, soll ein Vertragskonzept mit möglichen zukünftigen Regelungszwecken erstellt werden. Dabei wurde zunächst ermittelt, welche Regelungszwecke in einem IT-Projekt notwendig und allen voran auch sinnvoll sind. Nicht nur rechtliche, sondern auch betriebswirtschaftliche Regelungszwecke wurden dabei berücksichtigt. In erster Linie wurde ein Konzept zur eigene Rechteabsicherung geschaffen, damit diese ausreichend geschützt werden können und der Sinn und Zweck der App vollumfänglich verfolgt werden kann.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einführung in das Thema
- 2. Vertragsbestandteile
- 2.1 Identität der Vertragsparteien
- 2.2 Präambel
- 2.3 Schriftform
- 2.4 Vertragsart
- 2.5 Allgemeine Geschäftsbedingungen
- 2.6 Auftrag/Leistung
- 2.7 Regelungen zur Vergütung
- 2.8 Preisdeckelungsklausel
- 2.9 Entwicklung und Dokumentationsrichtlinie
- 2.10 Terminplan
- 2.11 Bestimmung von Mitwirkungspflichten
- 2.12 Nutzungsrecht
- 2.13 Gewährleistung
- 2.13.1 Gewährleistungsfrist
- 2.13.2 Gewährleistungseinbehalte
- 2.13.3 Unverzügliche Fehlerbeseitigung
- 2.14 Change Request
- 2.15 Geheimhaltung und Rechte am Know-how
- 2.16 Entscheidungskompetenzen des Projektleiters
- 2.16.1 Projektteilnehmer und Eskalationsstufen
- 2.17 Streitbeilegung
- 2.18 Kündigung
- 2.18.1 Außerordentliche Kündigung
- 2.19 Vertragsstrafe
- 2.20 Datenschutz
- 2.21 Haftung
- 2.22 Höhere Gewalt
- 2.23 Subunternehmer
- 2.24 Abtretungsverbote
- 2.25 Schlussbestimmungen
- 2.25.1 Schriftform
- 2.25.2 Gerichtstand
- 2.25.3 Rechtswahl
- 2.25.4 Salvatorische Klausel
- 2.25.5 Unterschriften
- 3. Zusammenfassung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Zielsetzung dieser Arbeit ist die Entwicklung eines Vertragskonzepts für ein IT-Projekt zur Erstellung einer Gesundheits-App für die Cure AG. Das Konzept soll die rechtlichen und betriebswirtschaftlichen Interessen der Cure AG absichern. Es werden relevante Vertragsbestandteile identifiziert und deren Bedeutung im Kontext des IT-Projekts erläutert.
- Rechtliche Absicherung der Cure AG
- Definition der Leistungspflichten (Haupt- und Nebenleistungen)
- Regelungen zur Vergütung und Preisgestaltung
- Rechte am Know-how und Geheimhaltung
- Streitbeilegung und Kündigung
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einführung in das Thema: Die Einführung beschreibt den Hintergrund des Projekts: Die Cure AG beabsichtigt die Entwicklung einer Gesundheits-App zur Digitalisierung von Prozessen und der Kundenkommunikation. Der Fokus liegt auf der Erstellung eines Vertragskonzepts für die Beauftragung eines externen Anbieters. Es wird die Notwendigkeit der Berücksichtigung sowohl rechtlicher als auch betriebswirtschaftlicher Aspekte betont, mit dem primären Ziel der umfassenden Absicherung der Interessen der Cure AG.
2. Vertragsbestandteile: Dieses Kapitel befasst sich detailliert mit den einzelnen Bestandteilen eines IT-Projektvertrages. Es werden die relevanten Klauseln, von der Identifizierung der Vertragsparteien über die Regelungen zur Vergütung, Gewährleistung, Geheimhaltung, Streitbeilegung bis hin zu Kündigungsregelungen und Schlussbestimmungen, umfassend behandelt. Jedes Element wird im Hinblick auf seine Bedeutung für die Absicherung der Interessen der Cure AG analysiert und begründet. Der Schwerpunkt liegt auf der Schaffung eines umfassenden und rechtssicheren Vertragswerks für das IT-Projekt.
Schlüsselwörter
IT-Projektvertrag, Vertragsgestaltung, Gesundheits-App, Rechtliche Absicherung, Vergütungsregelung, Gewährleistung, Geheimhaltung, Know-how, Streitbeilegung, Kündigung.
Häufig gestellte Fragen zum IT-Projektvertrag für die Cure AG
Was ist der Gegenstand dieses Dokuments?
Dieses Dokument ist eine umfassende Vorschau auf einen IT-Projektvertrag für die Entwicklung einer Gesundheits-App für die Cure AG. Es beinhaltet ein Inhaltsverzeichnis, die Zielsetzung und Themenschwerpunkte, Kapitelzusammenfassungen und Schlüsselwörter. Der Fokus liegt auf der rechtlichen und betriebswirtschaftlichen Absicherung der Interessen der Cure AG.
Welche Themen werden im Vertrag behandelt?
Der Vertrag behandelt alle relevanten Aspekte eines IT-Projekts, inklusive der Identität der Vertragsparteien, der Präambel, Schriftform, Vertragsart, Allgemeinen Geschäftsbedingungen, Auftrag/Leistung, Vergütungsregelungen (inkl. Preisdeckelungsklausel), Entwicklung und Dokumentationsrichtlinien, Terminplan, Mitwirkungspflichten, Nutzungsrechten, Gewährleistung (inkl. Gewährleistungsfrist, Gewährleistungseinbehalte und Fehlerbeseitigung), Change Requests, Geheimhaltung und Rechte am Know-how, Entscheidungskompetenzen des Projektleiters (inkl. Eskalationsstufen), Streitbeilegung, Kündigung (inkl. außerordentlicher Kündigung), Vertragsstrafe, Datenschutz, Haftung, höhere Gewalt, Subunternehmer, Abtretungsverbote und Schlussbestimmungen (inkl. Schriftform, Gerichtstand, Rechtswahl, salvatorische Klausel und Unterschriften).
Was ist die Zielsetzung des Vertrags?
Die Zielsetzung ist die Entwicklung eines Vertragskonzepts, das die rechtlichen und betriebswirtschaftlichen Interessen der Cure AG bei der Entwicklung der Gesundheits-App umfassend absichert. Dies beinhaltet die Definition der Leistungspflichten, Regelungen zur Vergütung und Preisgestaltung, den Schutz des Know-hows und die Regelung von Streitbeilegung und Kündigung.
Welche Kapitel umfasst der Vertrag?
Der Vertrag umfasst eine Einführung, ein Kapitel zu den Vertragsbestandteilen (detailliert gegliedert), und eine Zusammenfassung. Die Vertragsbestandteile werden sehr ausführlich behandelt.
Welche Schlüsselwörter beschreiben den Vertrag?
Schlüsselwörter sind: IT-Projektvertrag, Vertragsgestaltung, Gesundheits-App, Rechtliche Absicherung, Vergütungsregelung, Gewährleistung, Geheimhaltung, Know-how, Streitbeilegung, Kündigung.
Für wen ist dieser Vertrag bestimmt?
Dieser Vertrag ist für die Cure AG und den externen Anbieter der Gesundheits-App bestimmt. Er soll die Interessen der Cure AG rechtlich und wirtschaftlich absichern.
Welche Aspekte der rechtlichen Absicherung werden behandelt?
Der Vertrag behandelt umfassend die rechtliche Absicherung der Cure AG, einschließlich Gewährleistung, Geheimhaltung, Streitbeilegung, Kündigung und Haftung.
- Arbeit zitieren
- Martin Kaspar (Autor:in), 2022, Konzept für einen IT-Projektvertrag, München, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/1268628