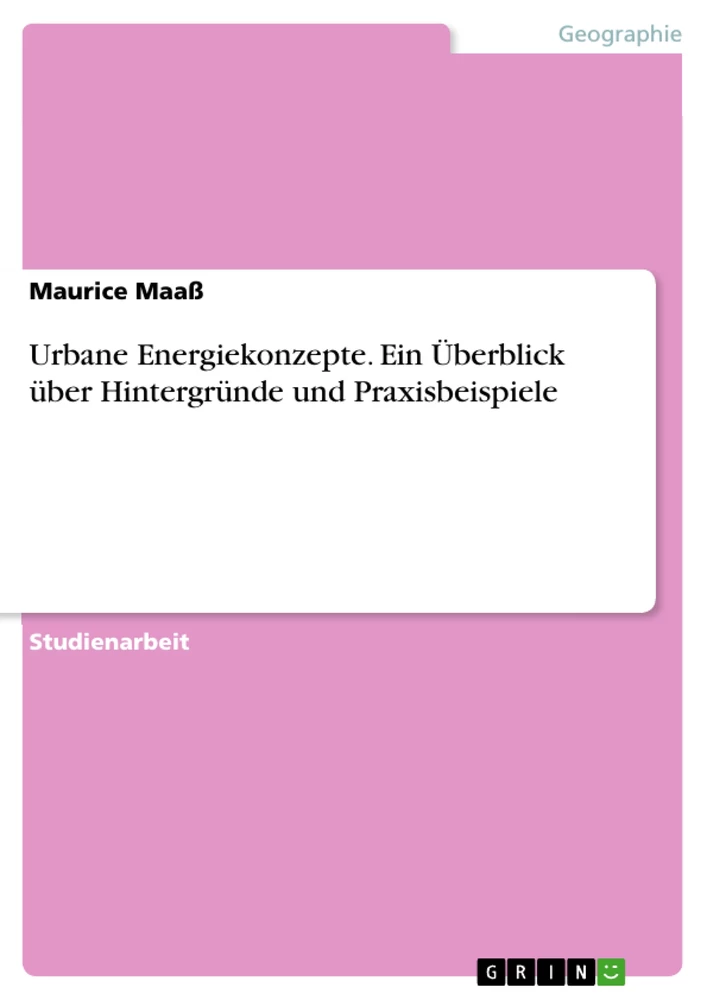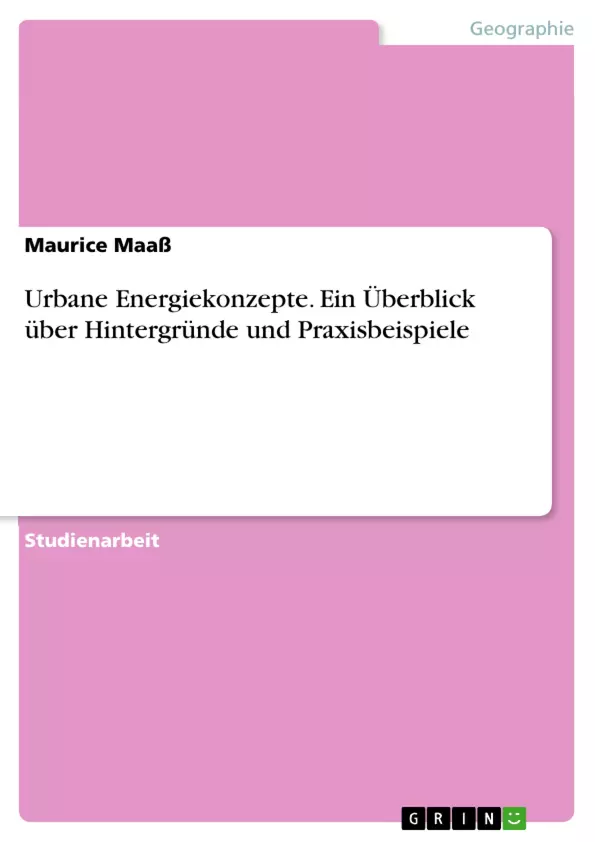Die Arbeit stellt Beispiele für urbane Energiekonzepte vor. Die Energiewende ist ein allgegenwärtiges Thema. Insbesondere durch die immer weiter voranschreitende Globalisierung ist auch dieses sensible Thema in den Entwicklungs- und Schwellenländern nicht mehr weg zu denken. Die negativen Umweltauswirkungen von fossilen Brennstoffen sind kein unbekanntes Problem. Vor allem die Belastung für die Natur durch freiwerdende Schadstoffe und teilweise radioaktiven Stoffen ist verheerend. Durch dieses weit verbreitete Thema ist das Interesse an erneuerbaren Energien in den letzten Jahren stark gestiegen und erfährt einen stetig steigenden Anteil am Weltmarkt.
Doch wie wird noch effizienter gearbeitet? Neuere Überlegungen versuchen, urbane Räume nicht sich nur an erneuerbaren Energien zu bedienen, sondern darüber hinaus auch maximale Effizienz zu erreichen. Wie soll sowas aussehen? Es wird versucht auch interne städtische Strukturen zu optimieren und energieschonend zu bauen, darunter zählen zum einen die Architektur und die Gebäudestrukturen und zum anderen die Verkehrsinfrastruktur, die ohne Emissionen und geringen Energiebedarf auskommt.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Hintergründe für die Entwicklung von Energiekonzepten in urbanen Räumen
- Energiekonzept UrbanReNet am Beispiel Darmstadt
- Aufgabestellung und Projektablauf
- Konzepterstellung auf Grundlage der Datenermittlung
- Vernetzung des Bedarfs und der Potenziale
- Masdar City als futuristische Vorzeigestadt
- Gebäudearchitektur zur Erzielung maximaler Energieeffizienz
- Verkehrsstrukturen einer nachhaltigen Stadt
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Das vorliegende Werk untersucht die Bedeutung von Energiekonzepten in urbanen Räumen im Kontext der Energiewende. Es analysiert Herausforderungen und Chancen der Entwicklung von nachhaltigen Energieversorgungssystemen in Städten und beleuchtet zwei exemplarische Konzepte: UrbanReNet in Darmstadt und Masdar City.
- Die Rolle der Energiewende im städtischen Kontext
- Die Bedeutung von Energieeffizienz und erneuerbaren Energien in urbanen Räumen
- Herausforderungen und Möglichkeiten der Integration von Energiekonzepten in bestehende städtische Strukturen
- Die Bedeutung von vernetzten Energiesystemen und intelligenter Steuerungstechnik
- Die Betrachtung von Beispielprojekten als Best-Practice-Beispiele für nachhaltige urbane Energieversorgung
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel beleuchtet die Bedeutung der Energiewende für urbane Räume und die wachsende Nachfrage nach nachhaltigen Energiekonzepten. Der zweite Teil konzentriert sich auf die Entwicklung von Energiekonzepten in urbanen Räumen, wobei Herausforderungen wie Flächenverfügbarkeit und die Integration von erneuerbaren Energien in bestehende Netze betrachtet werden.
Kapitel drei stellt das Energiekonzept UrbanReNet in Darmstadt vor und beschreibt die Aufgabenstellung, den Projektablauf und die Konzepterstellung auf Grundlage der Datenermittlung. Es erläutert die Vernetzung des Bedarfs und der Potenziale sowie die Einbindung bestehender Infrastruktur und Gebäude.
Kapitel vier beleuchtet Masdar City als ein Beispiel für eine futuristische Stadt, die auf nachhaltige Energieversorgung und Ressourceneffizienz ausgerichtet ist. Es betrachtet die Gebäudearchitektur, Verkehrsstrukturen und andere Innovationen, die zur Erreichung der Nachhaltigkeitsziele beitragen.
Schlüsselwörter
Die zentralen Schlüsselwörter und Themen des vorliegenden Textes umfassen die Energiewende, urbane Energiekonzepte, Energieeffizienz, erneuerbare Energien, nachhaltige Stadtentwicklung, UrbanReNet, Masdar City, und die Integration von Energiesystemen in städtische Infrastrukturen.
- Arbeit zitieren
- Maurice Maaß (Autor:in), 2017, Urbane Energiekonzepte. Ein Überblick über Hintergründe und Praxisbeispiele, München, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/1268621