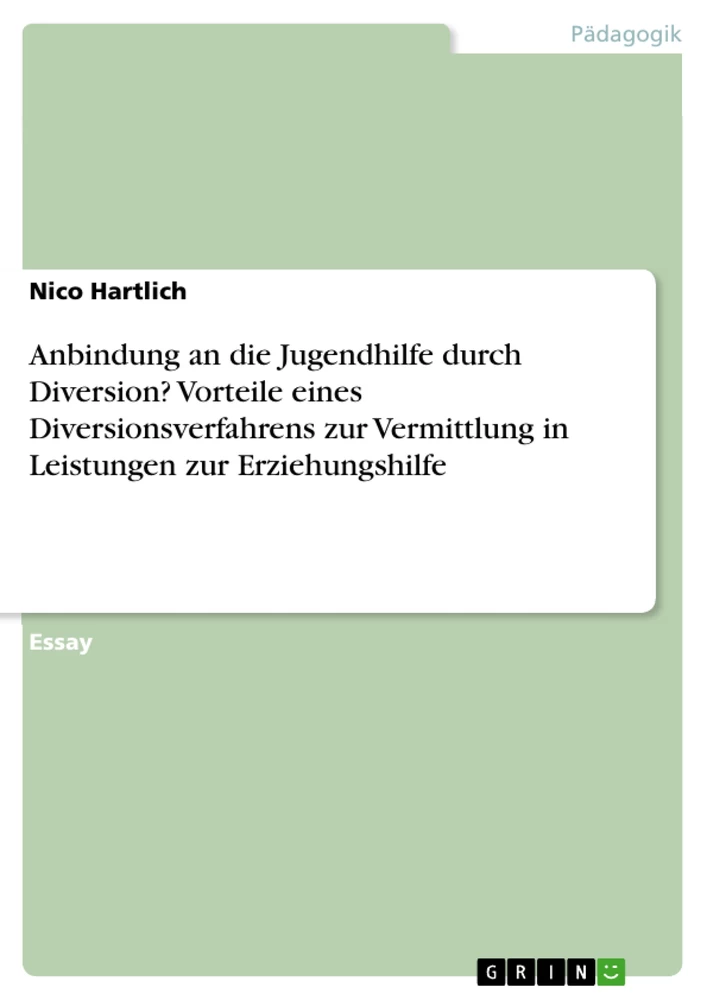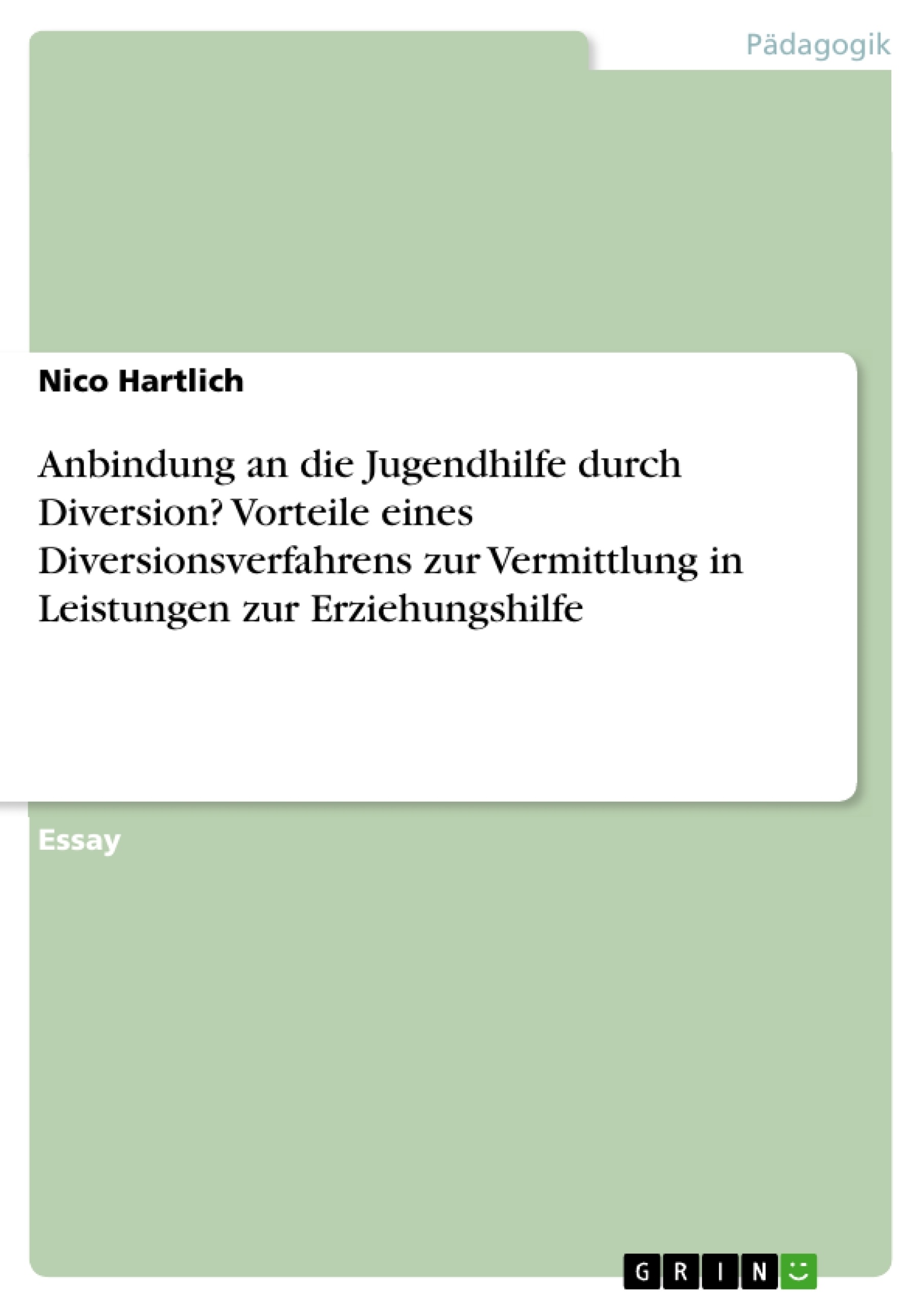Dieser Essay soll sich mit der Frage befassen, inwiefern das Diversionsverfahren die Möglichkeit bietet, straffällige Jugendliche an die Leistungen der Jugendhilfe anzubinden. Deshalb sollen hier konkret die Vorteile einer Diversion herausgearbeitet werden, um anschließend zu argumentieren, inwiefern Unterstützungsmöglichkeiten durch die Jugendhilfe im Strafverfahren initiiert werden können. Knapp umschrieben, handelt es sich bei einer Diversion um eine Ableitung oder Umleitung aus dem Strafverfahren heraus. Die Täter:innen sollen vom System formeller Sozialkontrolle weggeführt werden. Durch die Diversion sollen verschiedene Ziele erreicht werden, die einerseits für den:die Täter:in, die nahen Angehörigen wie die Eltern, aber auch für die Justiz von Vorteil sind. Auch der Jugendhilfe im Strafverfahren (JuHiS) werden durch Diversionsverfahren flexible Handlungsspielräume eingeräumt, die für die Erziehungs- und Entwicklungsförderung nützlich und notwendig sein können.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- 1. Diversion - Was ist das genau?
- 2. Welche Vorteile hat das Diversionsverfahren?
- 3. Die Jugendhilfe im Strafverfahren als Bindeglied zwischen Adressat:innen und anderen Akteur:innen der Kinder- und Jugendhilfe
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Dieser Essay analysiert die Verbindung zwischen Diversion und der Jugendhilfe, indem er die Vorteile eines Diversionsverfahrens für straffällige Jugendliche beleuchtet und argumentiert, wie Unterstützungsmöglichkeiten durch die Jugendhilfe im Strafverfahren aktiviert werden können. Der Fokus liegt dabei auf den Vorzügen der Diversion für die Jugendlichen und der Rolle der Jugendhilfe als Bindeglied zwischen verschiedenen Akteuren im Bereich der Kinder- und Jugendhilfe.
- Vorteile der Diversion für straffällige Jugendliche
- Rolle der Jugendhilfe im Strafverfahren
- Verknüpfung von Diversion und Jugendhilfe
- Ubiquität und Spontanbewährung als Trias der Jugendkriminalität
- „Labeling Approach“ als Erklärungsansatz für Jugendkriminalität
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung
Dieser Essay beschäftigt sich mit der Frage, wie das Diversionsverfahren straffällige Jugendliche an die Leistungen der Jugendhilfe binden kann. Er erläutert die Vorteile der Diversion, untersucht die Rolle der Jugendhilfe im Strafverfahren und zeigt auf, wie die Jugendhilfe als Vermittler zwischen anderen Akteuren in der Kinder- und Jugendhilfe agieren kann.
1. Diversion- Was ist das genau?
Dieses Kapitel definiert den Begriff der Diversion anhand der §§ 45, 47 des Jugendgerichtsgesetzes (JGG). Es unterscheidet zwischen einer Diversion durch die Staatsanwaltschaft und einer Diversion durch den Jugendrichter. Der Text beschreibt die jeweiligen Möglichkeiten, die der Staatsanwaltschaft und dem Jugendrichter zur Verfügung stehen, um die Strafverfolgung zu vermeiden oder abzubrechen.
2. Welche Vorteile hat das Diversionsverfahren?
Dieses Kapitel erläutert die grundsätzlichen Vorteile der Diversion, wie z.B. die Vermeidung von Stigmatisierung, schnellere Reaktionen und flexiblere Problemlösungshilfen. Darüber hinaus wird der „Labeling Approach“ als Erklärungsansatz für Jugendkriminalität vorgestellt. Der Text verweist auf die beiden ersten Trias der Jugendkriminalität: die Ubiquität und die Spontanbewährung. Es werden die empirischen Erkenntnisse zu diesen beiden Konzepten vorgestellt, die die Notwendigkeit der Diversion im Hinblick auf die Spontanbewährung belegen.
Schlüsselwörter
Diversion, Jugendhilfe, Jugendgerichtsgesetz (JGG), Strafverfolgung, Staatsanwaltschaft, Jugendrichter, Vorteile, Stigmatisierung, „Labeling Approach“, Ubiquität, Spontanbewährung, Jugendkriminalität, Erklärungsansatz, Normalsozialisation, erzieherische Maßnahmen.
- Arbeit zitieren
- Nico Hartlich (Autor:in), 2022, Anbindung an die Jugendhilfe durch Diversion? Vorteile eines Diversionsverfahrens zur Vermittlung in Leistungen zur Erziehungshilfe, München, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/1267762