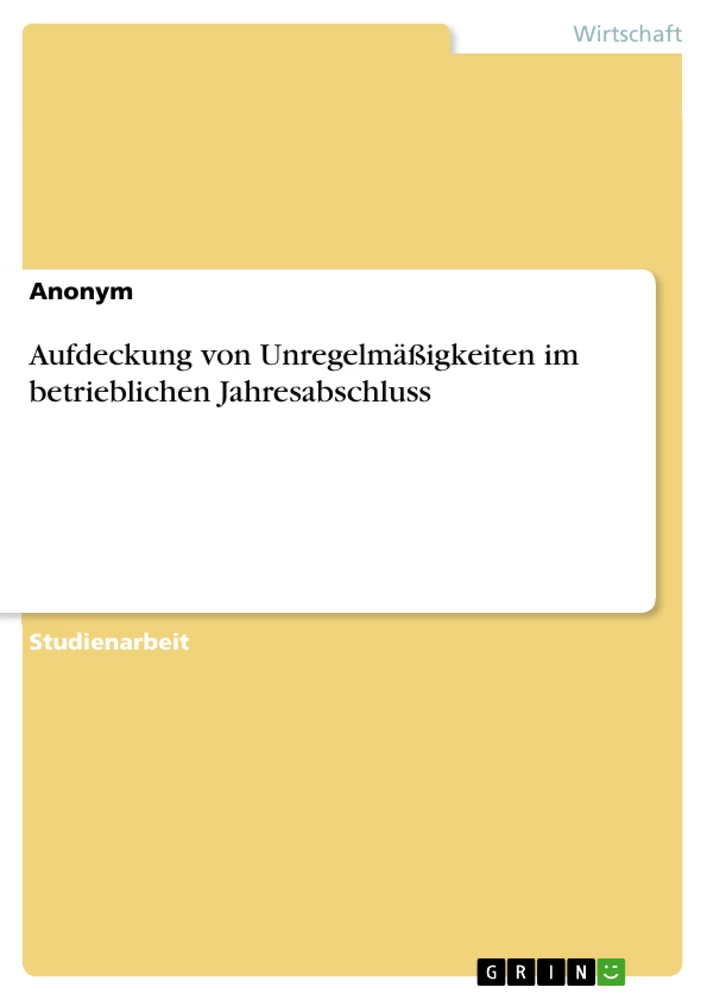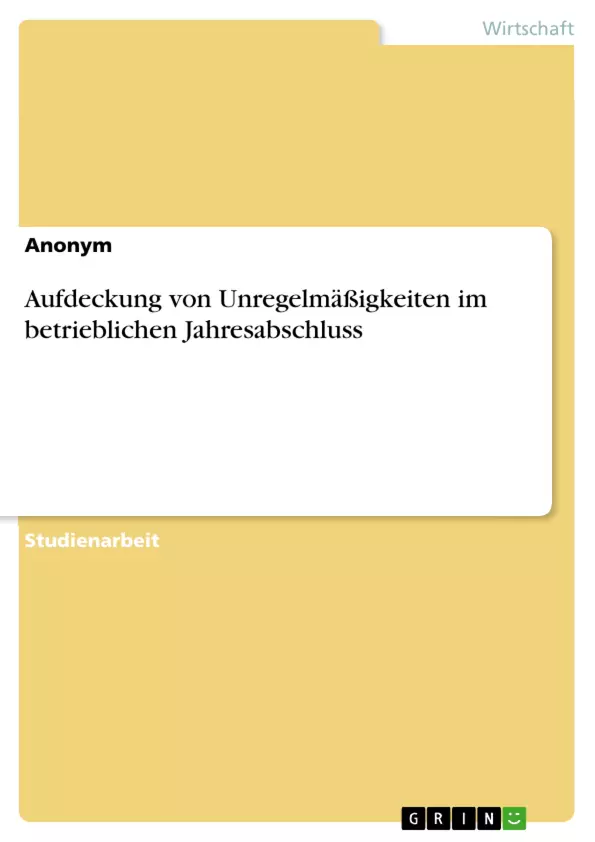Die Arbeit thematisiert die Aufdeckung von Unregelmäßigkeiten im Rahmen des von Abschlussprüfern durchgeführten Jahresabschluss. Dabei geht sie zunächst auf die Abgrenzung des Aufgabenbereiches von Aufsichtsrat und Abschlussprüfer ein, um dann im Kernpunkt der Arbeit die Thematik der Aufdeckung von Fraud aufzugreifen. Im Rahmen des darauffolgenden Prüfungsprozesses konzentriert sich die Arbeit dabei auf die Prüfung des internen Kontrollsystems (IKS) und greift zudem, in Verbindung mit dem Fraud-Triangle, einen Praxisfall aus den USA auf, anhand dessen die zuvor ausgeführte These nochmals veranschaulicht wird.
Inhaltsverzeichnis
- Pflichten und Aufgaben im Zusammenhang mit dem betrieblichen Jahresabschluss
- Pflichten und Aufgaben des Abschlussprüfers
- Pflichten und Aufgaben des Aufsichtsrates
- Die Aufdeckung von Fraud
- Grundlagen von Fraud
- Professionelle Skepsis
- Red Flags
- Begriffsdefinitionen und Systematisierung
- Gesetzliche Grundlagen
- Internationale Fraud-Standards nach ISA 240
- Erklärungsansatz des Auftretens von Fraud
- Fraud-Triangel Modell
- Prüfungsprozess anhand einer Systemprüfung
- Die Rolle und Zielsetzung des internen Kontrollsystems
- Vorgehensweise
- Praxisfall Enron
- Thesenförmige Zusammenfassung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Seminararbeit befasst sich mit der Aufdeckung von Unregelmäßigkeiten im Rahmen des Jahresabschlusses, den Abschlussprüfer durchführen. Der Schwerpunkt liegt dabei auf der Rolle des Abschlussprüfers bei der Identifizierung von Fraud (Betrug) und der Analyse von internen Kontrollsystemen.
- Abgrenzung der Aufgaben von Aufsichtsrat und Abschlussprüfer
- Definition und Erläuterung von Fraud
- Analyse der rechtlichen Rahmenbedingungen für die Aufdeckung von Fraud
- Prüfung des internen Kontrollsystems im Kontext von Fraud
- Anwendung des Fraud-Triangle-Modells an einem Praxisbeispiel
Zusammenfassung der Kapitel
Kapitel 2 analysiert die Pflichten und Aufgaben von Abschlussprüfern und Aufsichtsräten im Zusammenhang mit dem betrieblichen Jahresabschluss. Der Fokus liegt dabei auf den rechtlichen Vorgaben und den Erwartungen, die an diese Akteure gestellt werden.
Kapitel 3 widmet sich dem Thema Fraud. Hier werden die Grundlagen, Red Flags, Begriffsdefinitionen und gesetzliche Grundlagen erläutert. Außerdem wird das Fraud-Triangle-Modell vorgestellt, das die Entstehung von Fraud erklärt.
Kapitel 4 beschreibt den Prüfungsprozess anhand einer Systemprüfung, wobei die Rolle und Zielsetzung des internen Kontrollsystems (IKS) im Mittelpunkt stehen. Es wird zudem die Vorgehensweise bei der Prüfung des IKS erläutert.
Kapitel 5 behandelt den Praxisfall Enron, um die zuvor ausgeführten Thesen anhand eines konkreten Falles zu veranschaulichen.
Schlüsselwörter
Die Arbeit konzentriert sich auf die Themen Abschlussprüfung, Fraud, internes Kontrollsystem, Fraud-Triangle, Enron, und die rechtlichen Rahmenbedingungen, die im Zusammenhang mit der Aufdeckung von Unregelmäßigkeiten relevant sind. Die Arbeit analysiert die Rolle des Abschlussprüfers bei der Prävention und Aufdeckung von Fraud und setzt sich mit den Herausforderungen auseinander, die sich aus der wachsenden Bedeutung von Wirtschaftskriminalität ergeben.
- Arbeit zitieren
- Anonym (Autor:in), 2020, Aufdeckung von Unregelmäßigkeiten im betrieblichen Jahresabschluss, München, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/1263916