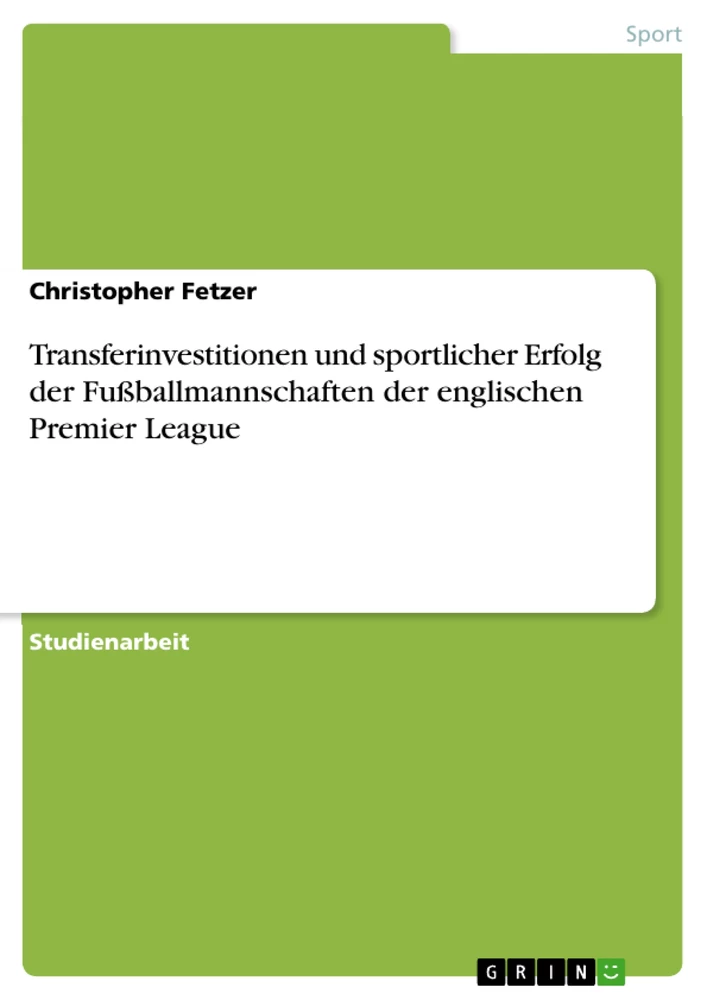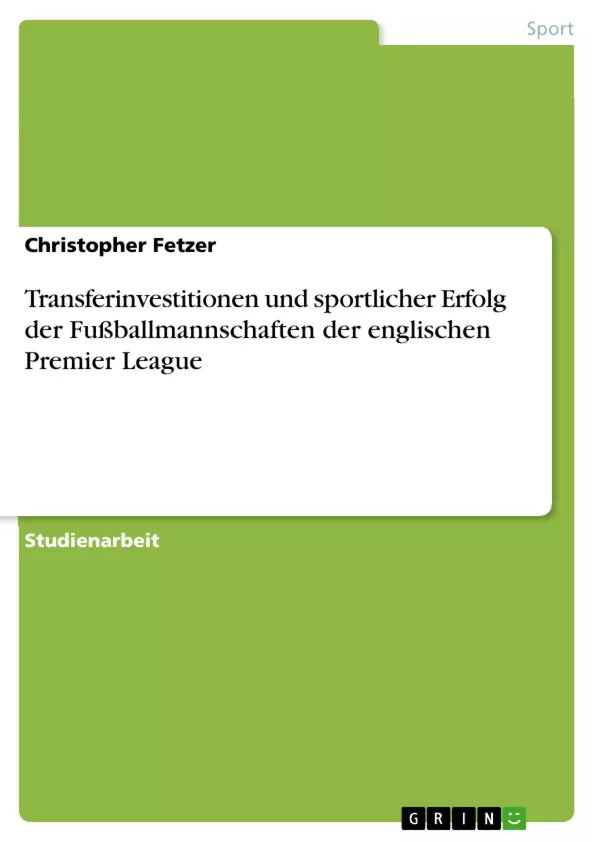Die Zielstellung des wissenschaftlichen Projekts ist es, anhand eines systematischen Literaturreviews, zu analysieren, ob die Mannschaften der englischen Premier League mehr Geld in Transferinvestitionen tätigen als andere Mannschaften der europäischen Top-Ligen. Zudem werden die sportlichen internationalen Erfolge der letzten Jahre im internationalen Wettbewerb der englischen Fußballmannschaften untersucht.
Gegebenenfalls existiert hierbei sogar ein bestimmter Zusammenhang von Transferinvestitionen in Relation zum sportlichen Miss/Erfolg? Um dies prüfen zu können, habe ich die Kernaussage in mehrere unterkategorisierte Fragen, die die Hauptaussage umschließen, gespaltet. Als Analysewerkzeuge nutze ich hierbei ausgewählte Studien, wissenschaftliche Artikel, bestätigte Statistiken und ausgesuchte Literaturbeiträge. Daraufhin werden Ergebnisse vorgestellt, die dazu beitragen, die Kernaussage zu bestätigen.
Inhaltsverzeichnis
- 1 Einleitung und Fragestellung
- 2 Zielsetzung
- 3 Gegenwärtiger Forschungsstand
- 3.1 Theoretische Grundlagen
- 3.1.1 Definition Spielertransfer/Investition
- 3.1.2 Definition Sportlicher Erfolg
- 3.1.3 Definition Europäische Top-Ligen
- 3.2 Quantitativer Vergleich der Transferausgaben
- 3.2.1 Verhältnis der Transferausgaben Englands zu weiteren Ländern (2017)
- 3.2.2 Transferausgaben der englischen Premier League (2017/2018)
- 3.2.3 Gegenüberstellung an Erfolgen der europäischen Mannschaften
- 3.3 Gegenüberstellung der empirischen Studien von Erik Lehmann & Jürgen Weigand (1997) und Bernd Frick (2004)
- 3.3.1 Lehmann & Weigand (1997) Fußball als ökonomisches Phänomen: „Money Makes the Ball Go Round“
- 3.3.2 Frick (2004) Die Voraussetzungen sportlichen und wirtschaftlichen Erfolgs in der Fußball-Bundesliga
- 3.1 Theoretische Grundlagen
- 4 Methodik
- 4.1 Die Vorbereitung der Datenerfassung
- 4.2 Die Vorgehensweise der Literaturauswahl
- 4.3 Die Ein-/Ausschlusskriterien
- 4.4 Theoretische Grundlagen eines Literaturreview
- 5 Ergebnisse
- 6 Diskussion
- 7 Zusammenfassung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Zielsetzung dieses wissenschaftlichen Projekts besteht darin, den Zusammenhang zwischen Transferinvestitionen und sportlichem Erfolg in der englischen Premier League zu untersuchen. Es wird analysiert, ob die hohen Transferausgaben englischer Fußballvereine tatsächlich zu einem entsprechenden sportlichen Erfolg führen oder ob andere Faktoren eine größere Rolle spielen.
- Analyse der Transferausgaben englischer Vereine im Vergleich zu anderen europäischen Top-Ligen.
- Untersuchung des Zusammenhangs zwischen Transferinvestitionen und sportlichem Erfolg.
- Bewertung der Bedeutung von Transferinvestitionen als Faktor für den sportlichen Erfolg.
- Auswertung relevanter empirischer Studien zum Thema.
- Beurteilung der Aussagekraft der Ergebnisse.
Zusammenfassung der Kapitel
1 Einleitung und Fragestellung: Die Einleitung stellt die zentrale Forschungsfrage nach dem Zusammenhang zwischen hohen Transferinvestitionen englischer Fußballmannschaften und deren sportlichem Erfolg. Ausgehend von der Beobachtung, dass englische Vereine im Vergleich zu anderen europäischen Top-Ligen hohe Summen für Spielertransfers ausgeben, aber nicht immer den entsprechenden sportlichen Erfolg erzielen, werden konkrete Forschungsfragen formuliert. Diese Fragen zielen darauf ab, die Höhe der Transferausgaben zu quantifizieren, den Zusammenhang mit dem sportlichen Erfolg zu analysieren und die Vergleichbarkeit mit anderen Ligen herzustellen. Die Einleitung legt den methodischen Ansatz einer Literaturarbeit fest, die verschiedene Studien und Statistiken heranziehen wird.
Schlüsselwörter
Transferinvestitionen, sportlicher Erfolg, englische Premier League, europäische Top-Ligen, empirische Studien, Fußballökonomie, Literaturreview.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zum Dokument: Analyse von Transferinvestitionen und sportlichem Erfolg in der englischen Premier League
Was ist das Thema des Dokuments?
Das Dokument analysiert den Zusammenhang zwischen hohen Transferinvestitionen und sportlichem Erfolg in der englischen Premier League. Es untersucht, ob die erheblichen Ausgaben englischer Fußballvereine für Spielertransfers tatsächlich zu einem entsprechenden sportlichen Erfolg führen oder ob andere Faktoren eine wichtigere Rolle spielen.
Welche Forschungsfragen werden im Dokument behandelt?
Das Dokument untersucht die Höhe der Transferausgaben englischer Vereine im Vergleich zu anderen europäischen Top-Ligen. Es analysiert den Zusammenhang zwischen Transferinvestitionen und sportlichem Erfolg und bewertet die Bedeutung von Transferinvestitionen als Faktor für den sportlichen Erfolg. Zudem wertet es relevante empirische Studien zum Thema aus und beurteilt die Aussagekraft der Ergebnisse.
Welche Methodik wird angewendet?
Das Dokument verwendet einen Literaturreview-Ansatz. Die Methodik umfasst die Vorbereitung der Datenerfassung, die Vorgehensweise der Literaturauswahl, die Definition von Ein- und Ausschlusskriterien und die Anwendung theoretischer Grundlagen eines Literaturreviews.
Welche Kapitel umfasst das Dokument?
Das Dokument gliedert sich in folgende Kapitel: Einleitung und Fragestellung, Zielsetzung, Gegenwärtiger Forschungsstand (inkl. theoretischer Grundlagen, quantitativer Vergleich der Transferausgaben und Gegenüberstellung empirischer Studien), Methodik, Ergebnisse, Diskussion und Zusammenfassung.
Welche Schlüsselbegriffe sind relevant?
Die wichtigsten Schlüsselbegriffe sind: Transferinvestitionen, sportlicher Erfolg, englische Premier League, europäische Top-Ligen, empirische Studien, Fußballökonomie, Literaturreview.
Welche empirischen Studien werden berücksichtigt?
Das Dokument bezieht sich auf die empirischen Studien von Erik Lehmann & Jürgen Weigand (1997) ("Fußball als ökonomisches Phänomen: „Money Makes the Ball Go Round“") und Bernd Frick (2004) ("Die Voraussetzungen sportlichen und wirtschaftlichen Erfolgs in der Fußball-Bundesliga").
Wie wird der Gegenwartsforschungsstand dargestellt?
Der Gegenwartsforschungsstand wird durch einen quantitativen Vergleich der Transferausgaben Englands mit anderen Ländern, eine Analyse der Transferausgaben in der englischen Premier League und eine Gegenüberstellung mit dem sportlichen Erfolg europäischer Mannschaften dargestellt. Zusätzlich werden die oben genannten empirischen Studien von Lehmann & Weigand und Frick verglichen und eingeordnet.
Welche Definitionen werden verwendet?
Das Dokument definiert Spielertransfer/Investition, sportlichen Erfolg und europäische Top-Ligen.
Was ist die Zielsetzung des Projekts?
Die Zielsetzung besteht darin, den Zusammenhang zwischen Transferinvestitionen und sportlichem Erfolg in der englischen Premier League zu untersuchen.
Wo finde ich eine Zusammenfassung der Kapitel?
Eine Zusammenfassung der Kapitel, insbesondere der Einleitung und Fragestellung, ist im Dokument enthalten.
- Quote paper
- Christopher Fetzer (Author), 2017, Transferinvestitionen und sportlicher Erfolg der Fußballmannschaften der englischen Premier League, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/1262744