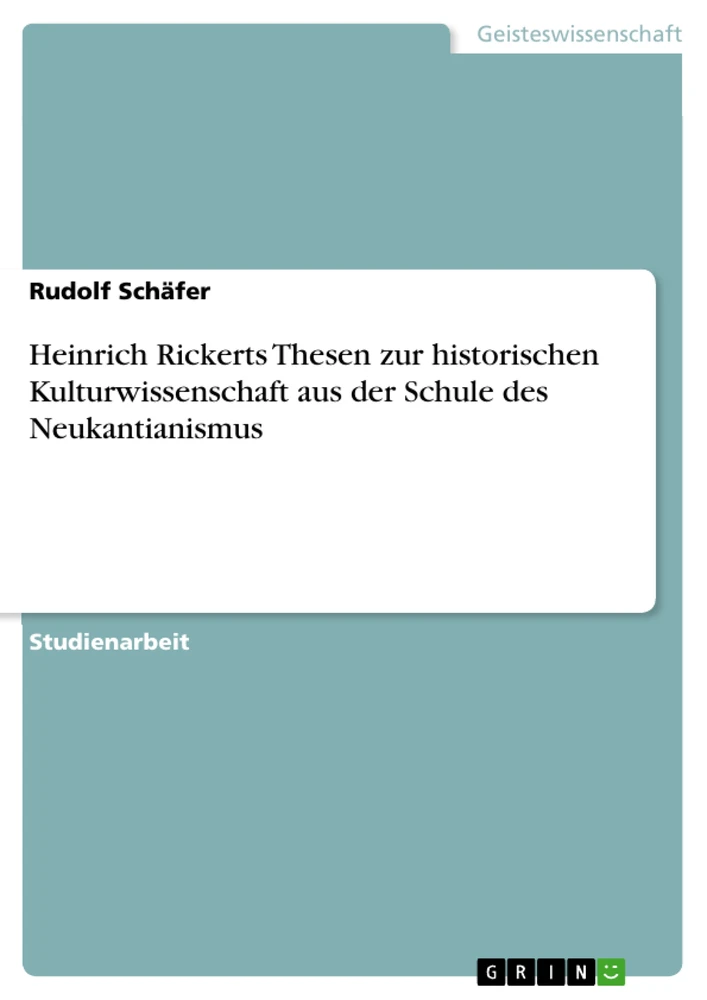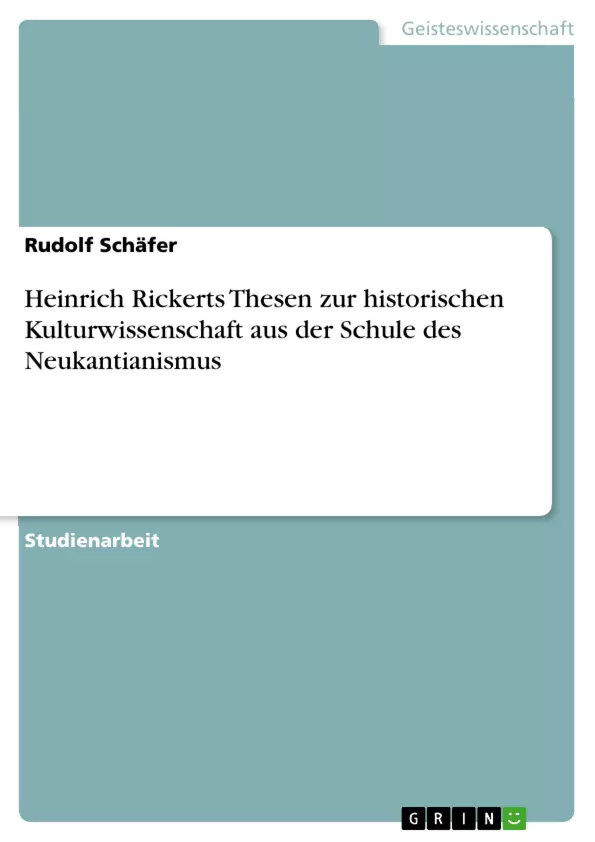Ziel der Hausarbeit ist es, die von Heinrich Rickert 1898 zum ersten Mal vorgestellte und 1926 zum letzten Mal überarbeitete Schrift "Kulturwissenschaft und Naturwissenschaft" im Zusammenhang mit den Thesen Wilhelm Windelbands darzustellen. Hierzu werden zunächst in Kapitel 2 die Thesen Windelbands zur Einteilung der empirischen Wissenschaften beschrieben. Kapitel 3 beinhaltet zunächst die Gemeinsamkeiten von Windelband und Rickert. Im Anschluss hieran erfolgt eine Beschreibung der von Rickert bei Windelband kritisch betrachteten Punkte. Im letzten Unterabschnitt werden die neuen Thesen Rickerts zur historischen Begriffsbildung behandelt. Nach der Darstellung einiger Kritiken zu Rickerts Thesen in Kapitel 4, wird die Arbeit in Kapitel 5 mit einer Zusammenfassung und einem Fazit geschlossen.
Die Südwestdeutsche Schule des Neukantianismus war um 1890 bis 1930 eine an Werten orientierte Philosophie, die vor allem an den Universitäten in Heidelberg, Freiburg im Breisgau und Straßburg gelehrt wurde. Hauptvertreter waren Wilhelm Windelband (1848–1915) und sein Schüler Heinrich Rickert (1863–1936). Windelband gab den Anstoß mit einem Methodendualismus, indem er die empirischen Wissenschaften aufgrund der Methoden der Urteilsbildung in Naturwissenschaften und Geistes- bzw. Kulturwissenschaften einteilte. Rickert unterschied innerhalb der empirischen Wissenschaften in Naturwissenschaften und Kulturwissenschaften.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Empirische Wissenschaften bei Wilhelm Windelband
- Die Einteilung der empirischen Wissenschaften
- Individualistische Auffassung von Werten
- Die historische Kulturwissenschaft bei Heinrich Rickert
- Gemeinsamkeiten bei Wilhelm Windelband und Heinrich Rickert
- Kritiken von Heinrich Rickert an Wilhelm Windelband
- Erweiterungen von Heinrich Rickert
- Mittelgebiete
- Wert und Geltung
- Kritiken an Rickerts Thesen
- Kritik an den Zielen und Methoden
- Kritik an der Wert/Wertung-Dichotomie
- Kritik an der transzendentalen Lösung
- Die Inkommensurabilität von Werten
- Zusammenfassung und Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit befasst sich mit der von Heinrich Rickert im Kontext der Thesen Wilhelm Windelbands entwickelten Schrift "Kulturwissenschaft und Naturwissenschaft". Ziel ist es, Rickerts Thesen darzustellen, die er 1898 erstmals vorstellte und 1926 letztmals überarbeitete. Dazu werden zunächst die Thesen Windelbands zur Einteilung der empirischen Wissenschaften beleuchtet. Anschließend werden die Gemeinsamkeiten von Windelband und Rickert hervorgehoben und Rickerts kritische Auseinandersetzung mit Windelbands Ansätzen beleuchtet. Die Arbeit schließt mit einer Darstellung der neuen Thesen Rickerts zur historischen Begriffsbildung sowie einer Zusammenfassung und einem Fazit.
- Einteilung der empirischen Wissenschaften nach Windelband und Rickert
- Kritische Analyse von Rickerts Erweiterungen zu Windelbands Thesen
- Die Rolle von Werten und Geltung in der historischen Kulturwissenschaft
- Diskussion der Methoden und Ziele der historischen Kulturwissenschaft
- Die Bedeutung der Inkommensurabilität von Werten für die Geschichtswissenschaft
Zusammenfassung der Kapitel
Das zweite Kapitel stellt die Thesen Windelbands zur Einteilung der empirischen Wissenschaften dar. Windelband kritisiert die traditionelle Einteilung in Natur- und Geisteswissenschaften und argumentiert für eine Unterscheidung zwischen nomothetischen und idiographischen Wissenschaften. Die nomothetischen Wissenschaften streben nach allgemeinen Gesetzmäßigkeiten, während die idiographischen Wissenschaften sich mit dem Besonderen und Einmaligen befassen. Windelband sieht in der Psychologie ein Beispiel für eine Wissenschaft, die sowohl naturwissenschaftliche Methoden als auch geisteswissenschaftliche Inhalte verwendet. Das dritte Kapitel beleuchtet die Gemeinsamkeiten zwischen Windelband und Rickert sowie Rickerts Kritik an Windelbands Thesen. Rickert erweitert Windelbands Konzept der historischen Kulturwissenschaft und stellt die Bedeutung von Werten und Geltung für die wissenschaftliche Erkenntnis heraus. Das vierte Kapitel präsentiert verschiedene Kritiken an Rickerts Thesen, darunter Kritik an den Zielen und Methoden der historischen Kulturwissenschaft, Kritik an der Wert/Wertung-Dichotomie und Kritik an der transzendentalen Lösung.
Schlüsselwörter
Schlüsselwörter dieser Arbeit sind empirische Wissenschaften, Naturwissenschaften, Geisteswissenschaften, Kulturwissenschaft, historische Kulturwissenschaft, Wilhelm Windelband, Heinrich Rickert, nomothetische Wissenschaften, idiographische Wissenschaften, Werte, Geltung, Methoden, Ziele, Kritik, Begriffsbildung.
Häufig gestellte Fragen
Wer war Heinrich Rickert und welcher philosophischen Schule gehörte er an?
Heinrich Rickert (1863–1936) war ein Hauptvertreter der Südwestdeutschen Schule des Neukantianismus, die sich stark an Werten orientierte.
Was ist der Unterschied zwischen nomothetischen und idiographischen Wissenschaften?
Nomothetische Wissenschaften (Naturwissenschaften) suchen nach allgemeinen Gesetzen, während idiographische Wissenschaften (Kulturwissenschaften) das Besondere und Einmalige beschreiben.
Welche Thesen vertrat Rickert in "Kulturwissenschaft und Naturwissenschaft"?
Rickert entwickelte eine Methode zur historischen Begriffsbildung, die auf Werten und Geltung basiert, um Kulturwissenschaften wissenschaftlich von Naturwissenschaften abzugrenzen.
Wie unterschied sich Rickert von seinem Lehrer Wilhelm Windelband?
Rickert erweiterte Windelbands Methodendualismus, kritisierte dessen individualistische Wertauffassung und führte Konzepte wie "Mittelgebiete" und die transzendentale Lösung ein.
Welche Kritikpunkte gibt es an Rickerts Thesen?
Kritiker bemängeln unter anderem die starre Trennung von Wert und Wertung (Dichotomie) sowie die angenommene Unvereinbarkeit (Inkommensurabilität) verschiedener Werte.
Welche Bedeutung haben Werte für die historische Kulturwissenschaft?
Werte dienen laut Rickert als Auswahlkriterium, um aus der unendlichen Fülle historischer Fakten diejenigen herauszufiltern, die für eine Kultur von Bedeutung sind.
- Arbeit zitieren
- Rudolf Schäfer (Autor:in), 2021, Heinrich Rickerts Thesen zur historischen Kulturwissenschaft aus der Schule des Neukantianismus, München, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/1257813