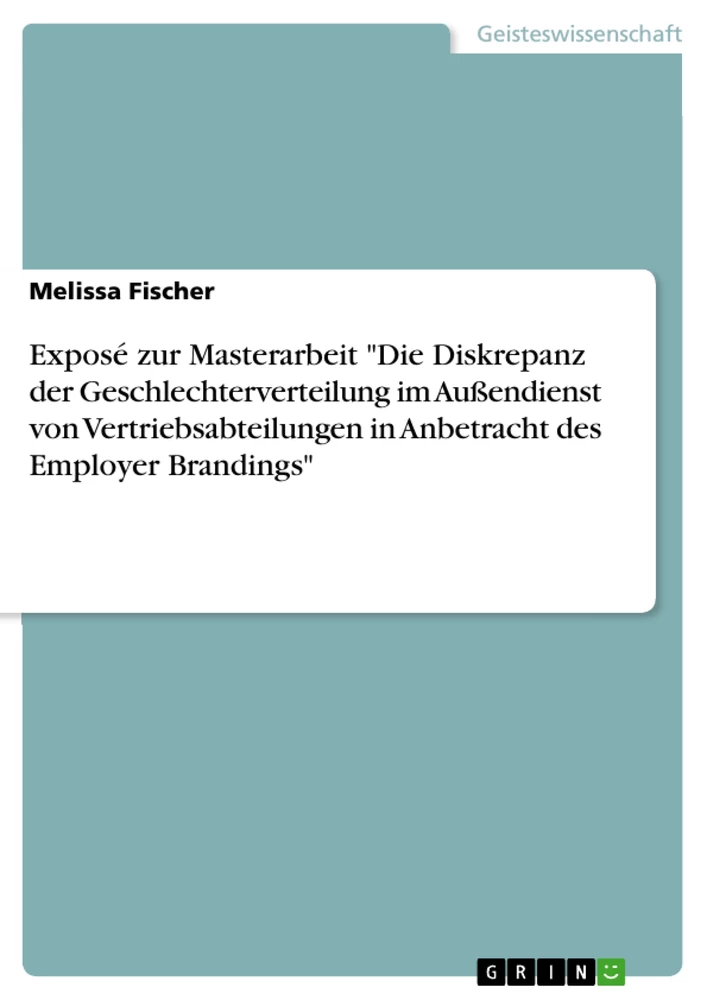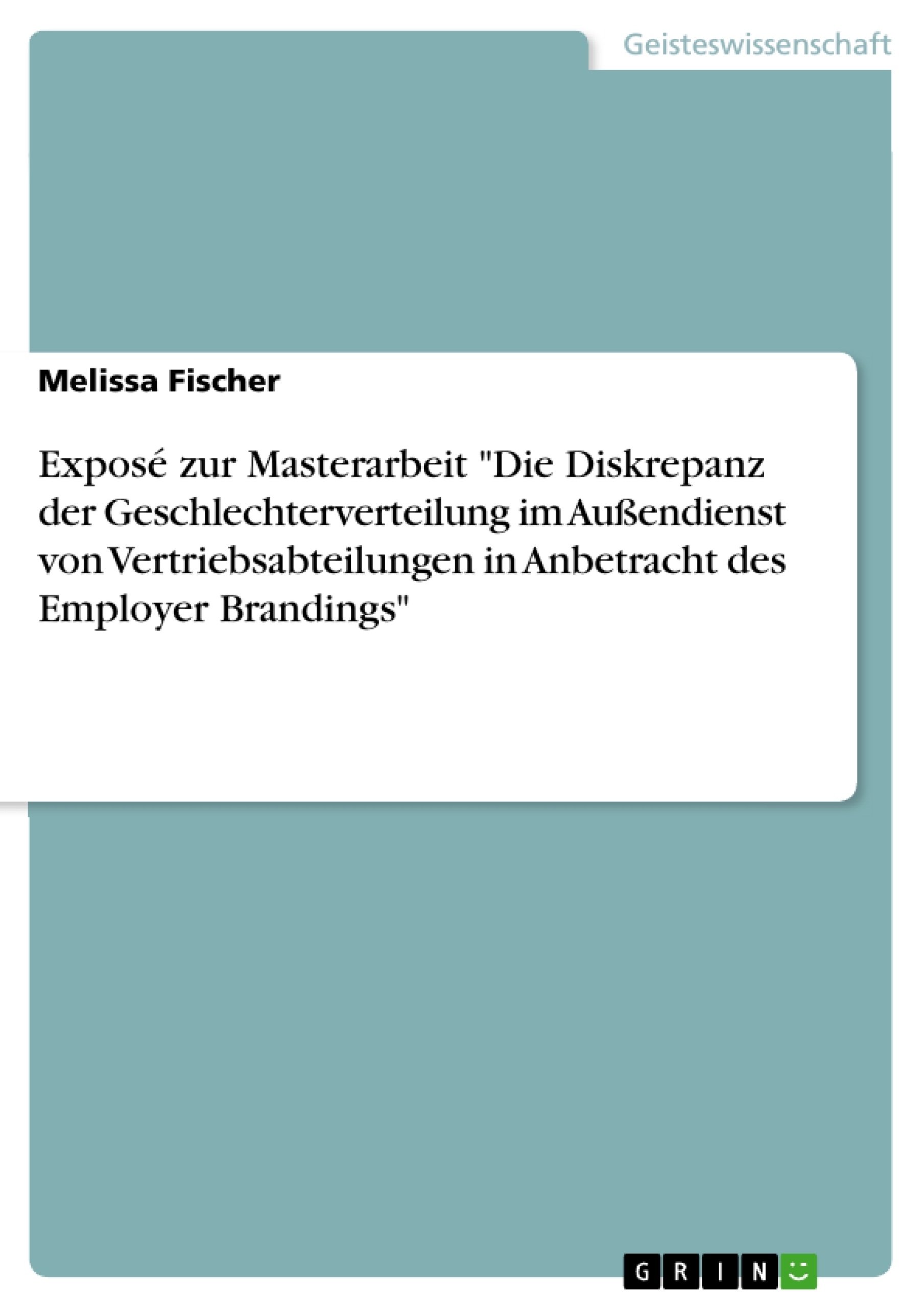Dieses Forschungsexposé arbeitet auf eine Masterarbeit mit dem Thema "Eine empirische Analyse der Diskrepanz der Geschlechterverteilung in deutschen Vertriebsabteilungen im Außendienst des Versicherungswesens in Anbetracht des Employer Branding" hin.
Im Hinblick auf die Diskrepanz der Geschlechterverteilung in Vertriebsabteilungen, v.a. in Bezug auf den Außendienst in Versicherungsunternehmen, ergibt sich die Fragestellung, welche Ursachen speziell auf diesen Umstand zurückzuführen sind.
Da sich die Arbeitsinhalte eines Außendienstmitarbeiters von denen eines Innendienstmitarbeiters unterscheiden, ergibt sich die erste Fragestellung: Welche Arbeitsinhalte können speziell im Außendienst eine Ursache für die ungleichmäßige Geschlechterverteilung im Außendienst darstellen? Des Weiteren sind die Rahmenbedingungen (Arbeitszeitregelung, Work-Life-Balance u.v.m.), die die Arbeit im Außendienst prägen, ein weiteres zu untersuchendes Kriterium, weshalb sich hieraus folgende Fragestellung entwickelt: Durch welche Rahmenbedingungen ist die Arbeit im Außendienst charakterisiert und beeinflussen solche die Frau bei Ihrer Wahl gegen eine Arbeit im Außendienst? Zusätzlich möchte herausgefunden werden, welche Erwartungen junge Berufseinsteigerinnen an die Arbeit im Außendienst in Versicherungsunternehmen haben. Mit dieser Fragestellung soll geprüft werden, inwiefern die Erwartungen junger Absolventinnen an diese Berufsgruppe der Realität entsprechen. Die Realität wird mithilfe der Ergebnisse der ersten beiden Fragestellungen widergespiegelt.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Problem
- 1.1 Forschungsgegenstand
- 1.2 Zielsetzung
- 1.3 Relevanz
- 2. Stand der Forschung
- 2.1 Stand der Forschung auf Basis aktuellster Publikationen
- 2.2 Resultierende Forschungslücke
- 3. Ziele des Vorhabens/ die der Arbeit zugrundeliegenden Hypothesen
- 3.1 Ziele des Vorhabens
- 3.2 Hypothesengenerierung
- 3.3 Theoretischer Bezugsrahmen
- 4. Gang der Untersuchung & Planung
- 4.1 Geplante methodische Vorgehensweise im Überblick mit Zeitplan
- 4.2 Vorläufige Gliederung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Masterarbeit untersucht die Diskrepanz der Geschlechterverteilung in deutschen Vertriebsabteilungen im Außendienst des Versicherungswesens. Die Arbeit zielt darauf ab, die Ursachen für den geringen Frauenanteil im Außendienst zu identifizieren und zu analysieren. Hierbei werden sowohl die Arbeitsinhalte als auch die Rahmenbedingungen der Tätigkeit betrachtet.
- Analyse der Arbeitsinhalte im Außendienst und deren Einfluss auf die Geschlechterverteilung
- Untersuchung der Rahmenbedingungen (Arbeitszeit, Work-Life-Balance etc.) im Außendienst
- Erforschung der Erwartungen junger Berufseinsteigerinnen an die Arbeit im Außendienst
- Vergleich von Erwartungen und Realität der Arbeit im Außendienst
- Ableitung von Handlungsempfehlungen für Unternehmen
Zusammenfassung der Kapitel
1. Problem: Dieses Kapitel legt den Forschungsgegenstand dar: die ungleiche Geschlechterverteilung in Vertriebsabteilungen des Versicherungswesens, insbesondere im Außendienst. Es wird ein Widerspruch zwischen dem hohen Frauenanteil in der Versicherungsbranche insgesamt und dem niedrigen Frauenanteil im Außendienst aufgezeigt. Der hohe Frauenanteil in anderen Abteilungen der Unternehmen wird als Indikator dafür genutzt, dass die geschlechtsspezifische Ungleichheit nicht branchenbedingt ist, sondern spezifische Faktoren im Außendienst zu berücksichtigen sind. Die bestehende Forschungslücke wird definiert und die Notwendigkeit einer detaillierten Untersuchung unterstrichen. Die vorliegende Diskrepanz wird als Ausgangspunkt der folgenden Forschungsfragen gesetzt.
1.1 Forschungsgegenstand: Der Abschnitt beschreibt den Fokus der Arbeit: die geringe Anzahl von Frauen im Außendienst von Versicherungsunternehmen. Er verortet diese Problematik historisch und stellt aktuelle Statistiken zum Frauenanteil in der Versicherungsbranche im Allgemeinen und im Außendienst im Besonderen gegenüber. Der deutliche Unterschied wird hervorgehoben und als Ausgangspunkt für die weiteren Kapitel etabliert. Es wird die These aufgestellt, dass die Ursachen nicht branchenbedingt, sondern auf spezifische Arbeitsbedingungen im Außendienst zurückzuführen sind.
1.2 Zielsetzung: In diesem Abschnitt werden die Forschungsfragen formuliert, die die Grundlage der Arbeit bilden. Es wird untersucht, welche Arbeitsinhalte und Rahmenbedingungen im Außendienst für die ungleiche Geschlechterverteilung verantwortlich sein könnten. Zusätzlich wird die Perspektive junger Berufseinsteigerinnen einbezogen, indem untersucht wird, inwieweit ihre Erwartungen an die Arbeit im Außendienst mit der Realität übereinstimmen. Diese Forschungsfragen leiten die methodische Vorgehensweise der gesamten Arbeit.
1.3 Relevanz: Die Relevanz der Forschungsfragen wird für verschiedene Zielgruppen dargelegt: zum einen für Frauen, insbesondere Berufseinsteigerinnen, um ihre Erwartungen an die Realität zu überprüfen. Zum anderen für Führungskräfte in Versicherungsunternehmen, um personalstrategische Entscheidungen zu verbessern und gegebenenfalls Arbeitsbedingungen anzupassen oder Aufklärungskampagnen durchzuführen. Die gesellschaftliche Relevanz der Geschlechtergerechtigkeit im Beruf wird ebenfalls betont.
Schlüsselwörter
Geschlechterverteilung, Vertrieb, Außendienst, Versicherungswesen, Employer Branding, Arbeitsinhalte, Rahmenbedingungen, Berufseinsteigerinnen, Personalstrategie, Forschungslücke, empirische Analyse.
Häufig gestellte Fragen zur Masterarbeit: Geschlechterverteilung im Außendienst des Versicherungswesens
Was ist der Forschungsgegenstand der Masterarbeit?
Die Masterarbeit untersucht die Diskrepanz der Geschlechterverteilung in deutschen Vertriebsabteilungen im Außendienst des Versicherungswesens. Konkret wird der geringe Frauenanteil im Außendienst im Vergleich zum höheren Frauenanteil in anderen Bereichen der Versicherungsbranche analysiert.
Welche Ziele verfolgt die Arbeit?
Die Arbeit zielt darauf ab, die Ursachen für den geringen Frauenanteil im Außendienst zu identifizieren und zu analysieren. Dabei werden sowohl die Arbeitsinhalte als auch die Rahmenbedingungen der Tätigkeit (Arbeitszeit, Work-Life-Balance etc.) betrachtet. Zusätzlich werden die Erwartungen junger Berufseinsteigerinnen an die Arbeit im Außendienst erforscht und mit der Realität verglichen. Abschließend werden Handlungsempfehlungen für Unternehmen abgeleitet.
Welche Themenschwerpunkte werden behandelt?
Die Arbeit behandelt folgende Themenschwerpunkte: Analyse der Arbeitsinhalte im Außendienst und deren Einfluss auf die Geschlechterverteilung; Untersuchung der Rahmenbedingungen im Außendienst; Erforschung der Erwartungen junger Berufseinsteigerinnen an die Arbeit im Außendienst; Vergleich von Erwartungen und Realität; Ableitung von Handlungsempfehlungen für Unternehmen.
Wie ist die Arbeit aufgebaut?
Die Arbeit gliedert sich in mehrere Kapitel: Kapitel 1 beschreibt das Problem (Forschungsgegenstand, Zielsetzung, Relevanz); Kapitel 2 behandelt den Stand der Forschung; Kapitel 3 definiert die Ziele und Hypothesen des Vorhabens und den theoretischen Bezugsrahmen; Kapitel 4 beschreibt den Gang der Untersuchung und die Planung (methodische Vorgehensweise und Zeitplan).
Welche Forschungslücke schließt die Arbeit?
Die Arbeit adressiert die Forschungslücke, die durch den Mangel an detaillierten Untersuchungen zu den spezifischen Ursachen der ungleichen Geschlechterverteilung im Außendienst des Versicherungswesens besteht. Der hohe Frauenanteil in anderen Abteilungen derselben Unternehmen deutet darauf hin, dass die geschlechtsspezifische Ungleichheit nicht branchenbedingt ist, sondern spezifische Faktoren im Außendienst zu berücksichtigen sind.
Welche Methoden werden angewendet?
Die Arbeit beschreibt eine geplante methodische Vorgehensweise, deren Details im Kapitel 4 (Gang der Untersuchung & Planung) erläutert werden. Ein konkreter Zeitplan ist ebenfalls enthalten.
Für wen ist die Arbeit relevant?
Die Arbeit ist relevant für verschiedene Zielgruppen: Frauen, insbesondere Berufseinsteigerinnen, um ihre Erwartungen an die Realität zu überprüfen; Führungskräfte in Versicherungsunternehmen, um personalstrategische Entscheidungen zu verbessern und gegebenenfalls Arbeitsbedingungen anzupassen oder Aufklärungskampagnen durchzuführen; und die Gesellschaft allgemein im Hinblick auf Geschlechtergerechtigkeit im Beruf.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Geschlechterverteilung, Vertrieb, Außendienst, Versicherungswesen, Employer Branding, Arbeitsinhalte, Rahmenbedingungen, Berufseinsteigerinnen, Personalstrategie, Forschungslücke, empirische Analyse.
- Arbeit zitieren
- Melissa Fischer (Autor:in), 2020, Exposé zur Masterarbeit "Die Diskrepanz der Geschlechterverteilung im Außendienst von Vertriebsabteilungen in Anbetracht des Employer Brandings", München, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/1257067