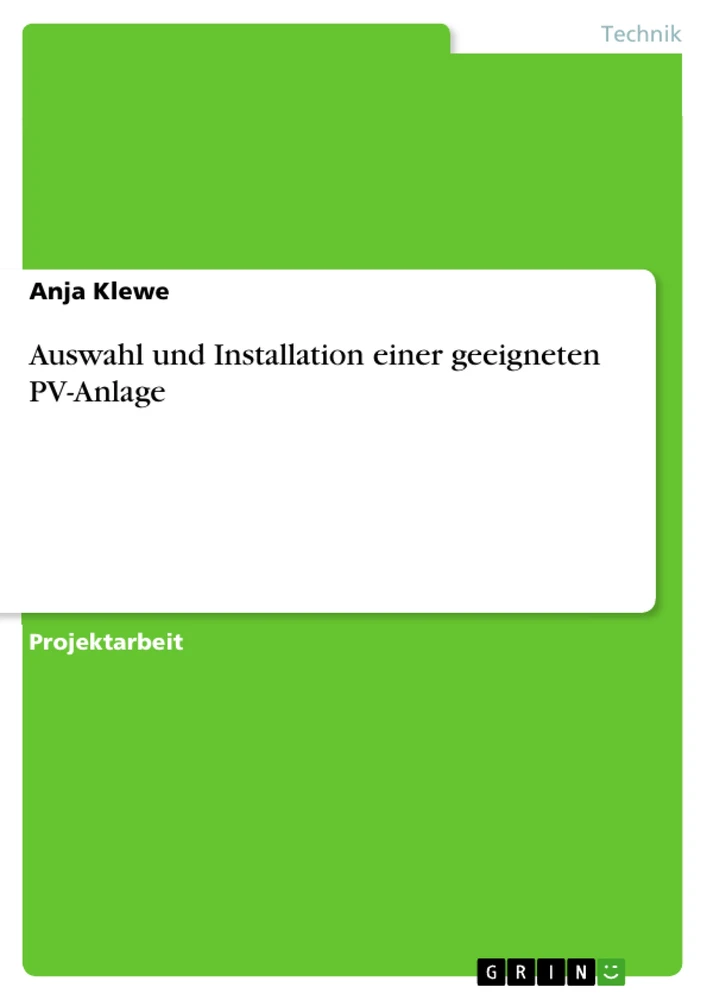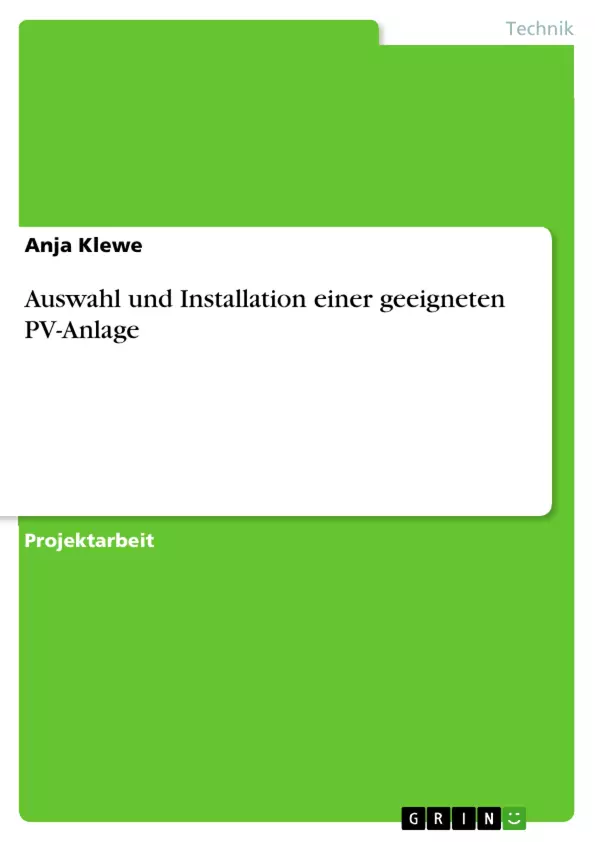Der Praxisbericht im Rahmen des berufsbegleitenden Studiums zum Wirtschaftsingenieur im Bereich erneuerbare Energien ist in drei Hauptteile gegliedert: Im ersten Teil wird die Ausgangslage und die Voraussetzungen für eine Installation einer Anlage beschrieben und es werden erste Stromverbrauchsdaten erfasst, die als Grundlage für die Auswahl einer geeigneten PV-Anlage dienen sollen. Im zweiten Teil sollen die Absprachen und Abläufe der Installation der eigentlichen PV-Anlage dargelegt werden. Im letzten Abschnitt sollen die erfassten Daten mit denen verglichen werden, die jeweils vor und nach der Installation vorliegen. Im Abschluss erfolgen ein Nachweis zur Wirtschaftlichkeit sowie ein Fazit zum Projekt.
Solarmodule auf dem Dach können Geld sparen, sind nachhaltig und sorgen für eine teilweise unabhängige Stromversorgung. Die ersten Überlegungen zu dem vorliegenden Projekt, fanden bereits im November 2021 mit dem Gedanken der Energiewende und der nachhaltigen Ausrichtung statt. Nach dem Februar 2022 kommt ein weiterer Faktor hinzu: Die politische Lage hat sich dramatisch verändert und die Entscheidung zu diesem Projekt wurde hierdurch bestärkt. Positiv für eine fristgerechte Umsetzung war dabei die frühe Entscheidung zum Kauf einer Anlage, da es aktuell zu Lieferengpässen und starken Preiserhöhungen kommt.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Begriffserklärung
- Aufbau und Funktion PV-Modul
- Wechselrichter
- Plug & Play-Anlage
- Planungsphase
- Ausgangslage
- Projektziel
- Projektskizze
- Durchführungsphase
- Datensammlung
- Datenerfassung
- Datenauswertung
- Daten PV-Anlage
- Technische Realisierungsphase
- Wechselrichter
- Solarmodule
- Montage und Anschluss
- Anmeldeverfahren
- Datensammlung
- Abschlussphase
- Visualisierung der Ergebnisse
- Wirtschaftlichkeit
- Zusammenfassung
- Erkenntnisse
- Entwicklung
- Fazit
- Quellenverzeichnis
- Anhang
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Das Praxisprojekt befasst sich mit der Auswahl und Installation einer geeigneten PV-Anlage. Ziel ist es, die Möglichkeiten einer autarken Stromversorgung durch Solarmodule zu erforschen und die Wirtschaftlichkeit der Anlage zu analysieren. Das Projekt soll dabei helfen, die Vorteile und Herausforderungen der Nutzung erneuerbarer Energien in der Praxis zu verstehen.
- Planung und Installation einer PV-Anlage
- Analyse des Stromverbrauchs und der Erträge der PV-Anlage
- Wirtschaftlichkeit der Anlage und Amortisationszeit
- Technische Aspekte der PV-Anlage, wie z.B. Wechselrichter, Solarmodule und Montage
- Vorteile und Herausforderungen der Nutzung erneuerbarer Energien
Zusammenfassung der Kapitel
- Einleitung: Dieses Kapitel führt in die Thematik der Photovoltaik ein und beschreibt die Motivation und den Hintergrund des Projekts. Die Relevanz der Energiewende und die aktuelle politische Lage werden als wichtige Einflussfaktoren für die Entscheidung zur Installation einer PV-Anlage genannt.
- Begriffserklärung: Das Kapitel beleuchtet grundlegende Begriffe im Zusammenhang mit Photovoltaik, wie z.B. Aufbau und Funktion von PV-Modulen, Wechselrichtern und Plug & Play-Anlagen. Es bietet somit einen ersten Einblick in die Funktionsweise der Technologie.
- Planungsphase: Die Planungsphase des Projekts beinhaltet die Erfassung der Ausgangslage, die Definition des Projektziels und die Erstellung einer Projektskizze. Es werden die relevanten Informationen und Daten gesammelt, um die Auswahl der geeigneten PV-Anlage zu ermöglichen.
- Durchführungsphase: Dieses Kapitel beschreibt die verschiedenen Schritte der Installation der PV-Anlage, von der Datensammlung und -auswertung bis hin zur technischen Realisierung und den Anmeldeformalitäten.
- Abschlussphase: Der letzte Abschnitt befasst sich mit der Visualisierung der Ergebnisse und der Bewertung der Wirtschaftlichkeit der Anlage. Die erzielten Daten werden analysiert und die Amortisationszeit berechnet.
- Zusammenfassung: Die Zusammenfassung fasst die wichtigsten Erkenntnisse und Ergebnisse des Projekts zusammen. Die Entwicklung und die zukünftigen Perspektiven der Anlage werden ebenfalls beleuchtet.
Schlüsselwörter
Photovoltaik (PV), Stromversorgung, Energiewende, Nachhaltigkeit, Wirtschaftlichkeit, Wechselrichter, Solarmodule, Montage, Datensammlung, Datenauswertung, Amortisationszeit.
Häufig gestellte Fragen
Was sind die drei Hauptteile dieses Praxisberichts?
1. Analyse der Ausgangslage und Stromverbrauchsdaten, 2. Dokumentation der Installation, 3. Datenvergleich und Wirtschaftlichkeitsnachweis.
Warum wurde das Projekt im November 2021 gestartet?
Die Hauptmotivationen waren die Energiewende, Nachhaltigkeit und später auch die veränderte politische Lage zur Sicherung der Energieunabhängigkeit.
Welche technischen Komponenten einer PV-Anlage werden erklärt?
Die Arbeit erläutert den Aufbau von PV-Modulen, die Funktion von Wechselrichtern und das Konzept von Plug & Play-Anlagen.
Wie wird die Wirtschaftlichkeit der Anlage ermittelt?
Durch einen Vergleich der Stromverbrauchsdaten vor und nach der Installation sowie die Berechnung der Amortisationszeit.
Welche Rolle spielt das Anmeldeverfahren?
Die Arbeit beschreibt die notwendigen bürokratischen Schritte und Formalitäten, die für den ordnungsgemäßen Betrieb der Anlage erforderlich sind.
- Quote paper
- Anja Klewe (Author), 2022, Auswahl und Installation einer geeigneten PV-Anlage, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/1255459