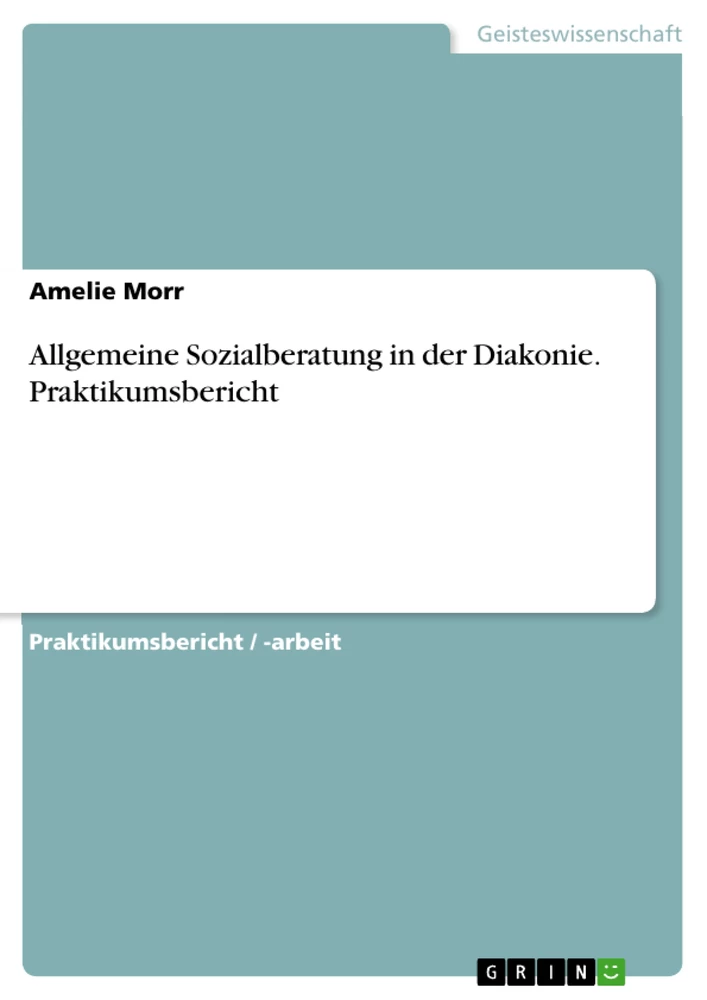Ich nutze diesen Praktikumsbericht, um eine Übersicht über große Verbandstrukturen zu bekommen. In diesem Praktikumsbericht mache ich dies exemplarisch an der Evangelischen Kirche und ihrem Wohlfahrtsverband der Diakonie, da mein Praktikum in dieser in der Kirchenkreissozialarbeit stattfand. So will ich als Sozialarbeiterin, die im Privaten Atheistin ist, mit neutraler Sicht dieses Arbeitsgebiet beschreiben. Hierzu gehört es auch einen geschichtlichen Abriss darzustellen, da ich vermute, dass viele Strukturen, in die die Soziale Arbeit eingebunden ist, über geschichtliche Prozesse entstanden sind.
Die Rahmenbedingungen an meinen Praktikumsplatz beschreibe ich weiter in Kapitel 1.2, um so in Kapitel 2 Resümee zu ziehen, wie sich die Rahmenbedingungen aller Ebenen auf die Kirchenkreissozialarbeit auswirken. Des Weiteren will ich diesen Praktikumsbericht nutzen, um das Feld in dem ich mein Praktikum gemacht habe und meine Tätigkeiten in diesem zu reflektieren. So beschreibe ich zum Beispiel durch den Bezug auf die Begriffsbestimmung und historischen Aspekte im Praxisfeld der Kirchenkreissozialarbeit in Kapitel 3 Adressat*innen und Methoden/Arbeitsweisen vor Ort, sowie meine Tätigkeit.
Aus dieser kommt der in Kapitel 5 beschriebene und nach Burkard Müllers multiperspektivischer Methode reflektierte Fall, den ich gewählt habe, da die Personen, die im Beratungsgespräch saßen zur Mittelschicht gehören und nicht die Hilfesuchenden waren, die ich sonst kennengelernt hatte und eher der Unterschicht zuzuordnen. Um von der bipolaren Geschlechteraufteilung, die in unserer Gesellschaft stattfindet, wegzukommen, nutze ich den Gender Gap. Mit einem Unterstrich (ein*e gut ausgebildete*r Akademiker*in) will ich weitere neben dem weiblichen und männlichen Geschlecht existierende Geschlechter sichtbar machen.
Inhaltsverzeichnis
- Abkürzungsverzeichnis
- Einleitung
- Institutionsporträt
- Rahmenbedingungen auf Bundes- und Landesebene
- Geschichtliches
- Gegenwart
- Bedeutung dieser Struktur
- Rahmenbedingungen des Diakonischen Werkes XX mit Außenstelle D
- Rahmenbedingungen Allgemein
- Fachliche und arbeitsrechtliche Rahmenbedingungen
- Finanzielle Rahmenbedingungen
- Materielle Rahmenbedingungen
- Auswirkungen der Rahmenbedingungen auf die Kirchenkreissozialarbeit
- Auswirkungen der materiellen Rahmenbedingungen
- Auswirkungen durch finanzielle Rahmenbedingungen
- Auswirkungen durch fachliche und arbeitsrechtliche Rahmenbedingungen
- Auswirkungen durch die Landes- und Bundesebene
- Praxisfeld Kirchenkreissozialarbeit
- Begriffsbestimmung Kirchenkreissozialarbeit
- Historische Aspekte
- Adressat*innen der Kirchkreissozialarbeit
- Methoden und Arbeitsweisen
- Beschreibung meiner Tätigkeit
- Ich habe die Aufgaben der Kirchkreissozialarbeit in der folgenden Umsetzung kennengelernt (s. 3 Praxisfeld Kirchenkreissozialarbeit).
- Multiperspektivische Fallarbeit nach Burkard Müller
- Fallbeschreibung
- Fall von
- Fall für
- Fall mit
- Schlussfolgerung
- Literaturverzeichnis
- Anlageverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Der Praktikumsbericht verfolgt die Zielsetzung, einen Überblick über die Verbandsstrukturen der Evangelischen Kirche und ihrer Wohlfahrtsorganisation, der Diakonie, zu geben. Der Bericht beleuchtet insbesondere die Kirchenkreissozialarbeit, in der das Praktikum stattfand. Der Fokus liegt dabei auf der Beschreibung des Arbeitsfeldes aus neutraler Sicht einer Sozialarbeiterin, die privat atheistisch ist.
- Geschichtliche Entwicklung und Bedeutung von Diakonie und Kirchenkreissozialarbeit
- Rahmenbedingungen und Auswirkungen auf die Kirchenkreissozialarbeit auf verschiedenen Ebenen (Bundes-, Landes-, und Institutionsebene)
- Begriffsbestimmung, historische Aspekte und Arbeitsweisen der Kirchenkreissozialarbeit
- Beschreibung der eigenen Praxistätigkeit in der Kirchenkreissozialarbeit
- Reflektierter Fall aus der Praxistätigkeit unter Anwendung der multiperspektivischen Fallarbeit nach Burkard Müller
Zusammenfassung der Kapitel
- Kapitel 1: Das Institutionsporträt beschreibt die Verbandsstruktur der Evangelischen Kirche und der Diakonie, beginnend mit den Rahmenbedingungen auf Bundes- und Landesebene. Es beleuchtet die geschichtliche Entwicklung der Diakonie, ihre aktuelle Struktur sowie die Bedeutung dieser Struktur für die Organisation und Arbeit der Kirchenkreissozialarbeit.
- Kapitel 2: Dieses Kapitel analysiert die Auswirkungen der unterschiedlichen Rahmenbedingungen auf die Kirchenkreissozialarbeit. Dabei werden die Auswirkungen der materiellen, finanziellen, fachlichen und arbeitsrechtlichen Rahmenbedingungen sowie die Einflüsse von Landes- und Bundesebene betrachtet.
- Kapitel 3: Das Praxisfeld der Kirchenkreissozialarbeit wird im Detail beleuchtet. Es werden die Begriffsbestimmung und historische Aspekte der Kirchenkreissozialarbeit erläutert, sowie die Adressat*innen und die verwendeten Methoden und Arbeitsweisen vorgestellt. Die eigene Tätigkeit im Praktikum wird beschrieben.
- Kapitel 4: Dieses Kapitel beleuchtet die konkreten Aufgaben der Kirchenkreissozialarbeit und wie diese in der Praxis umgesetzt werden.
- Kapitel 5: Ein Fall aus der Praxistätigkeit wird anhand der multiperspektivischen Fallarbeit nach Burkard Müller reflektiert.
Schlüsselwörter
Die Schlüsselwörter des Textes sind: Kirchenkreissozialarbeit, Diakonie, Evangelische Kirche in Deutschland, Rahmenbedingungen, Arbeitsfeld, Praxis, multiperspektivische Fallarbeit, Burkard Müller, Adressat*innen, Methoden, Arbeitsweisen, Geschichte, Strukturen, Bedeutung, Auswirkungen, Gesetzgebung, Lobby, Selbsthilfegruppen, staatliche Anerkennung, Qualitätsstandards, Kontrollen.
Häufig gestellte Fragen
Was ist die Aufgabe der Kirchenkreissozialarbeit?
Sie bietet allgemeine Sozialberatung für Menschen in Notlagen an, unabhängig von deren Konfession, und fungiert als Bindeglied zwischen Kirche und staatlichen Hilfesystemen.
Wie ist die Diakonie strukturell aufgebaut?
Die Diakonie ist der Wohlfahrtsverband der Evangelischen Kirche und ist auf Bundes-, Landes- und Kirchenkreisebene organisiert, wobei jede Ebene eigene rechtliche und finanzielle Rahmenbedingungen hat.
Was ist die multiperspektivische Fallarbeit nach Burkard Müller?
Es ist eine Reflexionsmethode in der Sozialen Arbeit, die einen Fall aus verschiedenen Blickwinkeln betrachtet: als "Fall von" (Kategorie), "Fall für" (Zuständigkeit), "Fall mit" (Interaktion) und "Fall an sich".
Welchen Einfluss hat die Finanzierung auf die Beratungsarbeit?
Die Arbeit zeigt auf, wie finanzielle Rahmenbedingungen der Landeskirchen und staatliche Zuschüsse die Personalausstattung und damit die Qualität der Beratung beeinflussen.
Warum wird im Bericht der "Gender Gap" (Unterstrich) verwendet?
Um über die bipolare Geschlechteraufteilung hinaus auch weitere existierende Geschlechtsidentitäten in der Schriftsprache sichtbar zu machen.
- Arbeit zitieren
- Dipl.-Berufspäd. Amelie Morr (Autor:in), 2014, Allgemeine Sozialberatung in der Diakonie. Praktikumsbericht, München, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/1254784