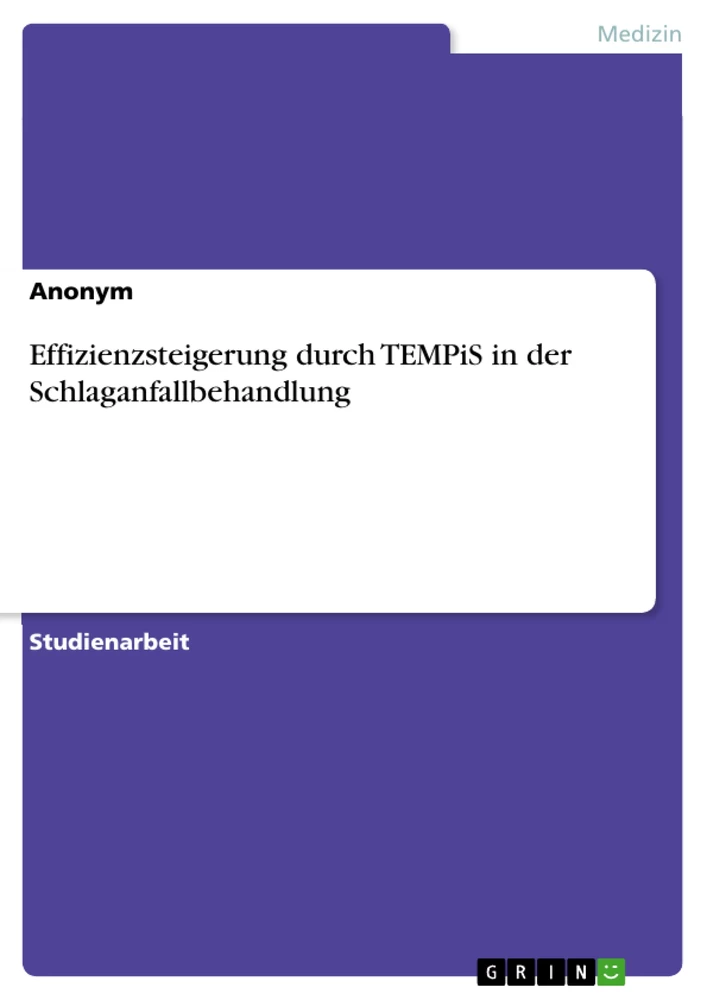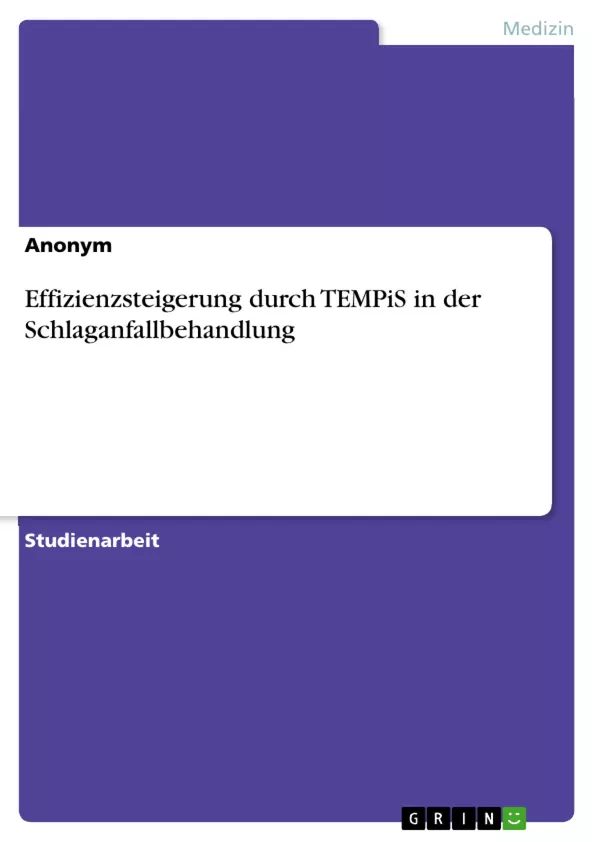Die vorliegende Hausarbeit beschäftigt sich mit der Fragestellung, wie groß der Nutzen und die Möglichkeiten für die Schlaganfallpatienten und das Gesundheitswesen sind, welche sich aus TEMPiS (dem Telemedizinische Projekt zur integrierten Schlaganfallversorgung) ergeben. Nach einer kurzen Definition des Schlaganfalls und dessen Epidemiologe, werden die Ursachen, ebenso wie die Therapie näher erläutert. Anschließend wird die derzeitige Versorgungssituation der Patienten in Deutschland und das Aufkommen, als auch die Entwicklung von TEMPiS dargestellt. Mithilfe der Vorstellung von TEMPiS wird im darauffolgenden Kapitel der Nutzen für die Patienten und das Gesundheitswesen, welcher sich aus dem Projekt ergibt, aufgezeigt. Anhand der vorhergehenden Betrachtung der Umstände und Vorteile soll abschließend eine Schlussfolgerung verdeutlichen, wie groß der Nutzen und die Möglichkeiten für die jeweilige Personengruppe ist.
Resultierend aus dem Versorgungsdefizit wurde 2003 das Telemedizinische Projekt zur integrierten Schlaganfallversorgung, auch TEMPiS genannt, gegründet. Mithilfe dieses Projekts sollen kleinere, ländliche Kliniken mit einer Knappheit an Ärzten in diesem Bereich unterstützt werden. TEMPiS bietet eine Onlinezuschaltung qualifizierten Personals direkt an das Krankenbett, welches sich nicht in unmittelbarer Nähe der Spezialisten befindet. Das bedeutet, das Personal vor Ort wird von der Erhebung der Diagnose, über die Auswertung der Computertomografiebilder bis hin zur Auswahl einer gezielten Therapie begleitet.
Inhaltsverzeichnis
- 1 Einleitung
- 2 Krankheitsbild Schlaganfall
- 2.1 Epidemiologie eines Schlaganfalls
- 2.2 Begriffsdefinition und Ursachen des Schlaganfalls
- 2.3 Therapie eines Schlaganfallpatienten
- 2.4 Versorgungssituation der Patienten
- 3 TEMPIS-Telemedizinisches Projekt zur integrierten Schlaganfallversorgung
- 3.1 Aufkommen von TEMPIS
- 3.2 Entwicklung von TEMPIS
- 4 Nutzen von TEMPIS
- 4.1 Für den Schlaganfallpatienten
- 4.2 Für das Gesundheitswesen
- 5 Zusammenfassung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Hausarbeit befasst sich mit der Frage, welchen Nutzen das Telemedizinische Projekt TEMPIS für Schlaganfallpatienten und das Gesundheitswesen bietet. Hierbei werden die Epidemiologie des Schlaganfalls, die Ursachen und Therapiemethoden sowie die derzeitige Versorgungssituation von Patienten beleuchtet. Anschließend wird die Entstehung und Entwicklung von TEMPIS sowie der Nutzen für Patienten und das Gesundheitswesen betrachtet.
- Epidemiologie und Krankheitsbild des Schlaganfalls
- Ursachen und Therapiemethoden des Schlaganfalls
- Aktuelle Versorgungssituation von Schlaganfallpatienten in Deutschland
- Entstehung und Entwicklung von TEMPIS als telemedizinisches Projekt
- Der Nutzen von TEMPIS für Schlaganfallpatienten und das Gesundheitswesen
Zusammenfassung der Kapitel
- Kapitel 1: Einleitung - Die Einleitung stellt das Problem des Schlaganfalls als häufige Todesursache und Behinderungsursache in Deutschland dar und führt das telemedizinische Projekt TEMPIS als Lösung für das Versorgungsdefizit in ländlichen Gebieten ein. Die Hausarbeit beschäftigt sich mit der Frage nach dem Nutzen von TEMPIS für Patienten und das Gesundheitswesen.
- Kapitel 2: Krankheitsbild Schlaganfall - Dieses Kapitel erläutert die Epidemiologie, die Definition, die Ursachen und die Therapie des Schlaganfalls sowie die aktuelle Versorgungssituation von Patienten in Deutschland. Es wird die Bedeutung einer zeitnahen und optimalen Behandlung im akuten Stadium des Schlaganfalls betont.
- Kapitel 3: TEMPIS - Telemedizinisches Projekt zur integrierten Schlaganfallversorgung - Hier wird das Telemedizinische Projekt TEMPIS vorgestellt, das 2003 gegründet wurde, um die Schlaganfallversorgung in ländlichen Regionen zu verbessern. Es werden die Entstehung und die Entwicklung von TEMPIS näher beleuchtet.
- Kapitel 4: Nutzen von TEMPIS - Dieses Kapitel widmet sich den positiven Auswirkungen von TEMPIS, sowohl für den Patienten als auch für das Gesundheitswesen. Es werden die Vorteile der telemedizinischen Unterstützung bei der Diagnose und Therapie des Schlaganfalls aufgezeigt.
Schlüsselwörter
Schlaganfall, Telemedizin, TEMPIS, Versorgungssituation, Epidemiologie, Therapie, Gesundheitswesen, Nutzen, Patienten, Ländliche Gebiete, Neurologie, Stroke Unit.
Häufig gestellte Fragen
Was ist das Projekt TEMPiS?
TEMPiS ist ein telemedizinisches Projekt zur integrierten Schlaganfallversorgung, das Spezialwissen per Videozuschaltung in ländliche Kliniken bringt.
Welchen Nutzen haben Schlaganfallpatienten durch TEMPiS?
Patienten in ländlichen Gebieten erhalten schneller eine qualifizierte Diagnose und Therapie (wie die Lysetherapie), was die Überlebenschancen und Lebensqualität deutlich erhöht.
Wie funktioniert die telemedizinische Unterstützung konkret?
Spezialisten aus Zentren werden online direkt an das Krankenbett zugeschaltet, bewerten CT-Bilder und begleiten das Personal vor Ort bei der Therapieentscheidung.
Warum ist die Zeit beim Schlaganfall so kritisch?
Unter dem Motto "Time is Brain" zählt jede Minute, um Hirngewebe zu retten. TEMPiS verkürzt die Zeit bis zum Behandlungsbeginn in Kliniken ohne eigene Neurologie.
Welchen Vorteil bietet TEMPiS für das Gesundheitswesen?
Es verbessert die Versorgungsstruktur in der Fläche, vermeidet unnötige Verlegungen und senkt durch bessere Behandlungserfolge die langfristigen Pflegekosten.
Wann wurde TEMPiS gegründet?
Das Projekt wurde im Jahr 2003 gegründet, um das Versorgungsdefizit zwischen Stadt und Land bei der Schlaganfallbehandlung zu schließen.
- Quote paper
- Anonym (Author), 2020, Effizienzsteigerung durch TEMPiS in der Schlaganfallbehandlung, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/1254402