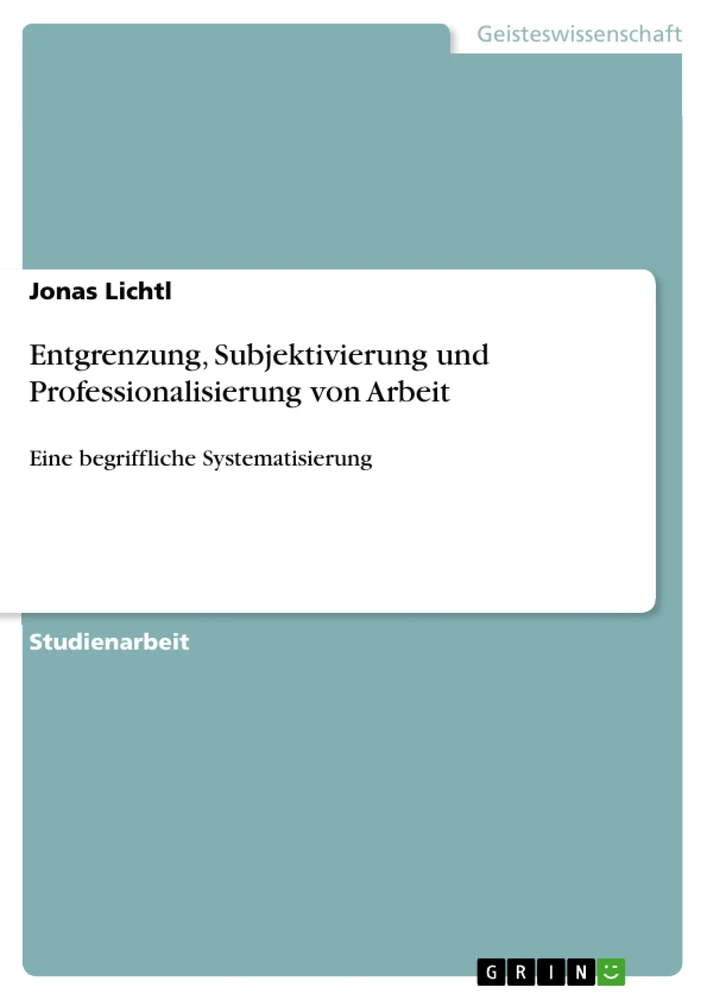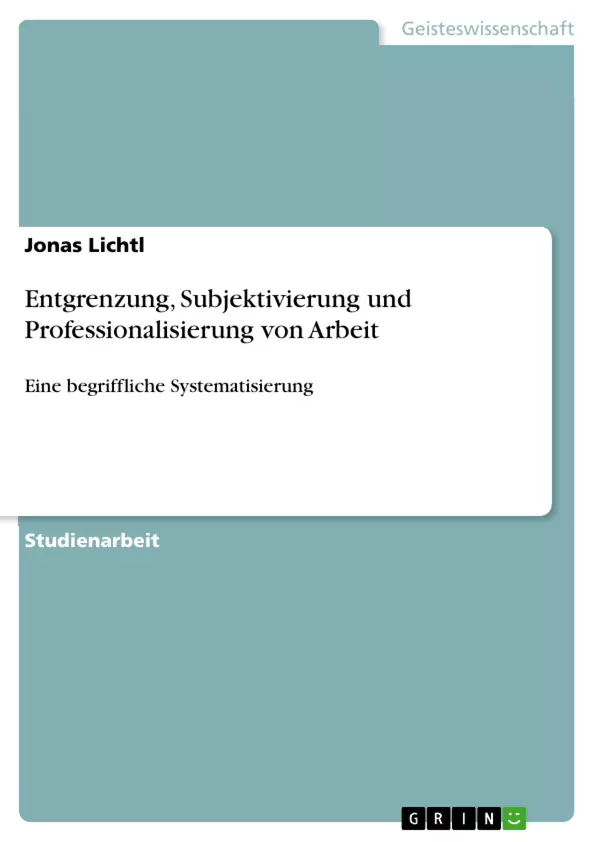Ziel dieser Arbeit ist die systematische Darstellung der Wechselwirkungen der Begriffe Subjektivierung, Entgrenzung und Professionalisierung unter Betrachtung des Spannungsfeldes von Arbeit.
Zunehmende Flexibilisierung und Individualisierung –Mit diesen zwei Schlagworten lassen sich trendhafte Entwicklungen des deutschen Arbeitsmarkts beschreiben. Neben dem demografischen Wandel führen fortschreitende Digitalisierung, Technisierung und Bedeutungswachstum von dispositiver Arbeit zu sich schnell änderten notwendigen Fähigkeits- und Fertigkeitsanforderungen an Mitarbeitende. Diese Entwicklungen stehen symptomatisch für eine Reihe global-systemischer Entwicklungs- und Transformationsprozesse von Gesellschaften.
In der Industrie- und Arbeitssoziologie (IA) werden diese Megatrends u. a. mit den Begriffen Entgrenzung, Subjektivierung und Professionalisierung um- bzw. beschrieben und diskutiert. Bei näherer Betrachtung der Begriffe sind dabei Gemeinsamkeiten und komplexe Wechselwirkungen insbesondere im Spannungsfeld des Begriffes Arbeit dieser zu beobachten. Eine systematische Darstellung dieser Zusammenhänge existiert in der wissenschaftlichen Literatur der IA bisher nicht.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung, Zielstellung, Aufbau und Methodik
- 2. Arbeit
- 3. Subjektivierung
- 4. Entgrenzung
- 5. Professionalisierung
- 6. Schlussbetrachtung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit setzt sich zum Ziel, die Zusammenhänge der Begriffe Subjektivierung, Entgrenzung und Professionalisierung im Kontext von Arbeit systematisch zu analysieren. Dabei soll der Fokus sowohl auf die einzelnen Begriffe als auch auf deren Gemeinsamkeiten, Unterschiede und Beziehungslinien zueinander liegen. Das Ziel ist es, ein umfassendes Bild dieser Begriffe im Spannungsfeld von Arbeit zu zeichnen.
- Arbeit als soziologischer Begriff
- Subjektivierung im Arbeitskontext
- Entgrenzung von Arbeit
- Professionalisierung im Arbeitsmarkt
- Wechselwirkungen und Beziehungen der Begriffe im Kontext von Arbeit
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel führt in die Arbeit ein und legt die Zielsetzung, den Aufbau und die Methodik dar. Kapitel 2 entfaltet den Begriff "Arbeit" aus soziologischer Perspektive, um eine Grundlage für die Analyse der weiteren Begriffe zu schaffen. Die Kapitel 3 bis 5 behandeln die Begriffe "Subjektivierung", "Entgrenzung" und "Professionalisierung" separat, jeweils in Bezug auf den Arbeitskontext, und stellen die Kontexte grafisch dar. Anschließend werden diese in einer gemeinsamen Abbildung systematisch dargestellt. Das letzte Kapitel führt die Ergebnisse der vorhergehenden Kapitel im Spannungsfeld von Arbeit zusammen, um die systematische Darstellung der Zusammenhänge der Begriffe zu vervollständigen.
Schlüsselwörter
Die Arbeit befasst sich mit den Schlüsselbegriffen Subjektivierung, Entgrenzung und Professionalisierung im Kontext von Arbeit. Die Analyse konzentriert sich auf die Gemeinsamkeiten, Unterschiede und Beziehungen dieser Begriffe zueinander im Spannungsfeld von Arbeit. Wesentliche Aspekte der Arbeit umfassen die soziologische Betrachtung des Begriffs "Arbeit", die Darstellung der verschiedenen Aspekte der Subjektivierung, Entgrenzung und Professionalisierung sowie die systematische Darstellung der Wechselwirkungen und Beziehungen der Begriffe im Kontext von Arbeit.
Häufig gestellte Fragen
Was ist das Ziel dieser systematischen Darstellung?
Ziel ist es, die komplexen Wechselwirkungen zwischen den Begriffen Subjektivierung, Entgrenzung und Professionalisierung im Kontext von Arbeit aufzuzeigen.
Was versteht man unter der „Entgrenzung“ von Arbeit?
Entgrenzung beschreibt das Verschwimmen der Grenzen zwischen Arbeitsleben und Privatleben sowie die zunehmende Flexibilisierung von Arbeitszeiten und -orten.
Was bedeutet „Subjektivierung“ im Arbeitskontext?
Subjektivierung meint, dass persönliche Eigenschaften, Emotionen und die gesamte Persönlichkeit der Mitarbeitenden verstärkt in den Arbeitsprozess einbezogen und verwertet werden.
Welche Rolle spielt die Professionalisierung?
Sie bezieht sich auf die sich wandelnden Anforderungen an Fähigkeiten und Fertigkeiten sowie die Etablierung neuer Standards am Arbeitsmarkt.
Welche Trends treiben diese Entwicklungen voran?
Megatrends wie die Digitalisierung, Technisierung und der demografische Wandel sind maßgebliche Treiber für die Transformation der Arbeitswelt.
- Arbeit zitieren
- Jonas Lichtl (Autor:in), 2021, Entgrenzung, Subjektivierung und Professionalisierung von Arbeit, München, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/1254173