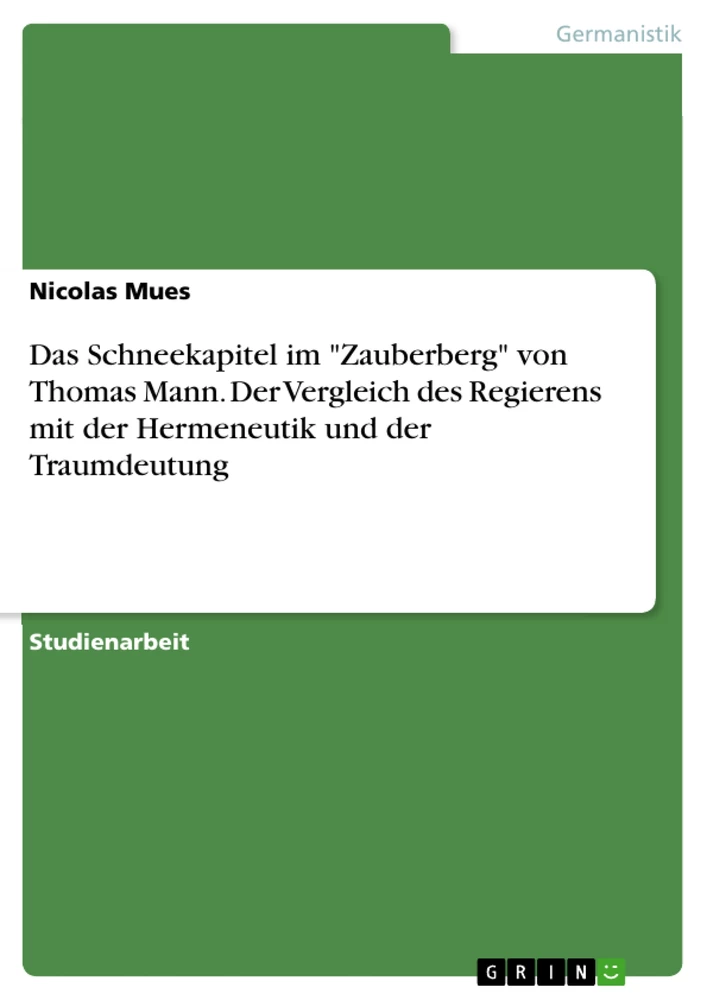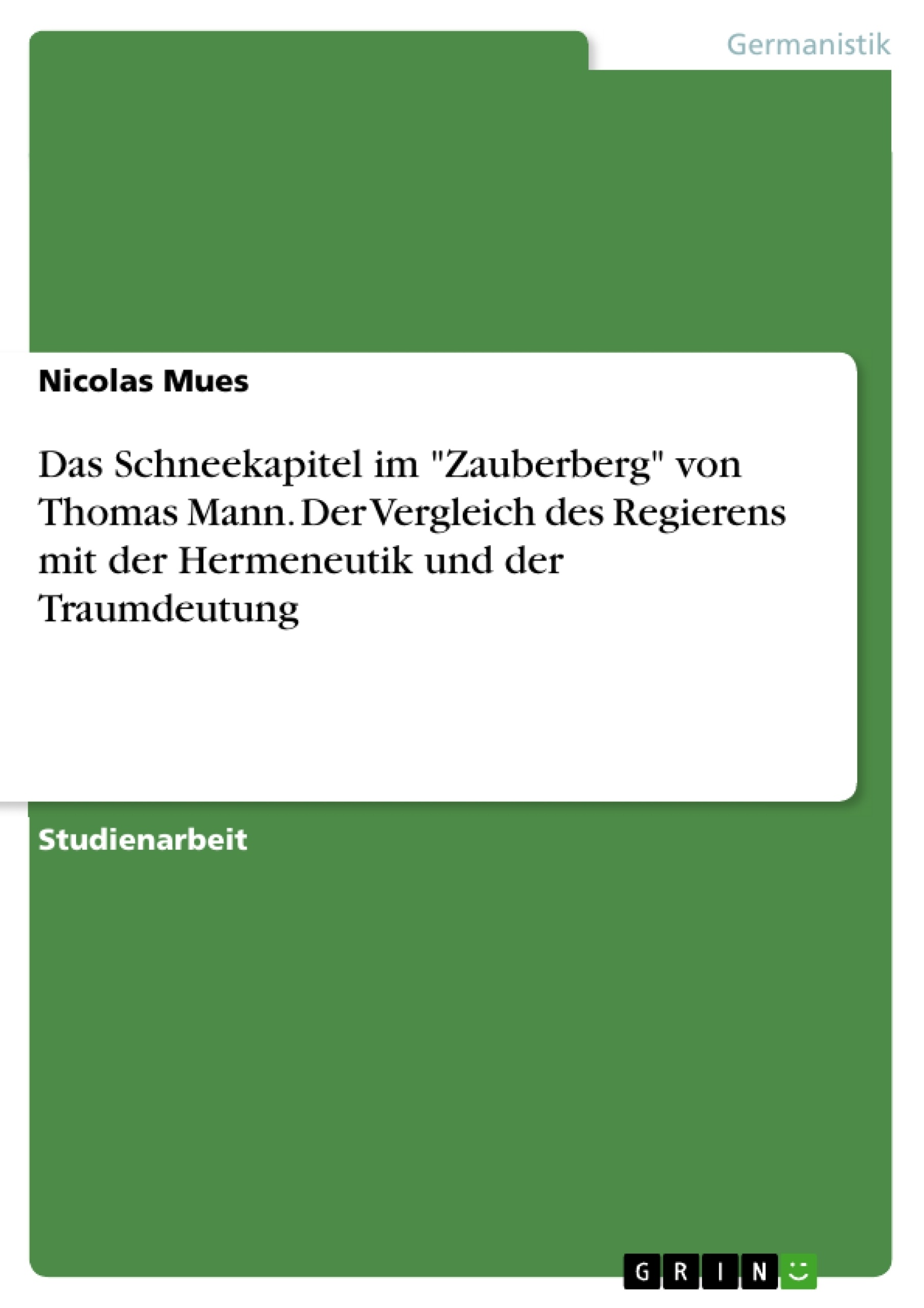Im Zentrum dieser Arbeit steht das Schneekapitel aus Thomas Manns berühmten Buch "Der Zauberberg". Der Protagonist Hans Castorp durchläuft während seiner Zeit im Sanatorium eine pädagogische Ausbildung, vorangetrieben durch den Intellektuellen Settembrini. Im Speziellen befasst sich die Arbeit mit dem Phänomen des Regierens. Bei diesem Phänomen steuert der Protagonist des Zauberbergs seine Gedanken ganz gezielt. Der Höhepunkt dieses Regierens fällt mit dem Höhepunkt des gesamten Romans zusammen, dem sogenannten Schneekapitel. Hans Castorp durchläuft hier einen Fiebertraum und erkennt seine eigenen Gedankenprozesse, basierend auf Kindheitserinnerungen und Selbstreflexionen.
Ziel dieser Arbeit ist es, das Regieren und damit die Gedankengänge des Protagonisten des Zauberbergs, besser nachvollziehen zu können. Als literarische Basis wird der "Zauberberg" und im Speziellen das Schneekapitel herangezogen. Theoretisch bedient sich die Arbeit der Traumdeutung und der philologischen Hermeneutik. Es wird sowohl Bezug genommen auf Dilthey und Schleiermacher als auch auf Freud.
Inhaltsverzeichnis
- 1 Einleitung
- 2 Theoretische Grundlagen
- 2.1 Hermeneutik
- 2.2 Die Traumdeutung nach Freud
- 3 Die Bedeutung des Schneekapitels im Zauberberg und Thomas Manns Gesamtwerk
- 4 Das Regieren
- 4.1 Ein Rückblick auf das Regieren im "Zauberberg"
- 4.2 Die Ermöglichung des Regierens im Schneekapitel
- 4.3 Die Konstruktion der Traumwelt
- 4.4 Der Interpretationsvorgang
- 4.5 Die Ergebnisse des Regierens
- 5 Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Seminararbeit untersucht das Konzept des "Regierens" bei Hans Castorp in Thomas Manns "Zauberberg", insbesondere im Kontext des Schneekapitels. Die Arbeit analysiert, wie Castorps intellektuelle Entwicklung, dargestellt durch sein "Regieren", mit hermeneutischen und psychoanalytischen (Freud'schen Traumdeutung) Ansätzen interpretiert werden kann. Ziel ist es, die Bedeutung des Schneekapitels als Höhepunkt von Castorps Ausbildung und der Romanhandlung herauszuarbeiten.
- Castorps intellektuelle Entwicklung und das Konzept des "Regierens"
- Anwendung hermeneutischer Methoden zur Interpretation des Schneekapitels
- Vergleich des "Regierens" mit Freuds Traumdeutung
- Die Konstruktion der Traumwelt im Schneekapitel
- Die Bedeutung des Schneekapitels als Höhe- oder Wendepunkt des Romans
Zusammenfassung der Kapitel
1 Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik ein und stellt die zentrale Forschungsfrage nach der Bedeutung des "Regierens" bei Hans Castorp und der Rolle des Schneekapitels im "Zauberberg" vor. Sie betont Castorps intellektuelle Entwicklung und seine Distanzierung von den Idealen Settembrinis. Der Fokus liegt auf der Analyse des Schneekapitels als Höhepunkt dieser Entwicklung und als Schlüssel zum Verständnis des gesamten Romans. Die Einleitung begründet die Wahl der hermeneutischen und psychoanalytischen Methoden zur Analyse und formuliert die Ziele der Arbeit.
2 Theoretische Grundlagen: Dieses Kapitel legt die theoretischen Grundlagen der Arbeit dar, indem es die Hermeneutik und Freuds Traumdeutung als methodische Werkzeuge einführt. Es beschreibt die Hermeneutik als Methode der Textinterpretation und des Sinnverstehens, betont die verschiedenen Ebenen des Verstehens (grammatisch und psychologisch) und verdeutlicht die Anwendung hermeneutischer Prinzipien in verschiedenen Disziplinen. Weiterhin wird die Relevanz von Freuds Traumdeutung im Kontext von Castorps Traumsequenz im Schneekapitel hervorgehoben, wobei der Fokus auf der Interpretation von Träumen als Ausdruck des Unbewussten liegt.
Schlüsselwörter
Thomas Mann, Der Zauberberg, Hans Castorp, Schneekapitel, Regieren, Hermeneutik, Traumdeutung, Freud, Bildungsroman, intellektuelle Entwicklung, Psychoanalyse.
Thomas Manns "Der Zauberberg": Häufig gestellte Fragen (FAQ)
Was ist der Gegenstand dieser Seminararbeit?
Die Seminararbeit analysiert das Konzept des "Regierens" bei Hans Castorp in Thomas Manns "Der Zauberberg", insbesondere im Schneekapitel. Sie untersucht Castorps intellektuelle Entwicklung und interpretiert diese mit hermeneutischen und psychoanalytischen (Freud'sche Traumdeutung) Ansätzen.
Welche Ziele verfolgt die Arbeit?
Die Arbeit zielt darauf ab, die Bedeutung des Schneekapitels als Höhepunkt von Castorps Entwicklung und der Romanhandlung herauszuarbeiten. Sie untersucht die Anwendung hermeneutischer Methoden, vergleicht das "Regieren" mit Freuds Traumdeutung und analysiert die Konstruktion der Traumwelt im Schneekapitel.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit und worum geht es in ihnen?
Die Arbeit beinhaltet eine Einleitung, ein Kapitel zu den theoretischen Grundlagen (Hermeneutik und Freuds Traumdeutung), ein Kapitel zur Bedeutung des Schneekapitels im Gesamtwerk, ein Kapitel zum "Regieren" mit Unterkapiteln zum Rückblick, der Ermöglichung, der Traumweltkonstruktion, dem Interpretationsvorgang und den Ergebnissen des Regierens, und abschließend ein Fazit.
Welche theoretischen Grundlagen werden verwendet?
Die Arbeit stützt sich auf hermeneutische Methoden der Textinterpretation und Freuds Traumdeutung. Die Hermeneutik wird als Methode des Sinnverstehens erläutert, und die Relevanz der Traumdeutung für die Interpretation von Castorps Träumen im Schneekapitel wird hervorgehoben.
Welche Schlüsselbegriffe sind zentral für die Arbeit?
Schlüsselbegriffe sind Thomas Mann, Der Zauberberg, Hans Castorp, Schneekapitel, Regieren, Hermeneutik, Traumdeutung, Freud, Bildungsroman, intellektuelle Entwicklung und Psychoanalyse.
Wie wird das "Regieren" im Kontext des Schneekapitels untersucht?
Das "Regieren" wird als Ausdruck von Castorps intellektueller Entwicklung analysiert. Die Arbeit untersucht, wie Castorps "Regieren" im Schneekapitel durch hermeneutische und psychoanalytische Perspektiven interpretiert werden kann, und welche Rolle das Schneekapitel als Wendepunkt in diesem Prozess spielt.
Welche Bedeutung hat das Schneekapitel für die gesamte Romanhandlung?
Das Schneekapitel wird als Höhe- oder Wendepunkt des Romans betrachtet und als Schlüssel zum Verständnis von Castorps Entwicklung und der Gesamtgeschichte interpretiert. Es wird als Höhepunkt seiner intellektuellen Entwicklung und seiner Distanzierung von den Idealen Settembrinis dargestellt.
- Arbeit zitieren
- Nicolas Mues (Autor:in), 2019, Das Schneekapitel im "Zauberberg" von Thomas Mann. Der Vergleich des Regierens mit der Hermeneutik und der Traumdeutung, München, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/1253106